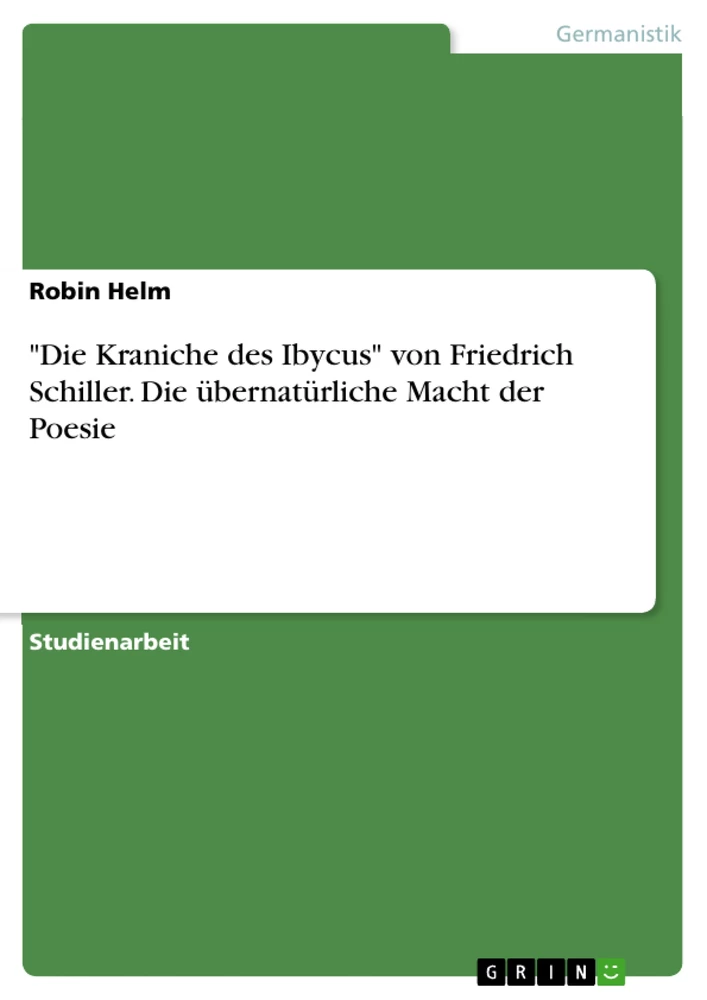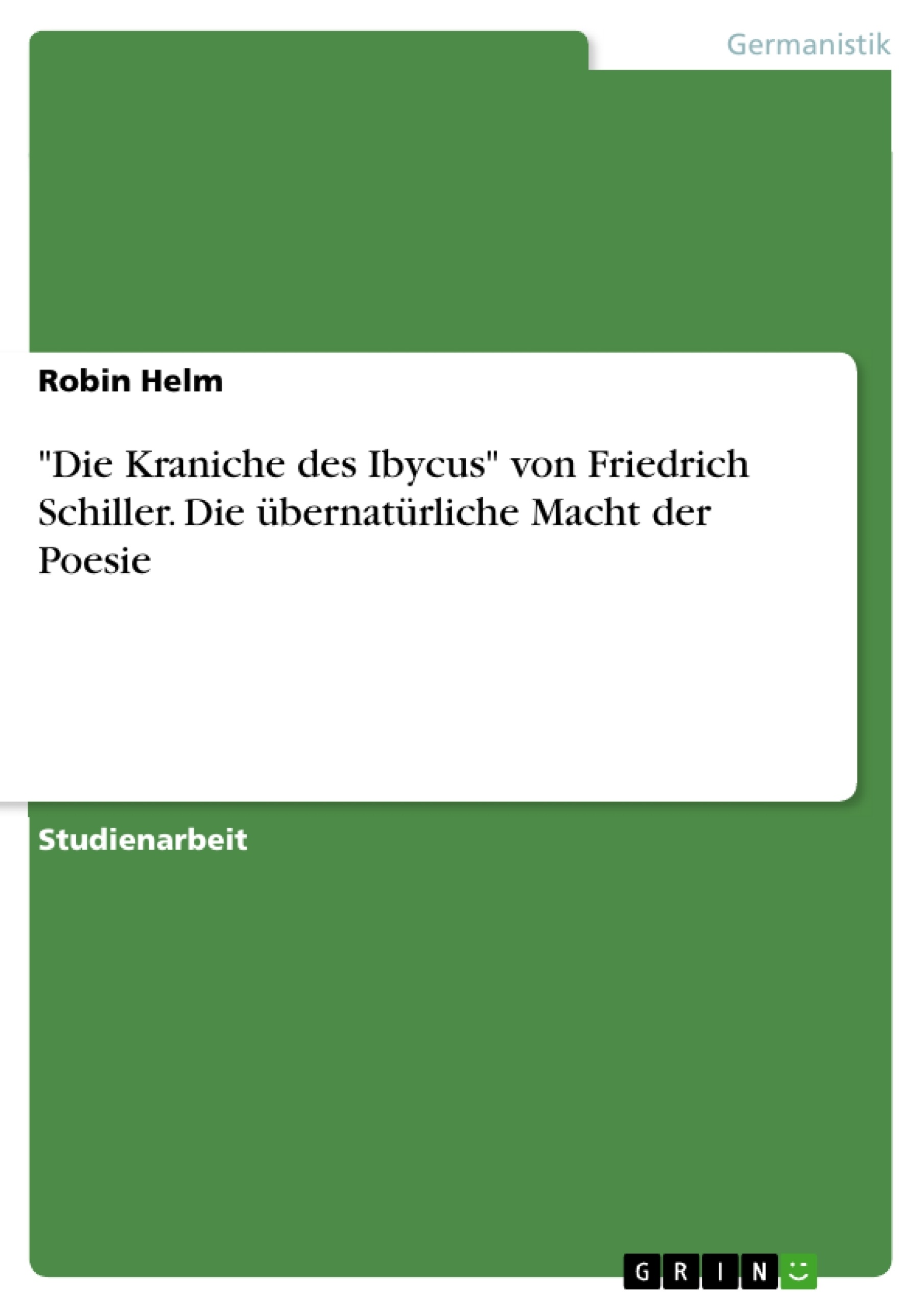In der vorliegenden Hausarbeit wird sowohl der Versuch unternommen, die Idee Schillers einer "übernatürlichen Macht der Poesie" zu ergründen, als auch beabsichtigt, dieses Poesieverständnis anhand der Ballade "Die Kraniche des Ibycus" zu analysieren.
Der erste inhaltliche Gliederungspunkt befasst sich mit der am 26. Juni 1784 von Schiller gehaltenen Rede zum Thema "Die Schaubühne als eine moralische Anstalt". Hierbei soll die Wichtigkeit herausgestellt werden, wie bedeutend das Theater für Schillers Poesieverständnis war. Bemerkenswert ist, was die Ausführungen dieses Vortrages umso interessanter macht, dass Schiller diese Rede 13 Jahre vor der Entstehung der Ballade "Die Kraniche des Ibycus" gehalten hatte.
Im zweiten Abschnitt steht die Entstehungsgeschichte der Ballade im Blickpunkt, wobei das umfangreiche Wirken Goethes auf Schiller und vor allem das polare Poesieverständnis der beiden Dichter dargelegt werden soll. Danach folgt eine strukturelle Analyse des Gedichts, in welcher aufgezeigt werden soll, warum sich gerade die Gattung der Ballade für Schillers Poesieverständnis besonders gut eignete. Abschließend befasst sich der letzte Gliederungspunkt des Hauptteils mit dem von Schiller entworfenen griechischen Großtheater.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Schaubühnenaufsatz Schillers von 1784
- 3. Entstehung der Ballade und das konträre Poesieverständnis Goethes und Schillers
- 4. Strukturelle Analyse der Ballade
- 5. Aufbau und Rolle des Theaters als zentraler Handlungsort
- 6. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Friedrich Schillers Verständnis von der „übernatürlichen Macht der Poesie“, insbesondere im Kontext seiner Ballade „Die Kraniche des Ibycus“. Ziel ist es, dieses Poesieverständnis zu ergründen und anhand der Ballade zu analysieren. Die Arbeit bezieht Schillers Schaubühnenaufsatz von 1784 mit ein, um die Bedeutung des Theaters für sein poetisches Denken aufzuzeigen.
- Schillers Poesieverständnis und die „übernatürliche Macht der Poesie“
- Die Rolle des Theaters in Schillers Werk und seiner Poetik
- Analyse der Ballade „Die Kraniche des Ibycus“ hinsichtlich ihrer Struktur und Thematik
- Der Einfluss der griechischen Antike und Mythologie auf Schillers Werk
- Das Verhältnis von Kunst und Realität in Schillers Poetik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt die zentrale Fragestellung nach Schillers Verständnis von der „übernatürlichen Macht der Poesie“ vor. Sie bezieht sich auf Wilhelm von Humboldts Interpretation der Ballade und betont die Bedeutung des Theaters für Schillers Poetik. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und die Methodik, die zur Analyse der Ballade „Die Kraniche des Ibycus“ verwendet wird, und benennt die wichtigsten Forschungsansätze, die in der Arbeit berücksichtigt werden. Der Fokus liegt auf der Erforschung der Wirkung der Poesie, insbesondere im Zusammenhang mit dem Theater.
2. Der Schaubühnenaufsatz Schillers von 1784: Dieses Kapitel analysiert Schillers Schaubühnenaufsatz von 1784, „Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet“. Es untersucht Schillers Ansicht über die Wirkung des Theaters auf das Publikum, die weit über bloße Unterhaltung hinausgeht. Schiller sah das Theater als ein Werkzeug zur moralischen, intellektuellen und emotionalen Bildung. Der Aufsatz betont die Fähigkeit des Theaters, die menschliche Seele zu beeinflussen und Charaktere zu verändern. Die Kapitel erläutert, wie Schillers Überzeugung von der starken Wirkungskraft des Theaters in der Ballade "Die Kraniche des Ibycus" zum Ausdruck kommt, wobei die Suggestivwirkung des Erinnyenchores und die Transformation der Bühne zu einem Tribunal hervorgehoben werden.
3. Entstehung der Ballade und das konträre Poesieverständnis Goethes und Schillers: (Diese Zusammenfassung wurde aufgrund der fehlenden Informationen im bereitgestellten Text weggelassen.)
Schlüsselwörter
Friedrich Schiller, Die Kraniche des Ibycus, Poesieverständnis, Schaubühne, Theater, Macht der Poesie, Erinnyen, Griechische Antike, Nemesis, Ballade, Moral, Wirkungskraft der Kunst.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Die Kraniche des Ibycus": Eine Analyse von Schillers Poesieverständnis
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht Friedrich Schillers Verständnis von der „übernatürlichen Macht der Poesie“, insbesondere im Kontext seiner Ballade „Die Kraniche des Ibycus“. Dabei wird Schillers Schaubühnenaufsatz von 1784 einbezogen, um die Bedeutung des Theaters für sein poetisches Denken aufzuzeigen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit Schillers Poesieverständnis und der „übernatürlichen Macht der Poesie“, der Rolle des Theaters in Schillers Werk und Poetik, einer strukturellen und thematischen Analyse der Ballade „Die Kraniche des Ibycus“, dem Einfluss der griechischen Antike und Mythologie auf Schillers Werk und dem Verhältnis von Kunst und Realität in Schillers Poetik.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über Schillers Schaubühnenaufsatz von 1784, ein Kapitel zur Entstehung der Ballade und dem Vergleich des Poesieverständnisses von Goethe und Schiller (letzteres ist im vorliegenden Auszug nicht vollständig), eine Kapitel zur Strukturellen Analyse der Ballade, ein Kapitel zum Aufbau und der Rolle des Theaters als Handlungsort und eine Schlussbetrachtung. Die Einleitung stellt die Fragestellung und die Methodik vor, während die Schlussbetrachtung die Ergebnisse zusammenfasst.
Was ist der Inhalt des Kapitels über Schillers Schaubühnenaufsatz von 1784?
Dieses Kapitel analysiert Schillers Schaubühnenaufsatz von 1784, „Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet“. Es untersucht Schillers Ansicht über die Wirkung des Theaters auf das Publikum, die über bloße Unterhaltung hinausgeht und das Theater als Werkzeug zur moralischen, intellektuellen und emotionalen Bildung betrachtet. Der Aufsatz betont die Fähigkeit des Theaters, die menschliche Seele zu beeinflussen und Charaktere zu verändern. Das Kapitel zeigt, wie Schillers Überzeugung von der starken Wirkungskraft des Theaters in der Ballade "Die Kraniche des Ibycus" zum Ausdruck kommt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Friedrich Schiller, Die Kraniche des Ibycus, Poesieverständnis, Schaubühne, Theater, Macht der Poesie, Erinnyen, Griechische Antike, Nemesis, Ballade, Moral, Wirkungskraft der Kunst.
Welche Methode wird zur Analyse der Ballade verwendet?
Die bereitgestellte Zusammenfassung nennt die verwendete Methodik nicht explizit. Weitere Informationen hierzu wären in der vollständigen Hausarbeit zu finden.
Welche Rolle spielt das Theater in Schillers Poetik?
Das Theater spielt eine zentrale Rolle in Schillers Poetik. Schiller sah das Theater nicht nur als Unterhaltungsmedium, sondern als ein Werkzeug zur moralischen, intellektuellen und emotionalen Bildung. Seine Überzeugung von der starken Wirkungskraft des Theaters kommt in der Ballade „Die Kraniche des Ibycus“ zum Ausdruck.
Wie wird Schillers Poesieverständnis definiert?
Schillers Poesieverständnis wird in der Arbeit im Kontext der „übernatürlichen Macht der Poesie“ untersucht. Die genaue Definition ergibt sich aus der Analyse der Ballade und des Schaubühnenaufsatzes.
- Quote paper
- Robin Helm (Author), 2022, "Die Kraniche des Ibycus" von Friedrich Schiller. Die übernatürliche Macht der Poesie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1274398