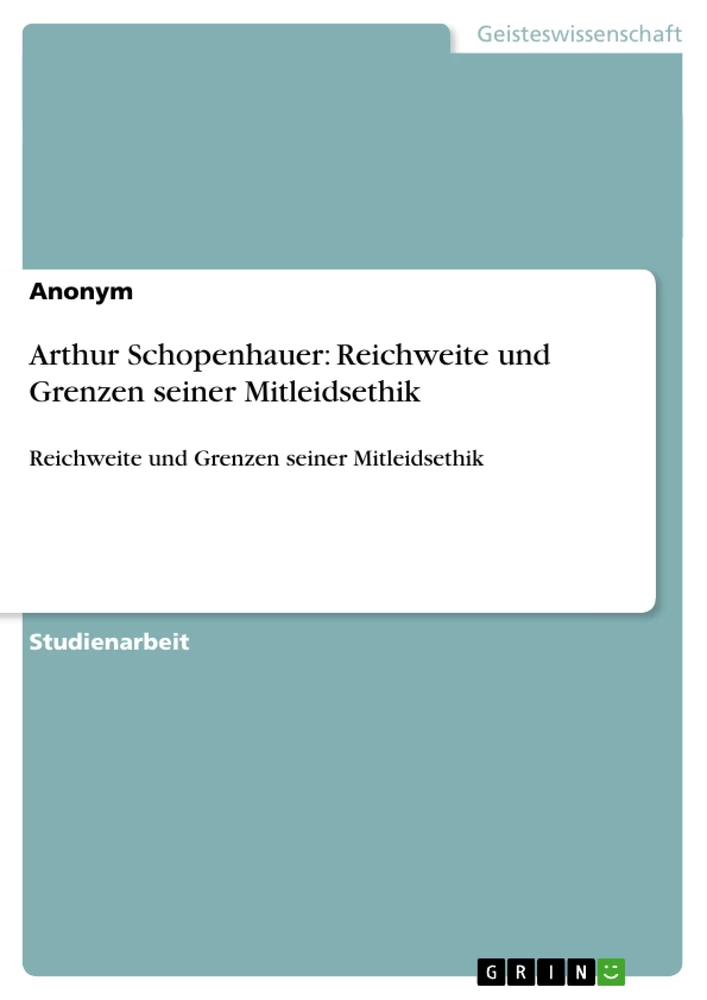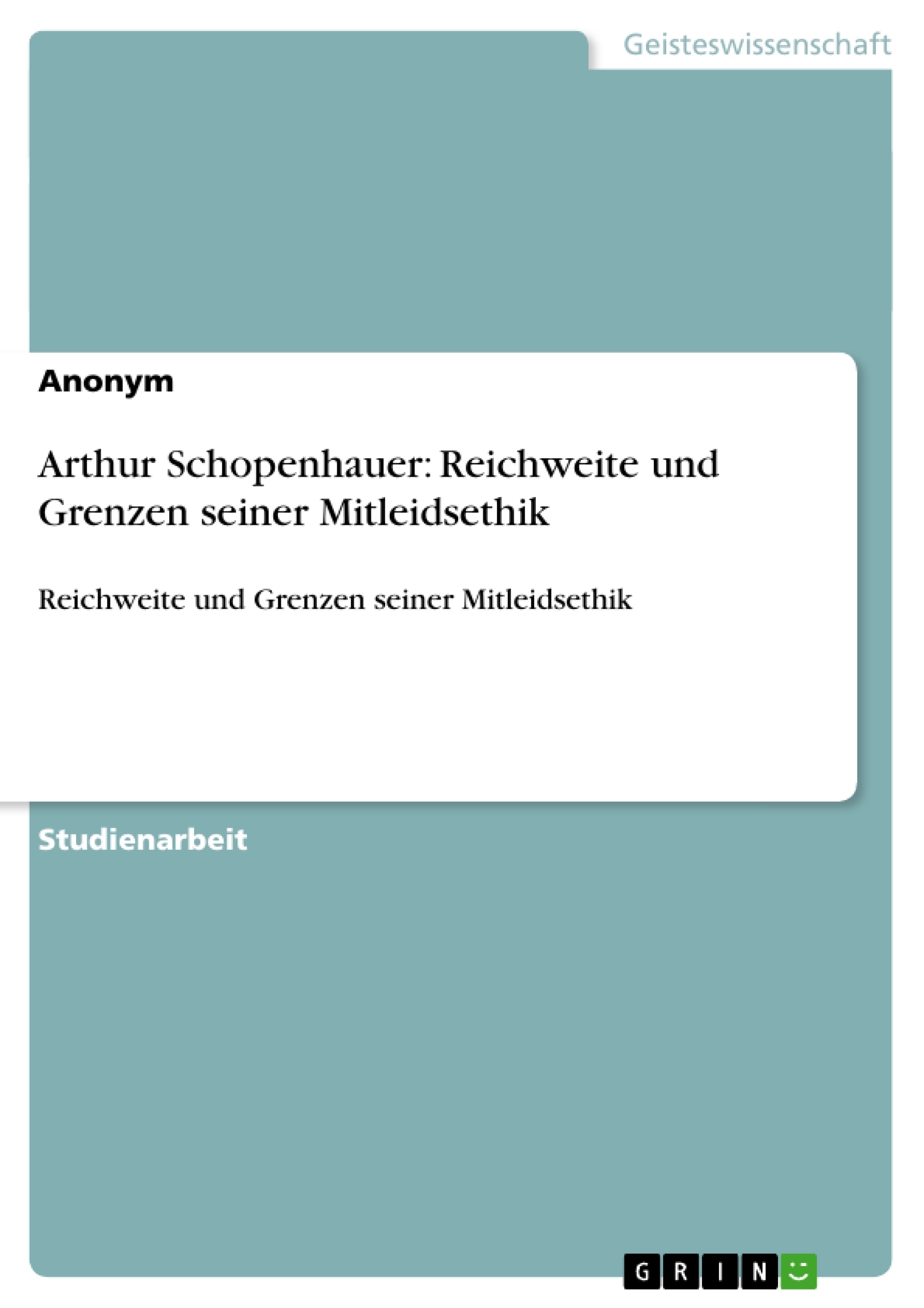Zum 30. Januar 1840 verfasste Arthur Schopenhauer seine „Preisschrift zur Grundlage der Moral“ als Antwort auf die von der „Königlich Dänischen Societät der Wissenschaften zu Kopenhagen“ veröffentlichte Preisfrage, was die Quelle und Grundlage der Moral denn eigentlich sei.
In einem „Allgemeinen Rückblick“ legte Schopenhauer in seiner Schrift zunächst dar, wieso die theologische Moralvorstellung von einem „göttlichen Willen“, der den Menschen moralische Werte und Gesetze vorgeben würde, für ihn rein spekulativer Natur war: Die Existenz einer Gottheit ist nach wie vor nicht bewiesen und kann daher nicht als das Fundament einer Moral dienen, denn dieses müsse gesichert sein. Generell waren für Schopenhauer alle bishe-rigen Versuche einer Moraldeutung unzureichend: „Zu allen Zeiten ist viele und gute Moral gepredigt worden, aber die Begründung derselben hat stets im Argen gelegen.“ Damit wendet sich Schopenhauer auch gegen den deutschen Philosophen Immanuel Kant, dessen Ethik die letzten 60 Jahre gegolten habe, obwohl sie – nach Ansicht Schopenhauers - nicht haltbar ist. Schopenhauers Preisschrift erhob daher den Anspruch, der Moral ein besseres und vor allem nachweisbares Fundament zu liefern.
Da er bereits 1839 den ersten Preis für seine Schrift „Ueber den Willen in der Natur“ erhalten hatte, schickte er etwa zwei Monate nach der Einreichung seines Ethikentwurfs siegessicher ein Schreiben an die königliche Societät: „Von dem errungenen Sieg bitte ich mich alsbald durch die Post benachrichtigen zu wollen. Den mir zuerkannten Preis aber hoffe ich… auf diplomatischem Wege von Ihnen zugeschickt zu erhalten.“ Entsprechend groß muss seine Enttäuschung gewesen sein, als er wider Erwarten nicht zum Sieger gekürt wurde.
War die Welt dem Anspruch seiner Ethik nicht gewachsen? Bestand sie nicht, weil sie das Leiden als Weltprinzip postulierte? Oder ist Schopenhauers Ethik etwa unzureichend, in sich selbst widersprüchlich, oder aus anderen Gründen nicht als das Fundament einer Moral geeignet?
Ich möchte in dieser Arbeit zunächst die Ethik Schopenhauers analysieren und ihre wesentlichen Thesen darstellen, um diese im Folgenden einer Bewertung zu unterziehen. Ich werde dazu auch die Meinungen anderer Schopenhauerkritiker berücksichtigen, um letztlich meine eigene Antwort auf die Frage zu finden, wo die Grenzen der Schopenhauer’schen Ethik liegen und auch, worin Schopenhauers Verdienst für die heutige Ethikdiskussion besteht.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung zum Thema
- Die Mitleidsethik
- Schopenhauers Weltsicht
- Abgrenzung zu Immanuel Kant
- Der Egoismus als Antimoral
- Handlungen von moralischem Wert
- Beweis der moralischen Triebfeder
- Die zwei Kardinaltugenden
- Metaphysische Grundlage
- Reichweite und Grenzen der Ethik Schopenhauers
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Ethik Arthur Schopenhauers, insbesondere mit seiner Mitleidsethik. Sie analysiert die zentralen Thesen seiner Moralphilosophie und untersucht deren Reichweite und Grenzen. Die Arbeit setzt sich mit Schopenhauers Weltsicht, seiner Abgrenzung zu Immanuel Kant und seinen zentralen Argumenten für eine Mitleidsethik auseinander.
- Schopenhauers Weltsicht und die Bedeutung des Leidens
- Die Kritik an Kants kategorischem Imperativ
- Die Rolle des Mitleids als moralische Triebfeder
- Die zwei Kardinaltugenden: Gerechtigkeit und Nächstenliebe
- Die metaphysische Grundlage der Schopenhauer'schen Ethik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Hinführung zum Thema und stellt Schopenhauers Preisschrift zur Grundlage der Moral vor. Sie beleuchtet die Kritik an der theologischen Moralvorstellung und die Abgrenzung zu Kants Ethik. Im zweiten Kapitel wird Schopenhauers Weltsicht und seine Mitleidsethik im Detail analysiert. Es werden die zentralen Argumente für eine Ethik des Mitleids dargestellt und die Abgrenzung zu Kants kategorischem Imperativ erläutert. Das dritte Kapitel widmet sich der metaphysischen Grundlage der Schopenhauer'schen Ethik. Es wird untersucht, wie Schopenhauer das Leiden und das Mitleid in seine philosophische Weltsicht integriert. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Reichweite und den Grenzen der Schopenhauer'schen Ethik. Es werden die Kritikpunkte an seiner Moralphilosophie beleuchtet und die Frage nach der Praktikabilität seiner Ethik diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Mitleidsethik, Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant, kategorischer Imperativ, Leiden, Weltsicht, Moral, Ethik, Gerechtigkeit, Nächstenliebe, metaphysische Grundlage, Reichweite, Grenzen, Kritik.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2009, Arthur Schopenhauer. Reichweite und Grenzen seiner Mitleidsethik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127388