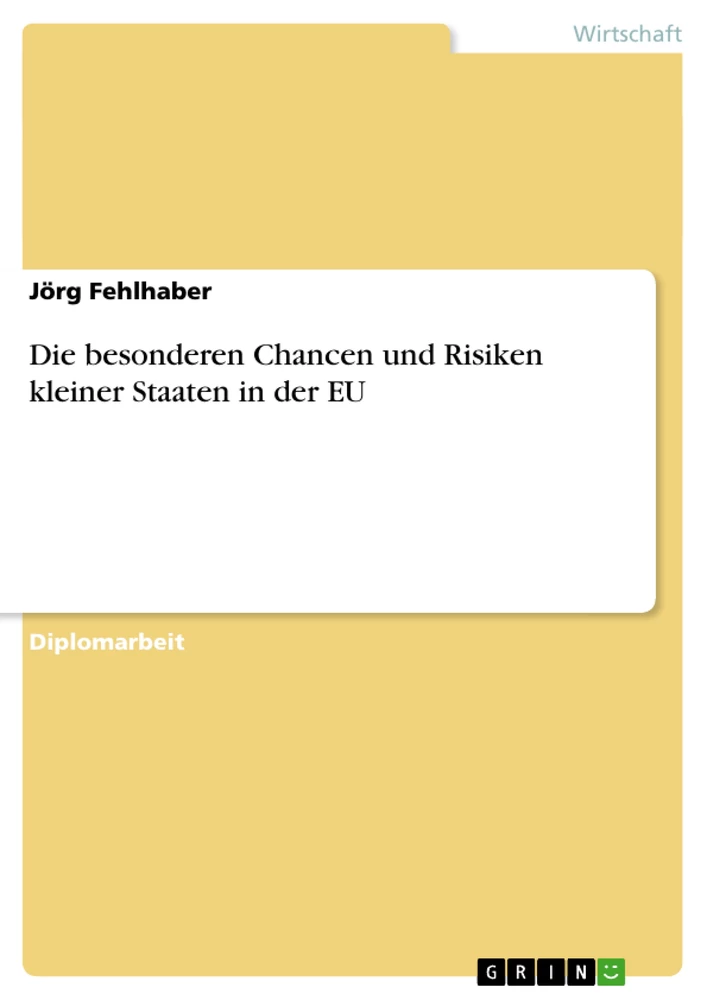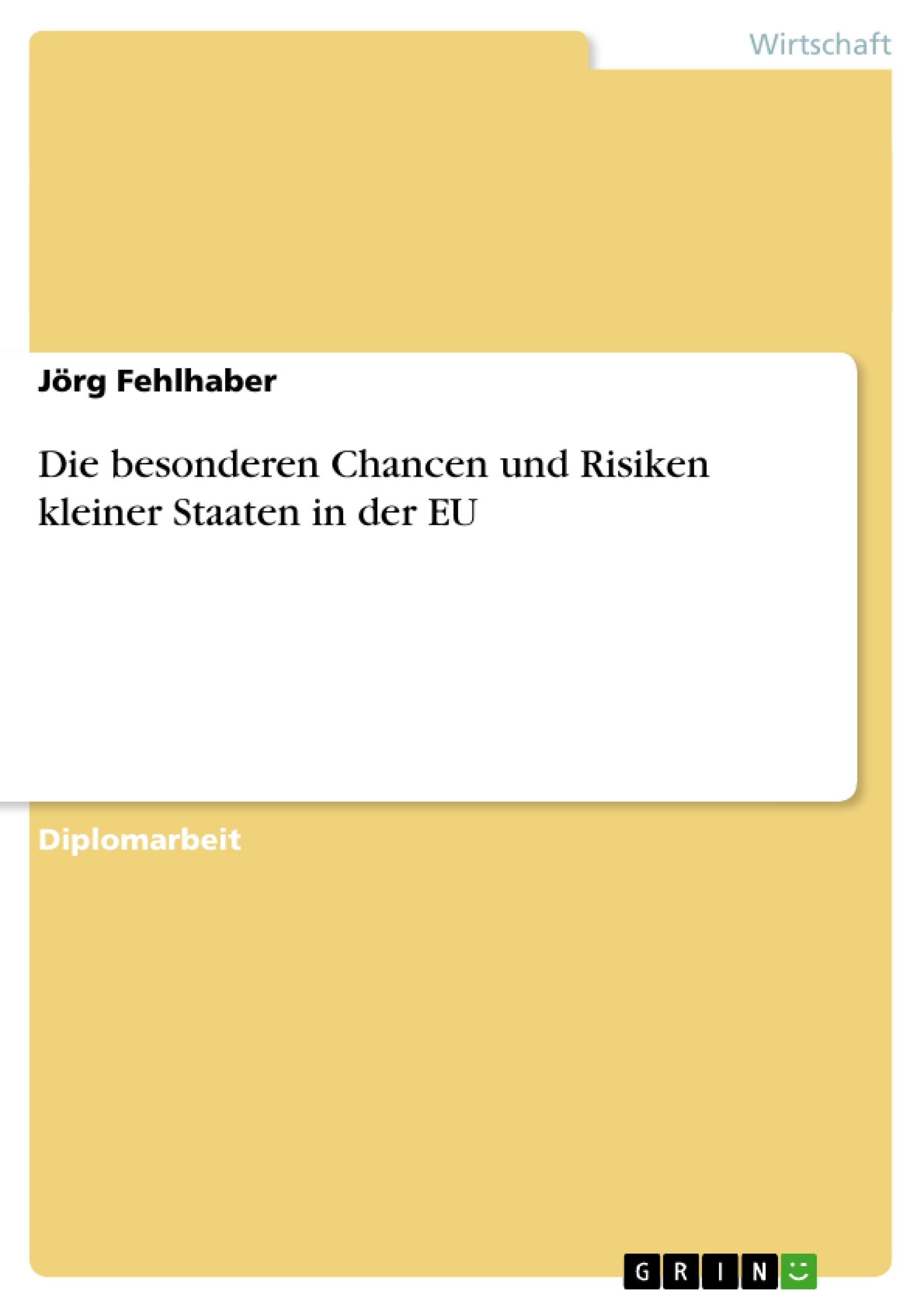Die Europäische Union (EU) besteht seit der letzten Erweiterung am 01.01.2007 aus 27 Mitgliedstaaten mit rund 500 Millionen Einwohnern. Durch die Aufnahme von 12 neuen Staaten seit 2004 hat sich die Gemeinschaft stark verändert und wurde immer heterogener. Die Zahl der kleinen Staaten ist ebenfalls angestiegen. Jedoch gibt es in der Literatur keine Einigung darüber, wie ein kleiner Staat definiert werden sollte.
In dieser Arbeit sollen die besonderen Chancen und Risiken kleiner Staaten in der EU aufgezeigt werden. Die Kleinheit eines Landes sollte von mehreren Seiten betrachtet werden, um die Möglichkeiten, die Gefahren und den Einfluss kleiner Staaten im Zusammenhang zu der gesamten Europäischen Union zu verstehen. Ihre Heterogenität in den Bereichen historischer Hintergrund, geographische Lage, natürliche Ressourcen, Einwohnerzahl, Humankapital, Bruttoinlandsprodukt (BIP) etc. sind von entscheidender Bedeutung, um die Rolle der kleinen Staaten in der EU näher zu erläutern. Außerdem soll ihr Machtpotential in Verhandlungsprozessen und den EU-Politikbereichen dargestellt werden, bevor zum Schluss ein Vergleich der Theorie mit der Praxis Aufschluss über die Vor- und Nachteile eines EU-Beitritts gibt.
Im zweiten Kapitel werden zunächst verschiedene Konzepte vorgestellt, die dazu beitragen, dass ein kleiner Staat allgemein definiert werden kann. Dies soll der späteren Einordnung dienen. Neben den traditionellen einfachen Bestimmungsfaktoren werden stark vereinfachte aggregierte Indikatoren dargelegt.
Ziel des dritten Kapitels ist es, die theoretischen Aspekte der Größe und ihre Auswirkungen auf ihre Entwicklungen in der EU darzustellen. Es werden Theorien und Modelle der Literatur betrachtet, die die theoretischen Probleme kleiner Staaten darstellen.
Nach den Grundlagen der Messungen zur Bestimmung kleiner Staaten und dem theoretischen Überblick wird eine Kategorisierung vorgenommen, in der sieben Länder der EU abgegrenzt werden, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit als klein gelten.
Gegenstand des vierten Kapitels ist die Bedeutung der Größe in EU-Verhandlungsprozessen. Nach einer kurzen Einführung in die drei wichtigsten EU-Institutionen des Rates, des Parlaments und der Kommission werden die jeweiligen Abstimmungsvorgänge sowie der Einfluss kleiner Staaten auf die EU-Verhandlungen erklärt. Anschließend wird die damit verbundene Frage nach einer eventuellen Überrepräsentation der kleinen Staaten beantwortet
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Konzepte zur Bestimmung eines kleinen Landes
- 2.1 Einfache Indikatoren kleiner Staaten
- 2.1.1 Die Bevölkerung als Größenindikator
- 2.1.2 Die geographische Ausdehnung als Größenindikator
- 2.1.3 Das Bruttoinlandsprodukt / BIP pro Kopf in KKS als Größenindikator
- 2.2 Aggregierte Indikatoren kleiner Staaten
- 2.2.1 Einfache Indexbildung als Methode zur Abgrenzung kleiner Staaten
- 2.2.2 Faktorenanalysen als Methode zur Abgrenzung kleiner Staaten
- 2.2.3 Clusteranalysen als Methode zur Abgrenzung kleiner Staaten
- 3. Die Bedeutung der Größe in der Theorie
- 3.1 Auswirkungen geringer Staatsgröße
- 3.2 Die EU-Mitgliedschaft kleiner Staaten
- 4. Die Bedeutung der Größe in Verhandlungsprozessen
- 4.1 Das Machtdreieck Europas: Wer hat den größten Einfluss auf die EU?
- 4.2 Abstimmungsvorgänge in der EU: Wenig Stimmen, wenig Einfluss?
- 4.3 Kleine Staaten in der EU: Überrepräsentiert oder dominiert von den „Großen“?
- 4.4 Der EU-Haushalt: Sind alle kleinen Staaten Nehmerländer?
- 5. Die Bedeutung der Größe in den EU-Politikbereichen
- 5.1 Der EU-Binnenmarkt
- 5.1.1 Die „Vier Grundfreiheiten“
- 5.1.2 Auswirkungen des gemeinsamen Binnenmarktes auf die kleinen Staaten
- 5.2 Die EU-Agrarpolitik
- 5.2.1 Die Ziele der EU-Agrarpolitik
- 5.2.2 Auswirkungen der EU-Agrarpolitik auf die kleinen Staaten der EU
- 5.3 Die EU-Regional- und Strukturpolitik
- 5.3.1 Ziele und Instrumente der EU-Regional- und Strukturpolitik
- 5.3.2 Auswirkungen der Regional- und Strukturpolitik auf die kleinen Staaten der EU
- 6. Theorie vs. Realität - Die EU-Mitgliedschaft kleiner Staaten: Notwendigkeit oder falsche Hoffnung?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die spezifischen Chancen und Risiken kleiner EU-Mitgliedsstaaten. Das Ziel ist es, die Auswirkungen der Staatsgröße auf verschiedene Aspekte der EU-Mitgliedschaft zu analysieren und ein umfassendes Bild der Rolle kleiner Staaten in der Europäischen Union zu zeichnen.
- Definition und Kategorisierung kleiner Staaten in der EU
- Theoretische Auswirkungen der Staatsgröße auf die wirtschaftliche und politische Entwicklung
- Einfluss kleiner Staaten in EU-Verhandlungsprozessen und Entscheidungsfindung
- Auswirkungen der EU-Politik (Binnenmarkt, Agrarpolitik, Regionalpolitik) auf kleine Staaten
- Vergleich von Theorie und Praxis der EU-Mitgliedschaft kleiner Staaten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit, die Heterogenität der EU nach der Osterweiterung und die fehlende Einigkeit über die Definition eines „kleinen Staates“. Sie skizziert die Ziele der Arbeit: die Chancen und Risiken kleiner Staaten in der EU aufzuzeigen und deren Machtpotenzial zu analysieren, indem sie verschiedene Faktoren wie historische Hintergründe, geografische Lage und ökonomische Indikatoren berücksichtigt.
2. Konzepte zur Bestimmung eines kleinen Landes: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Konzepte zur Definition kleiner Staaten. Es werden sowohl einfache Indikatoren wie Bevölkerungszahl, geografische Ausdehnung und BIP pro Kopf als auch aggregierte Indikatoren wie Indexverfahren und Faktorenanalysen vorgestellt. Der Fokus liegt auf der methodischen Herangehensweise an die Bestimmung der Staatsgröße und der Herausforderungen bei der Entwicklung eines objektiven und umfassenden Maßstabs.
3. Die Bedeutung der Größe in der Theorie: Kapitel 3 befasst sich mit den theoretischen Auswirkungen der Staatsgröße auf die Entwicklung kleiner Staaten in der EU. Es analysiert verschiedene Theorien und Modelle, die die spezifischen Herausforderungen und Chancen kleiner Staaten im Kontext der EU beleuchten. Der Schwerpunkt liegt auf der Erklärung der theoretischen Zusammenhänge zwischen Staatsgröße und wirtschaftlicher, politischer sowie gesellschaftlicher Entwicklung.
4. Die Bedeutung der Größe in Verhandlungsprozessen: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung der Staatsgröße im Rahmen der EU-Verhandlungsprozesse. Es untersucht das „Machtdreieck“ aus Rat, Parlament und Kommission und beleuchtet die Abstimmungsmechanismen und den Einfluss kleiner Staaten auf die Entscheidungsfindung. Die Frage nach einer Über- oder Unterrepräsentation kleiner Staaten wird diskutiert.
5. Die Bedeutung der Größe in den EU-Politikbereichen: Kapitel 5 untersucht die Auswirkungen der Größe auf die Beteiligung kleiner Staaten an wichtigen EU-Politikbereichen wie dem Binnenmarkt, der Agrarpolitik und der Regionalpolitik. Es analysiert die spezifischen Herausforderungen und Chancen für kleine Staaten in diesen Bereichen und bewertet deren Einfluss auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung.
Schlüsselwörter
Kleine Staaten, Europäische Union, Staatsgröße, Wirtschaftspolitik, Verhandlungsmacht, EU-Politikbereiche (Binnenmarkt, Agrarpolitik, Regionalpolitik), Theoretische Modelle, Empirische Analyse, Chancen und Risiken.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Die Bedeutung der Größe für kleine Staaten in der Europäischen Union
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Chancen und Risiken kleiner EU-Mitgliedsstaaten. Sie analysiert die Auswirkungen der Staatsgröße auf verschiedene Aspekte der EU-Mitgliedschaft und zeichnet ein umfassendes Bild der Rolle kleiner Staaten in der Europäischen Union.
Wie werden kleine Staaten in dieser Arbeit definiert?
Die Arbeit untersucht verschiedene Konzepte zur Definition kleiner Staaten. Es werden sowohl einfache Indikatoren (Bevölkerung, geografische Ausdehnung, BIP pro Kopf) als auch aggregierte Indikatoren (Indexverfahren, Faktorenanalysen, Clusteranalysen) betrachtet. Die Arbeit betont die methodischen Herausforderungen bei der Entwicklung eines objektiven und umfassenden Maßstabs für "Staatsgröße".
Welche theoretischen Aspekte werden behandelt?
Kapitel 3 befasst sich mit den theoretischen Auswirkungen der Staatsgröße auf die Entwicklung kleiner Staaten in der EU. Es analysiert Theorien und Modelle, die die Herausforderungen und Chancen kleiner Staaten im EU-Kontext beleuchten. Der Schwerpunkt liegt auf dem Zusammenhang zwischen Staatsgröße und wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Entwicklung.
Wie wird der Einfluss kleiner Staaten in EU-Verhandlungsprozessen dargestellt?
Kapitel 4 analysiert die Bedeutung der Staatsgröße in EU-Verhandlungsprozessen. Es untersucht das „Machtdreieck“ (Rat, Parlament, Kommission), die Abstimmungsmechanismen und den Einfluss kleiner Staaten auf die Entscheidungsfindung. Die Frage der Über- oder Unterrepräsentation kleiner Staaten wird diskutiert, inklusive der Betrachtung des EU-Haushaltes und ob kleine Staaten primär Empfängerländer sind.
Welche EU-Politikbereiche werden untersucht?
Kapitel 5 untersucht die Auswirkungen der Staatsgröße auf die Beteiligung kleiner Staaten an wichtigen EU-Politikbereichen: Binnenmarkt (inkl. der vier Grundfreiheiten), Agrarpolitik und Regionalpolitik. Es analysiert die spezifischen Herausforderungen und Chancen für kleine Staaten in diesen Bereichen und deren Einfluss auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung.
Wie werden Theorie und Praxis der EU-Mitgliedschaft kleiner Staaten verglichen?
Das letzte Kapitel (Kapitel 6) vergleicht die theoretischen Erkenntnisse mit der Realität der EU-Mitgliedschaft kleiner Staaten. Es bewertet, ob die EU-Mitgliedschaft für kleine Staaten eine Notwendigkeit oder eine falsche Hoffnung darstellt.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Arbeit bietet Zusammenfassungen für jedes Kapitel (Einleitung, Konzepte zur Bestimmung eines kleinen Landes, Bedeutung der Größe in der Theorie, Bedeutung der Größe in Verhandlungsprozessen, Bedeutung der Größe in den EU-Politikbereichen und Theorie vs. Realität).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kleine Staaten, Europäische Union, Staatsgröße, Wirtschaftspolitik, Verhandlungsmacht, EU-Politikbereiche (Binnenmarkt, Agrarpolitik, Regionalpolitik), Theoretische Modelle, Empirische Analyse, Chancen und Risiken.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die spezifischen Chancen und Risiken kleiner EU-Mitgliedsstaaten zu untersuchen. Das Ziel ist eine umfassende Analyse der Auswirkungen der Staatsgröße auf verschiedene Aspekte der EU-Mitgliedschaft und ein umfassendes Bild der Rolle kleiner Staaten in der EU.
- Quote paper
- Jörg Fehlhaber (Author), 2009, Die besonderen Chancen und Risiken kleiner Staaten in der EU, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127348