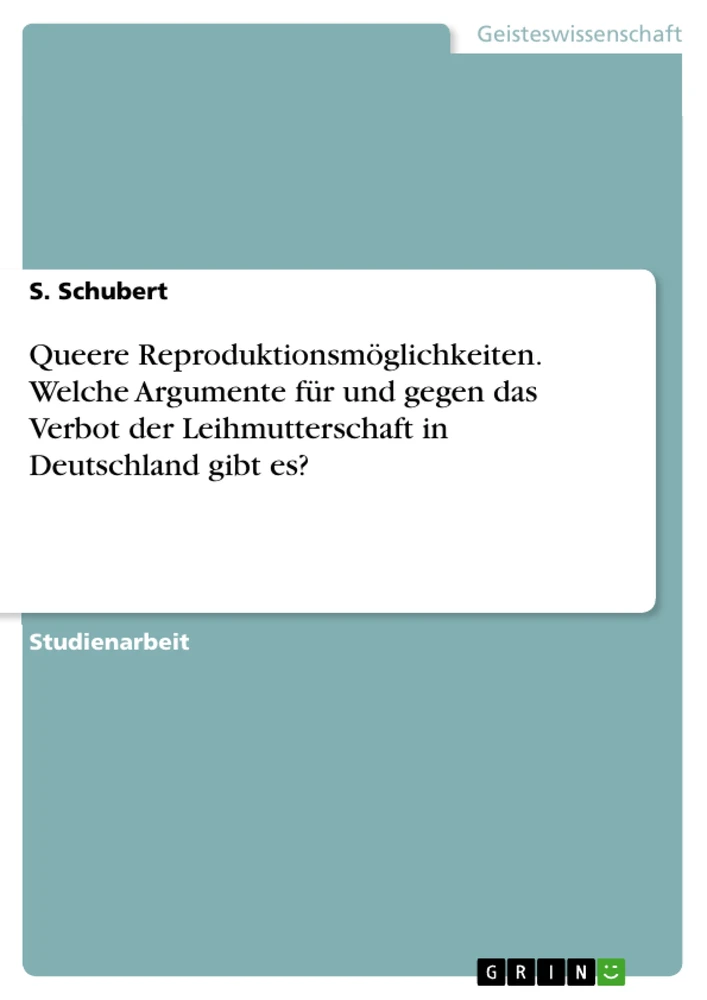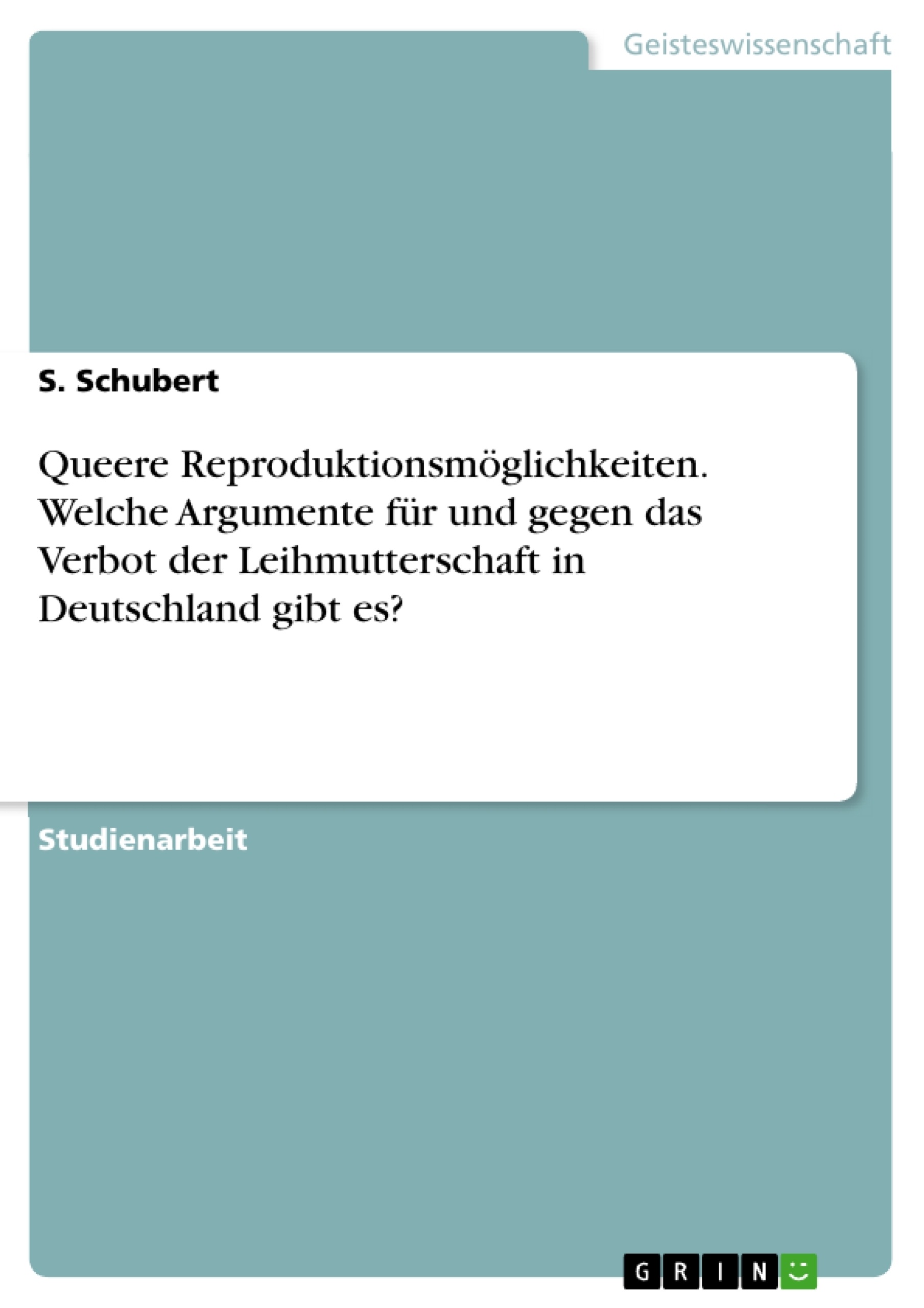Der Fortpflanzungswunsch und der Wunsch nach einem genetisch von den Eltern abstammenden Kind ist eines der grundlegenden Merkmale menschlicher Existenz. Für heterosexuelle Paare, bei denen die Frau aus biologischen Gründen kein Kind bekommen kann, aber auch für queere Paare, stellt die Leihmutterschaft die einzige Möglichkeit dar, diesen Wunsch zu erfüllen.
Im Januar 2022 trat in Israel eine Gesetzesänderung in Kraft, welche es Single-Männern und homosexuellen Paaren erlaubt, ihren Kinderwunsch mithilfe einer Leihmutter zu erfüllen. Da dieser Weg bisher ausschließlich ledigen Frauen und heterosexuellen Paaren offenstand, ist dies ein bedeutender Schritt für die LGBTQIA+-Bewegung Israels. In Deutschland hingegen ist die Leihmutterschaft verboten und im öffentlichen Diskurs negativ konnotiert. Dabei handelt es sich bei der Zuhilfenahme einer Leihmutter nicht um die bequeme Wahl des Reproduktionswegs, sondern eher um die letzte Möglichkeit zur Fortpflanzung.
Angesichts der gravierenden Unterschiede der Gesetzgebungen und der Darstellung der Thematik in den Medien, ist es interessant zu analysieren, welche Argumente für und gegen das Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland gibt. In dieser Arbeit wird demnach untersucht, welche Risiken und welche Möglichkeiten die Leihmutterschaft für die queere Fortpflanzungsmöglichkeit hat und ob das gesetzliche Verbot sinnvoll ist.
Zunächst wird die Gesetzeslage in Deutschland hinsichtlich des Einsatzes reproduktionsmedizinischer Maßnahmen dargelegt. Im Anschluss werden unterstützende Argumente für die Illegalität der Leihmutterschaft aufgezeigt, Schattenseiten beleuchtet und Risiken kritisch betrachtet. Daraufhin wird untersucht, welche Möglichkeiten eine Legalisierung der Leihmutterschaft für die queere Reproduktion bieten kann und was gegen das Verbot spricht. Zum Schluss werden Pro- und Contra-Argumente nochmals kurz zusammengefasst und in einem abschließenden Fazit abgewogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gesetzeslage der Leihmutterschaft in Deutschland
- Unterstützende Argumente für das Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland
- Argumente gegen das Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland
- Fazit und Schlussüberlegungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Argumente für und gegen das Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland, fokussiert auf die Perspektiven queerer Paare. Sie untersucht die aktuelle Gesetzeslage und bewertet die Risiken und Chancen einer Legalisierung für queere Reproduktionsmöglichkeiten.
- Gesetzeslage der Leihmutterschaft in Deutschland
- Argumente für ein Verbot der Leihmutterschaft
- Argumente gegen ein Verbot der Leihmutterschaft
- Die Auswirkungen auf queere Paare
- Vergleich mit internationalen Rechtslagen (Beispiel Israel)
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der queeren Reproduktionsmöglichkeiten und des Verbots der Leihmutterschaft in Deutschland ein. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Familienmodelle von LGBTQIA+-Personen und den Wunsch nach biologischer Elternschaft. Der Vergleich mit der Gesetzesänderung in Israel, die Leihmutterschaft für homosexuelle Paare erlaubt, unterstreicht die Diskrepanz und die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit der deutschen Rechtslage. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Analyse.
Gesetzeslage der Leihmutterschaft in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die rechtlichen Rahmenbedingungen der Leihmutterschaft in Deutschland. Es erklärt das Verfahren der Leihmutterschaft bei heterosexuellen und queeren Paaren und beleuchtet die relevanten Paragraphen des Embryonenschutzgesetzes (ESchG) und des Adoptionsvermittlungsgesetzes (AdVermiG), die die Leihmutterschaft verbieten. Die Begründung des Verbots, das Wohl des Kindes, wird erläutert, ebenso die Probleme bezüglich der rechtlichen Elternschaft nach der Geburt. Das Kapitel liefert eine fundierte Grundlage für die folgende Argumentationsanalyse.
Unterstützende Argumente für das Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland: Dieser Abschnitt präsentiert die Argumente, die das Verbot der Leihmutterschaft stützen. Es wird erwartet, dass hier ethische Bedenken, mögliche Ausbeutung der Leihmutter, das Kindeswohl und die Sorge um einen möglicherweise kommerzialisierten Markt für Kinder im Mittelpunkt stehen. Die Argumente werden kritisch beleuchtet und im Kontext der deutschen Rechtsordnung bewertet.
Argumente gegen das Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland: Dieses Kapitel analysiert die Argumente, die eine Legalisierung der Leihmutterschaft befürworten. Es werden die Perspektiven queerer Paare berücksichtigt und die Einschränkungen ihrer Reproduktionsrechte thematisiert. Die Ausführungen fokussieren möglicherweise auf Selbstbestimmungsrechte, die Gleichstellung von LGBTQIA+-Paaren mit heterosexuellen Paaren und die ethischen Aspekte der Ablehnung eines reproduktiven Wunsches. Die Bedeutung der Leihmutterschaft als letzte Möglichkeit der Fortpflanzung für manche Paare wird betont.
Schlüsselwörter
Leihmutterschaft, LGBTQIA+, Reproduktionsmedizin, Embryonenschutzgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz, queere Familien, Rechtsvergleich, Selbstbestimmung, Kindeswohl, ethische Aspekte, Ausbeutung.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: "Leihmutterschaft in Deutschland und queere Paare"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Argumente für und gegen das Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland, mit besonderem Fokus auf die Perspektiven queerer Paare. Sie untersucht die aktuelle Gesetzeslage und bewertet die Risiken und Chancen einer Legalisierung für queere Reproduktionsmöglichkeiten. Der Vergleich mit der Gesetzeslage in Israel dient als Beispiel.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst die deutsche Gesetzeslage zur Leihmutterschaft, Argumente für und gegen ein Verbot, die Auswirkungen auf queere Paare und einen Vergleich mit internationalen Rechtslagen (z.B. Israel). Ethische Aspekte, das Kindeswohl und die Selbstbestimmung spielen eine zentrale Rolle.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Gesetzeslage der Leihmutterschaft in Deutschland, Kapitel zu den Argumenten für und gegen das Verbot, sowie ein Fazit und Schlussüberlegungen. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Thematik.
Welche Argumente werden für ein Verbot der Leihmutterschaft angeführt?
Die Argumente für ein Verbot konzentrieren sich auf ethische Bedenken, die mögliche Ausbeutung von Leihmüttern, das Kindeswohl und die Sorge vor einem kommerzialisierten Markt für Kinder. Diese Argumente werden im Kontext der deutschen Rechtsordnung kritisch beleuchtet.
Welche Argumente werden gegen ein Verbot der Leihmutterschaft angeführt?
Die Argumente gegen ein Verbot betonen die Perspektiven queerer Paare und ihre eingeschränkten Reproduktionsrechte. Es geht um Selbstbestimmungsrechte, die Gleichstellung mit heterosexuellen Paaren und die ethischen Aspekte der Ablehnung eines reproduktiven Wunsches. Die Leihmutterschaft wird als letzte Möglichkeit der Fortpflanzung für manche Paare hervorgehoben.
Welche Gesetze spielen eine Rolle bei der Thematik der Leihmutterschaft in Deutschland?
Das Embryonenschutzgesetz (ESchG) und das Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) sind die relevanten Gesetze, die die Leihmutterschaft in Deutschland verbieten. Die Arbeit erläutert die Paragraphen und die Begründung des Verbots.
Wie wird die Situation in Israel im Vergleich zu Deutschland dargestellt?
Der Vergleich mit der Gesetzeslage in Israel, wo Leihmutterschaft für homosexuelle Paare erlaubt ist, unterstreicht die Diskrepanz zur deutschen Rechtslage und die Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit dem deutschen Verbot.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Leihmutterschaft, LGBTQIA+, Reproduktionsmedizin, Embryonenschutzgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz, queere Familien, Rechtsvergleich, Selbstbestimmung, Kindeswohl, ethische Aspekte, Ausbeutung.
- Quote paper
- S. Schubert (Author), Queere Reproduktionsmöglichkeiten. Welche Argumente für und gegen das Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland gibt es?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1271517