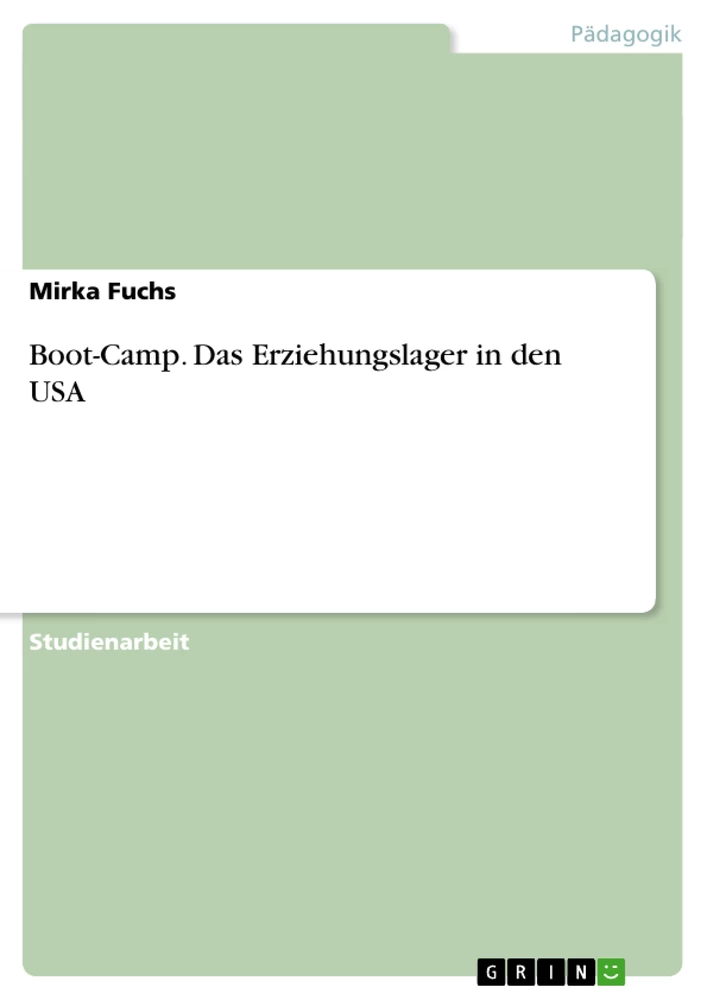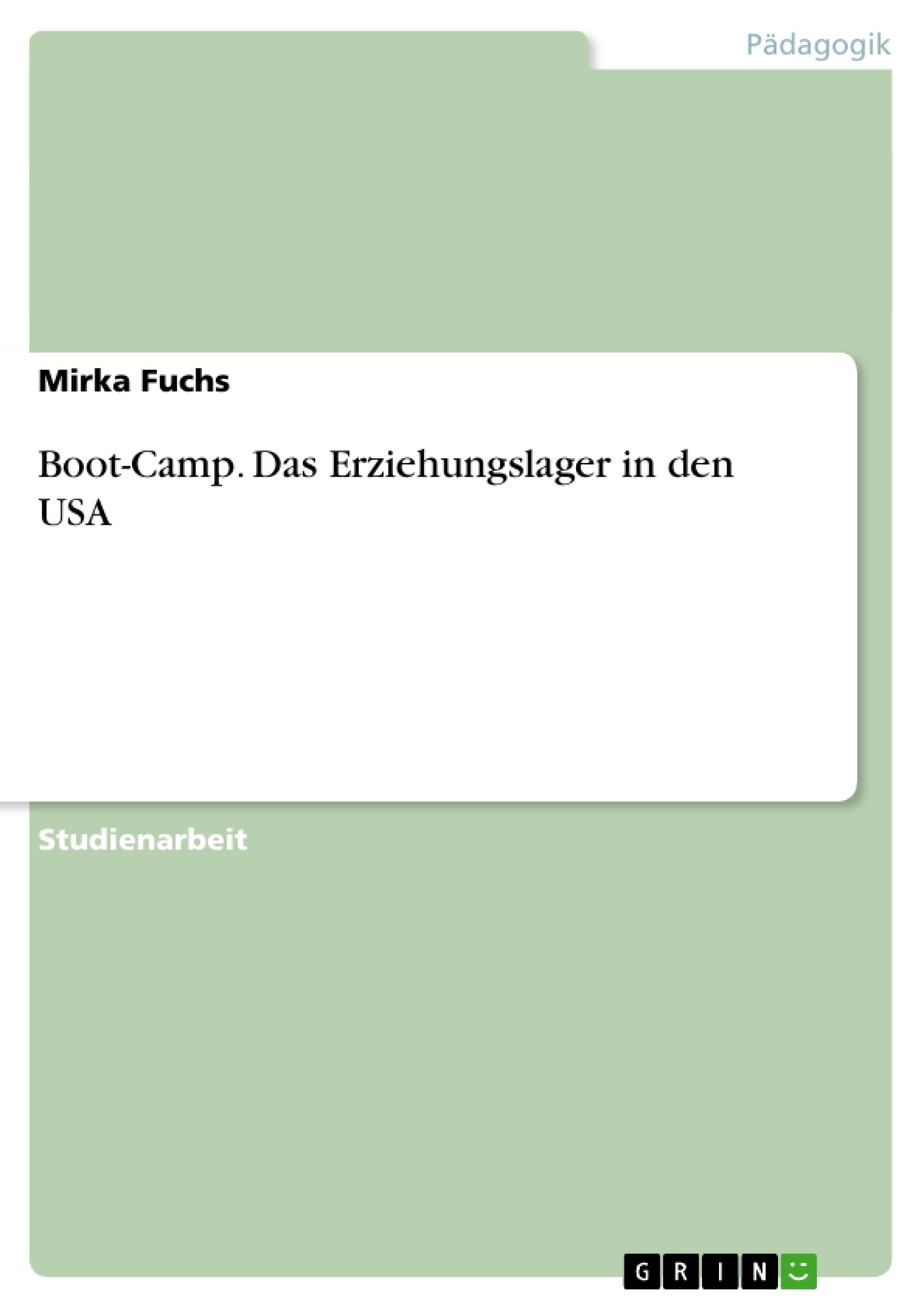„Der Wille wird gebrochen, um ihn danach wieder aufzubauen“. So lautet dass Ziel der Boot-Camp Programme in den USA.
In Deutschland wurde die Gesellschaft durch verschiedene Todesfälle in den Boot-Camps aufmerksam und diskutiert immer noch öffentlich über diesen Ansatz.
Da ich mich vor allem in der Zeit meines Studiums mit dem Thema Straffälligkeit und Rehabilitationsmöglichkeiten beschäftige, habe ich schon viele Ansätze kennen gelernt und mich damit auseinander gesetzt. Ein Ansatz, der in den USA sehr weit verbreitet ist und von der amerikanischen Gesellschaft unterstützt wird, ist das Boot-Camp Programm. Dort stehen vor allem der militärische Drill und harte, körperliche Arbeit im Vordergrund. Auf Grund dieser strengen Struktur wäre ein solcher Ansatz in Deutschland gesetzlich nicht durchführbar und schlägt auch in der Gesellschaft auf harte Kritik.
Was jedoch die genauen Ziele dieser Camps sind, wie sie strukturiert und aufgebaut sind und vor allem zu welchem Ergebnis sie führen, soll in dieser Arbeit untersucht werden.
Die Basisliteratur, die ich während meiner Rescheren verwendet habe, ist das Buch „Boot-Camp-Programme in den USA“ von Norbert Gescher aus dem Jahr 1998. Diese Literatur ist schon 10 Jahre alt, aber beschreibt trotz dessen die Ziele und Strukturen der Programme sehr detailiert.
Zunächst werde ich den Begriff „Boot-Camp“ genauer klären und definieren. Danach soll der historische Entstehungshintergrund der Camps beschrieben werden. Anschließend werde ich im dritten Punkt meiner Gliederung die theoretischen Ansätze der Boot-Camps vorstellen und kurz auf den kriminaltheoretischen Hintergrund in den USA eingehen. Schließlich werde ich genauer auf die Auswahlkriterien der Insassen und die Programmkonzeption eingehen und zuletzt Statistiken zur Rückfallquote und sozialen Veränderungen der Gefangenen vorstellen.
Abschließend werde ich die Ergebnisse zusammenfassen und dabei kritisch hinterfragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition und Beschreibung des Begriffs „Boot Camp“
- Historischer Hintergrund
- Theoretische Ansätze
- Theorie der unterschiedlichen Konditionierbarkeit
- Yochelsons und Samenows Persönlichkeitstheorie
- Kontrolltheorie von Hirschi
- Kriminaltheoretischer Hintergrund
- Strafrechtsystem
- Strafrechtpolitik
- Auswahl der Insassen
- Vorverurteilungen
- Aktuelle Straftat
- Alter
- Belastbarkeit
- Freiwilligkeit
- Programmkonzeption
- Struktur
- Tagesablauf
- Militärische Grundstruktur
- Ziele der Programme
- Systemebene
- Personelle Ebene
- Rückfallwahrscheinlichkeit und Bewertung
- Veränderte Einstellung der Boot-Camp Insassen
- Fazit
- Abbildungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Boot-Camp-Programme in den USA. Ziel ist es, die Entstehung, Struktur, Ziele und Auswirkungen dieser Programme zu untersuchen. Dabei werden sowohl die historischen Wurzeln als auch die theoretischen Grundlagen beleuchtet. Die Arbeit analysiert die Auswahlkriterien der Insassen, die Programmkonzeption und die Bewertung der Programme hinsichtlich ihrer Wirksamkeit.
- Historische Entwicklung der Boot-Camp-Programme
- Theoretische Ansätze zur Erklärung der Wirksamkeit von Boot-Camps
- Struktur und Organisation von Boot-Camp-Programmen
- Ziele und Auswirkungen der Programme auf die Insassen
- Kritische Bewertung der Boot-Camp-Programme
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Boot-Camp-Programme ein und erläutert die Relevanz des Themas. Sie stellt die Forschungsfrage und die Gliederung der Arbeit vor.
Das zweite Kapitel definiert den Begriff „Boot Camp“ und beschreibt die verschiedenen Programme, die unter diesem Begriff zusammengefasst werden. Es werden die Merkmale von Boot-Camps herausgearbeitet und die unterschiedlichen Auffassungen in der Literatur beleuchtet.
Das dritte Kapitel beleuchtet den historischen Hintergrund der Boot-Camp-Programme. Es werden verschiedene historische Programme vorgestellt, die als Vorläufer der heutigen Boot-Camps betrachtet werden können. Dazu gehören das Elmira Reformatory, die „Outward Bound-Schulen“ und die „Challenge-Programme“.
Das vierte Kapitel stellt verschiedene theoretische Ansätze vor, die die Wirksamkeit von Boot-Camp-Programmen erklären sollen. Dazu gehören die Theorie der unterschiedlichen Konditionierbarkeit, Yochelsons und Samenows Persönlichkeitstheorie sowie die Kontrolltheorie von Hirschi.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit dem kriminaltheoretischen Hintergrund der Boot-Camp-Programme. Es werden das Strafrechtsystem und die Strafrechtpolitik in den USA beleuchtet.
Das sechste Kapitel analysiert die Auswahlkriterien der Insassen für Boot-Camp-Programme. Es werden die Kriterien wie Vorverurteilungen, aktuelle Straftat, Alter, Belastbarkeit und Freiwilligkeit betrachtet.
Das siebte Kapitel beschreibt die Programmkonzeption von Boot-Camps. Es werden die Struktur, der Tagesablauf und die militärische Grundstruktur der Programme erläutert.
Das achte Kapitel befasst sich mit den Zielen der Boot-Camp-Programme. Es werden die Ziele auf Systemebene und auf personeller Ebene betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Boot-Camp-Programme, Jugendkriminalität, Rehabilitation, Strafvollzug, militärischer Drill, körperliche Arbeit, USA, Strafrecht, Strafrechtpolitik, Rückfallwahrscheinlichkeit, soziale Veränderungen.
- Quote paper
- Mirka Fuchs (Author), 2009, Boot-Camp. Das Erziehungslager in den USA, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127147