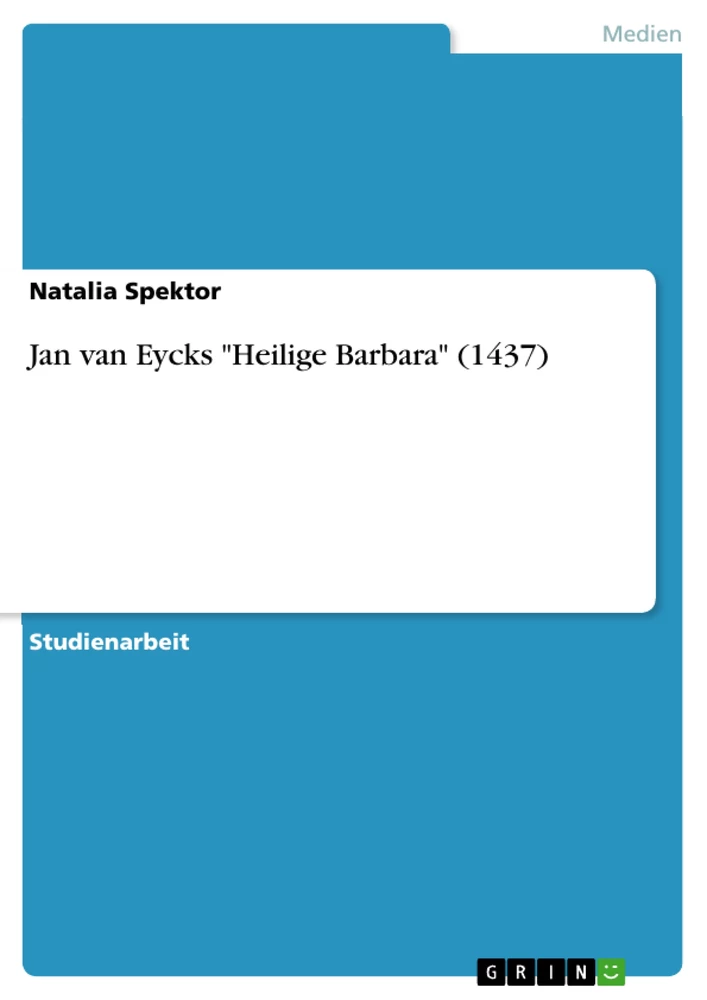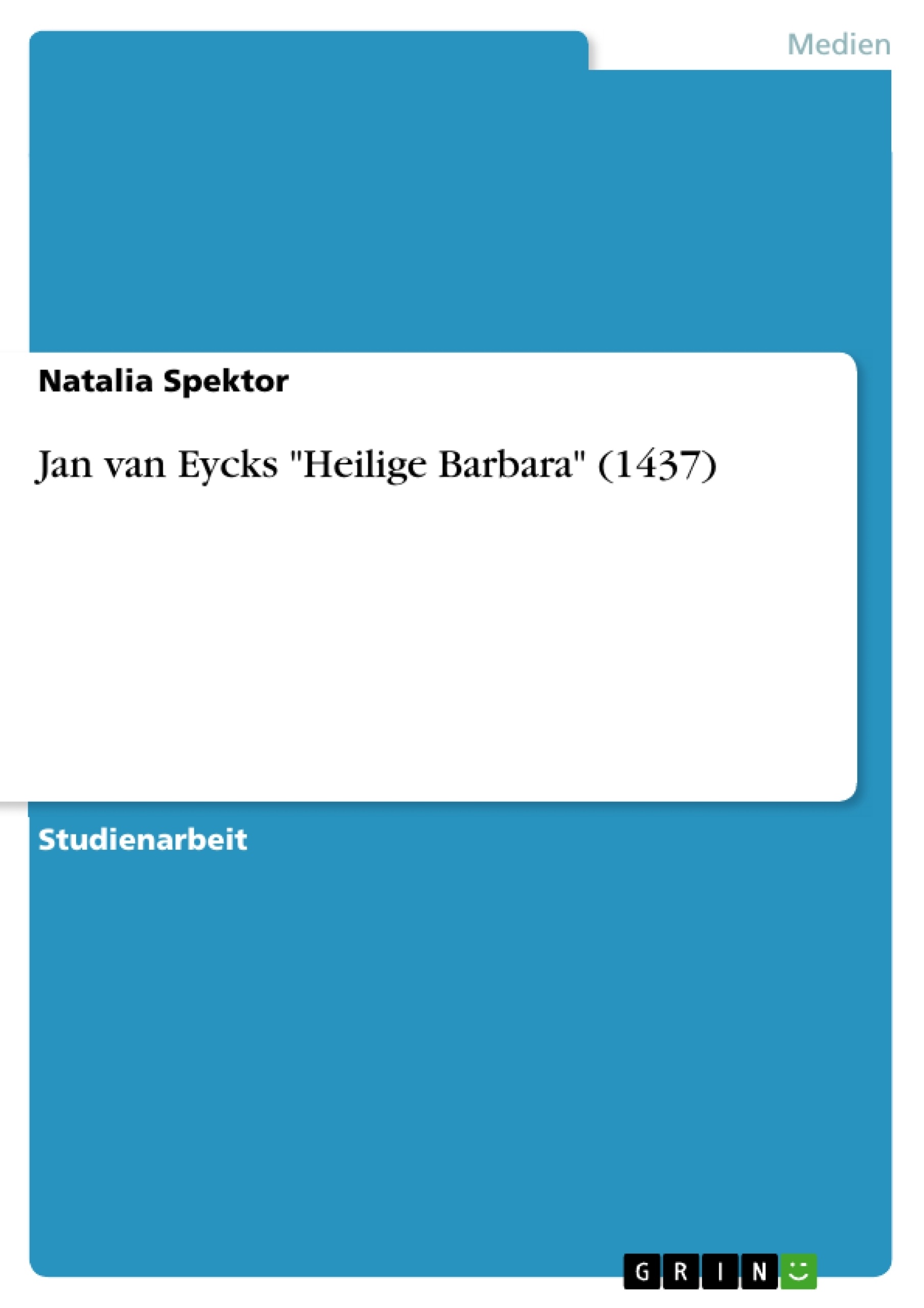Die neuen Entdeckungen und Errungenschaften der niederländischen Meister zu Beginn des 15. Jahrhunderts machten fast überall in Europa einen tiefen Eindruck. Künstler wie Auftraggeber waren von der Idee hingerissen, dass sich die Kunst nicht nur dazu verwenden ließ, die heiligen Geschichten packend nachzuerzählen, sondern dass man damit auch ein Stück Welt spiegeln konnte. Die erste Folge dieser gewaltigen Umwälzung war, wie man am Beispiel Jan van Eycks Heiligen Barbara sehen kann, dass Künstler allerorts zu experimentieren und nach neuen überraschenden Wirkungen zu suchen begannen. Diese Abenteuerlust, dieser kühne Geist der Neuerung, von dem die Kunst im 15. Jahrhundert ergriffen wurde, markiert den eigentlichen Bruch mit dem Mittelalter .
Die neue Impulse fanden auch ihren Einfluss auf die Kunst Jan van Eycks. Aus den Werken Jan van Eycks spricht eine damals neue Weltanschauung, die diesseitigen Erscheinungen einen Sinn zuordnete und die Schilderung der neuen Welt in die Bilder einbezog. Er wird als Neuerer der sogenannten altniederländischen Tafelmalerei und ihres spezifischen Realismus angesehen. Jan van Eycks Heilige Barbara könnte man auch als Experiment verstehen. Der neue Van Eyck ist hier der Erzähler, der auf der Suche nach eigenen Sprachformen für das Medium Tafelbild ist. Sein konsequenter Naturalismus markiert ein qualitativ neues, seit der Gotik entstehendes Wirklichkeitsverhältnis faszinierender Erscheinungstreue. Sie äußert sich in der Exaktheit der Darstellung, in der Schilderung einer Landschaft, die bis in den fernsten Hintergrund in allen Einzelheiten erfasst ist.
Angesichts der bereits zum Rang einer Wissenschaft aufgestiegenen Architektur lag es für Van Eyck nahe, im Interesse einer Aufwertung des Mediums, mit dem er selbst arbeitete, nun seinerseits die Architekturzeichnung zur Formulierung eigener Ansprüche zu verwenden. Er weist darauf hin, dass auch in der Malerei die Zeichnung im Sinne der durchrationalisierten Grundidee die Grundlage eines Bildes ist, mit der der Maler sich als Inventor ausweist. Nicht vorrangig das Potential des Handwerkes, nicht die Farben und die atmosphärischen Wirkungen der lasierenden Ölmalerei sind es, die bestechen, sondern die Bildfindung, die bereits in der Zeichnung angelegt ist. Der Architekt muss in seiner Zeichnung Detailtreue und klaren räumlichen Verhältnissen Rechnung tragen – und genau so verfährt Van Eyck mit seiner Kunst.
Inhaltsverzeichnis
- Der Geist der Neuerung in der Kunst Jan van Eycks
- Van Eycks Heilige Barbara und die Darstellung der himmlischen Ecclesia
- Der gotische Turm
- Die gotische Kathedrale – ein fiktives oder bestehendes Kirchengebäude?
- Heilige Barbara als programmatisches Bild
- Das Werk Jan van Eycks und seine Bedeutung für uns heute
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Gemälde „Heilige Barbara“ von Jan van Eyck, das um 1437 entstand. Ziel ist es, die Bedeutung des Werkes im Kontext der Kunstentwicklung des 15. Jahrhunderts zu analysieren und die künstlerischen Intentionen des Malers zu erforschen. Dabei werden die Darstellung der Heiligen Barbara, die Symbolik des Turms und die Bedeutung der Landschaft im Bild untersucht.
- Die Bedeutung des Werkes im Kontext der Kunstentwicklung des 15. Jahrhunderts
- Die künstlerischen Intentionen Jan van Eycks
- Die Darstellung der Heiligen Barbara
- Die Symbolik des Turms
- Die Bedeutung der Landschaft im Bild
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den Einfluss der Renaissance auf die Kunst Jan van Eycks und stellt die Besonderheiten seiner Maltechnik heraus. Das zweite Kapitel analysiert die Darstellung der Heiligen Barbara im Kontext der mittelalterlichen Ikonographie und untersucht die Symbolik des Turms als Attribut der Heiligen. Das dritte Kapitel widmet sich der Interpretation des Bildes als programmatisches Werk, das die Kunstauffassung Jan van Eycks widerspiegelt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Jan van Eyck, Heilige Barbara, Grisaille, gotischer Turm, Symbolik, Kunstentwicklung, Renaissance, mittelalterliche Ikonographie, programmatisches Bild, Kunstauffassung.
- Quote paper
- Natalia Spektor (Author), 2008, Jan van Eycks "Heilige Barbara" (1437), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127084