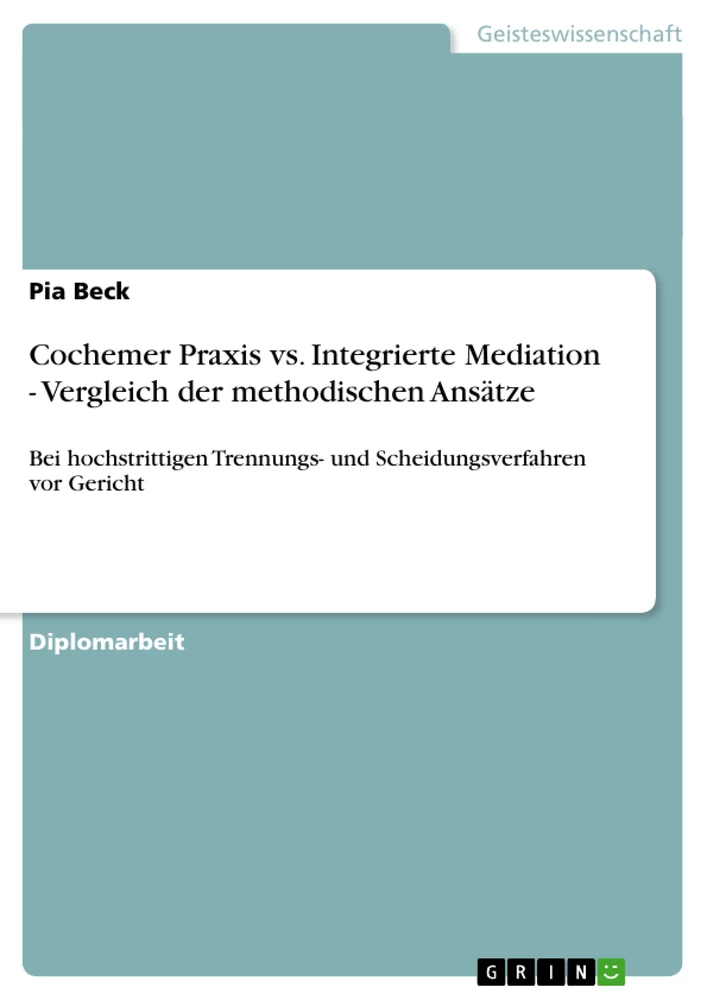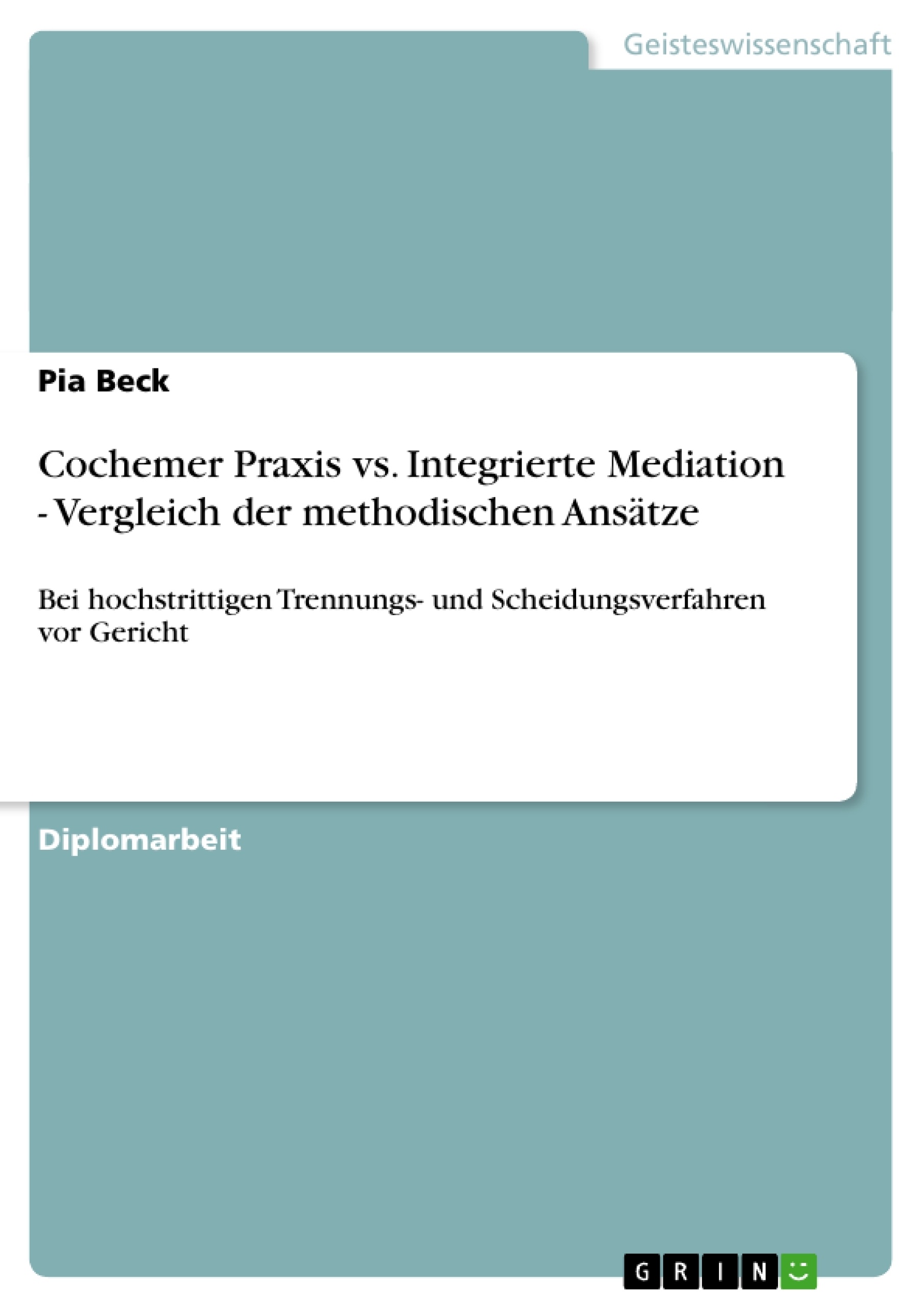Diese Arbeit stellt die beiden genannten Methoden vor. Psychodynamische Prozesse werden in die Betrachtung mit eingeflochten und die Möglichkeiten aufgezeigt, diese zu minimieren bis gänzlich auszuschließen.
Die Cochemer Praxis, wie die Integrierte Mediation wird inhaltlich auf ihre Wirkung überprüft, warum sie in ihren Ursprungsgebieten Cochem, bzw. Altenkirchen den Eltern helfen eine autonome Elternschaft nach der Trennung / Scheidung für ihre Kinder wieder herstellen können, und warum es anderen Orts nur schwerlich oder nicht funktioniert.
Die Beantwortung der Frage erarbeitet sich über die Hypothese: Der Erfolg eines Modelles entscheidet sich in der Umsetzung.
Die Systematik des Vergleiches hinterfragt theoretische und konzeptionelle Hintergründe, den methodischen Ansatz mit den Überlegungen der Aufgaben und Rollen der Professionen, den Umgang mit den Eltern und Kindern, ebenso psychologisch wichtige Aspekte, der Stellenwert der Vernetzung wird abgefragt und ob es eine Hauptanlaufstelle für die Eltern gibt. Die Kostenfaktoren für die Betroffenen wird in die Betrachtung mit einbezogen, da viele Professionen in einem Verfahren aktiviert werden können. Die formale, bzw. informelle Kooperation der in einem Fall beteiligten Professionen untereinander und als wichtiger Schnittpunkt stellt sich die Frage nach verschiedenen Normen des KJHG, FGG und BGB und ihre Bedeutung für die Professionen.
Die Fakten und Zahlen, ob die Cochemer Praxis sich gänzlich von der Integrierten Mediation unterscheidet, wie die Erfolge und Misserfolge aussehen und abschließend eine Prognose der beiden Vorgehensweisen für Rheinland-Pfalz und die Bundesrepublik runden die Systematik des Vergleiches ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- PAS Parental Alienation Syndrome
- Mediation - eine Übersicht
- Bedeutung und Anwendungsbereiche Mediation heute
- Die Situation in Rheinland-Pfalz - LKTS
- Tradition ohne Einheitlichkeit
- Mediation im Kontext Cochemer Praxis
- Mediation im Kontext Integrierte Mediation
- Vergleichende Darstellungen verschiedener Ansätze - Hypothese: Der Erfolg eines Modelles entscheidet sich in der Umsetzung
- Systematik des Vergleichs
- Theoretischer Hintergrund – konzeptionelle Hintergründe
- Methodische Ansätze
- Formale und informelle Kooperation
- Stellenwert Vernetzung
- Kostenfaktoren für die Betroffenen
- Kostenfaktoren für die Professionen
- Cochemer Praxis - Fakten + Zahlen
- Integrierte Mediation - Fakten + Zahlen
- Gänzlich verschieden oder doch Gemeinsamkeiten?
- Erfolge / Misserfolge
- Systematik des Vergleichs
- Folgerung / Konsequenzen
- Diskussion - Der Erfolg eines Modells entscheidet sich in der Umsetzung
- Kann man beide Methoden kombinieren?
- Abschließende Bewertung
- Literatur
- Anhang: Interviews mit den Akteuren „Cochemer Praxis“, „integrierte Mediation" und Vertreter des LSJV - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung - Landesjugendamt,
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Vergleich der methodischen Ansätze der Cochemer Praxis und der Integrierten Mediation im Kontext von hochstrittigen Trennungs- und Scheidungsverfahren vor Gericht. Die Arbeit analysiert die beiden Modelle hinsichtlich ihrer theoretischen Grundlagen, ihrer methodischen Vorgehensweisen und ihrer praktischen Umsetzung. Ziel ist es, die Stärken und Schwächen beider Modelle aufzuzeigen und zu bewerten, ob eine Methode besser geeignet ist als die andere, um hochstrittige Elternkonflikte zu lösen.
- Analyse der theoretischen Grundlagen der Cochemer Praxis und der Integrierten Mediation
- Vergleich der methodischen Ansätze beider Modelle
- Bewertung der praktischen Umsetzung der Cochemer Praxis und der Integrierten Mediation
- Analyse der Erfolgsfaktoren und Herausforderungen beider Modelle
- Diskussion der Kombinierbarkeit der beiden Methoden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der hochstrittigen Trennungs- und Scheidungsverfahren ein und erläutert die Bedeutung des Parental Alienation Syndrome (PAS) in diesem Kontext. Sie beschreibt die Entstehung der Diplomarbeit und die Motivation der Autorin, sich mit den beiden Modellen Cochemer Praxis und Integrierte Mediation auseinanderzusetzen.
Das zweite Kapitel bietet eine umfassende Übersicht über die Mediation als Konfliktlösungsprozess. Es beleuchtet die Bedeutung und die Anwendungsbereiche der Mediation in der heutigen Zeit, insbesondere im Kontext von Trennungs- und Scheidungsverfahren. Weiterhin wird die Situation der Mediation in Rheinland-Pfalz, die Tradition der Mediation und die Einbindung der Mediation in die Cochemer Praxis und die Integrierte Mediation dargestellt.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Vergleich der Cochemer Praxis und der Integrierten Mediation. Es analysiert die beiden Modelle hinsichtlich ihrer theoretischen Grundlagen, ihrer methodischen Ansätze, ihrer formalen und informellen Kooperation, des Stellenwerts der Vernetzung und der Kostenfaktoren für die Betroffenen und die Professionen. Die Kapitel beinhalten auch eine Darstellung der Fakten und Zahlen der Cochemer Praxis und der Integrierten Mediation.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den Folgerungen und Konsequenzen des Vergleichs der beiden Modelle. Es diskutiert den Erfolg der beiden Modelle in der Praxis, die Kombinierbarkeit der beiden Methoden und bietet eine abschließende Bewertung der Cochemer Praxis und der Integrierten Mediation.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Cochemer Praxis, die Integrierte Mediation, hochstrittige Trennungs- und Scheidungsverfahren, Parental Alienation Syndrome (PAS), Mediation, Konfliktlösung, Familienrecht, Jugendhilfe, Vernetzung, Kostenfaktoren, Erfolgsfaktoren und Herausforderungen.
- Citation du texte
- Pia Beck (Auteur), 2009, Cochemer Praxis vs. Integrierte Mediation - Vergleich der methodischen Ansätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127083