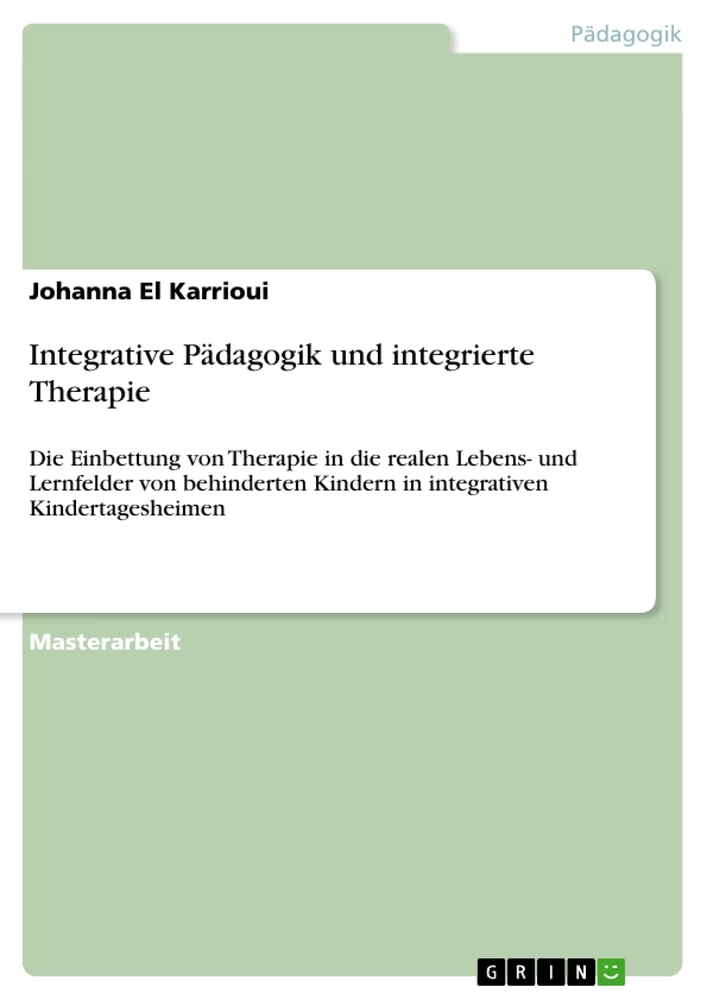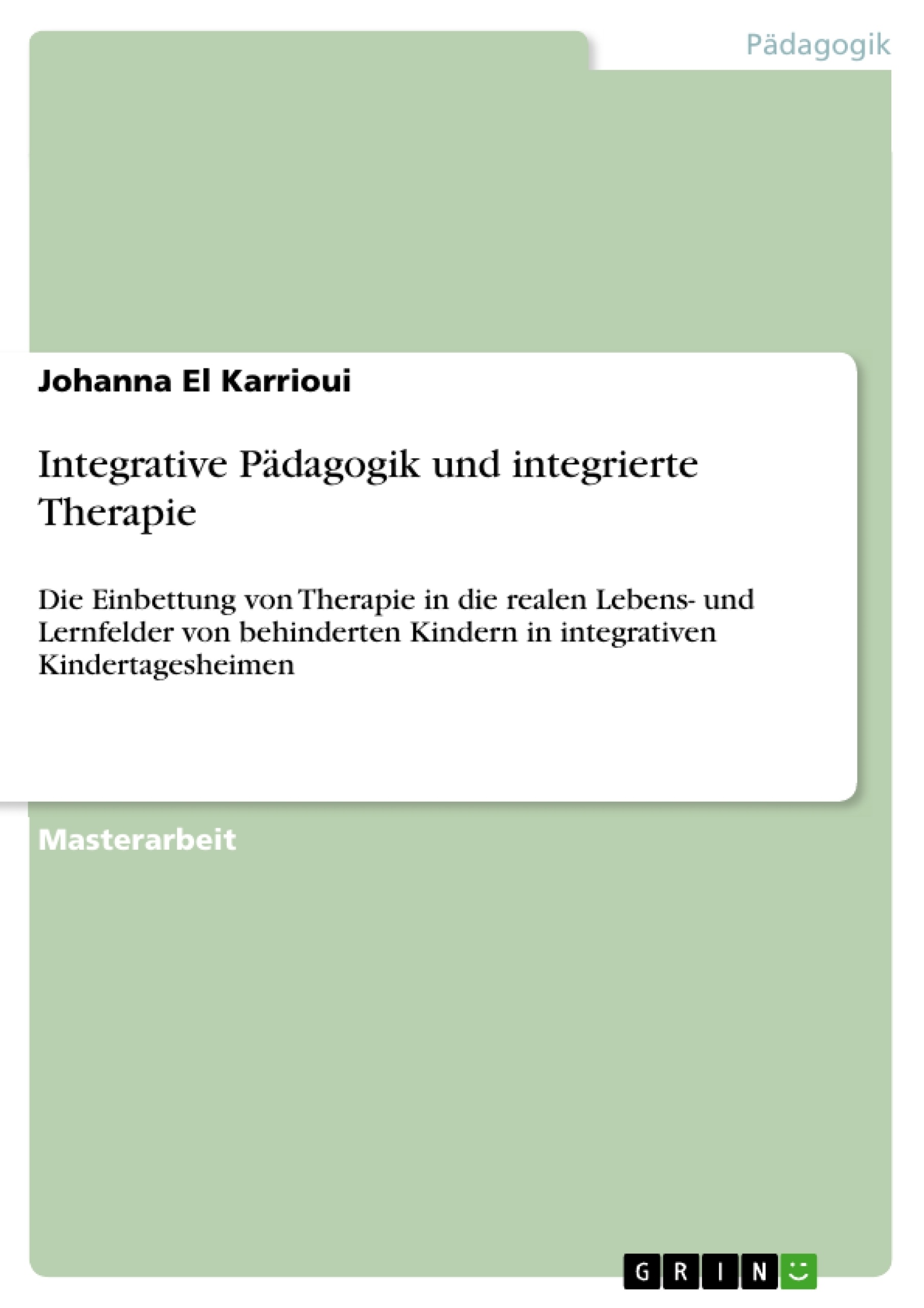Einleitend werden zunächst die für diese Masterarbeit wichtigen Begriffe erläutert. Es folgt die Vorstellung der theoretischen Grundlagen von Integration. Diese beruhen stark auf Feusers Allgemeiner Entwicklungslogischen Didaktik. Auch die Bedeutung von Sprache und Dialog, wie die Kulturhistorische Schule sie vertritt, wird erläutert. Ebenso werden das System sich selbst organisierender Prozesse des Menschen sowie das innere Abbild der äußeren Welt und die vorgreifende Widerspiegelung nach Anochin vorgestellt.
Der nächste Teil widmet sich dem Thema der integrativen Kindertagesheime. Es werden verschiedene, in Deutschland praktizierte Formen vom gemeinsamen Leben, Spielen und Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung in Kindergärten dargelegt. Auch die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, die gegeben sein müssen, damit sich ein Kindergarten für Kinder mit Behinderung öffnen kann, werden beleuchtet. Abschließend wird aufgrund der Erfahrungen, die bisher gemacht wurden, ein weitgehend positives Fazit über integrative Erziehung im Kindergarten gezogen.
Den zweiten Schwerpunkt dieser Masterarbeit bildet der Bereich der Therapie. Es werden zum einen die Behandlung, die stark auf die Defizite des einzelnen Menschen fixiert ist und seinen Möglichkeiten und Ressourcen kaum Beachtung schenkt, zum anderen eine Therapie, bei der der Menschen als Ganzes gesehen wird und bei seinen individuellen Potentialen ansetzt, vorgestellt. Als besondere Form der ganzheitlichen Therapie wird die integrierte Therapie dargestellt, bei der die therapeutischen Übungen sowohl räumlich als auch inhaltlich in den Alltag der Person eingebaut werden.
Als Beispiel für eine Therapieform wird im Anschluss die Konduktive Förderung nach Petö vorgestellt, die Menschen mit cerebraler Lähmung behandelt. Im nächsten Schritt wird untersucht, inwieweit die Konduktive Förderung Merkmale der integrierten Therapie enthält. Als Fazit aus diesem Abschnitt wird aufgezeigt, was verändert werden könnte, damit die Konduktive Förderung als integrierte Therapie verstanden werden kann, ohne die Behandlungsform ihrer signifikanten Merkmale zu berauben.
Als Abschluss dieser Arbeit wird konkret aufgezeigt, was eine Umstellung der Therapieform, weg von einer besondernden Therapie im Therapieraum hin zu einer Therapie, die den ganzen Mensch beachtet, für die Einrichtungen, aber auch für die Therapeutinnen bedeutet und welche Veränderungen dies bringen würde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserläuterungen
- Integration
- Pädagogik
- Therapie
- Reale Lebens- und Lernfelder
- Behinderung
- (Integrative) Kindertagesheime
- Integrative Pädagogik
- Das bisherige Erziehungssystem und eine Alternative
- Die geistige Entwicklung des Menschen und die Bedeutung von Bewegung und Sprache für das Denken
- Grundzüge der Allgemeinen Entwicklungslogischen Didaktik nach Feuser
- Stützpädagogik und Kompetenztransfer
- Zusammenfassung
- Integrative Erziehung im Kindergarten
- Formen der Integration
- Integrative Erziehung durch räumlich integrierte Einrichtungen
- Die integrative Gruppe
- Einzelintegration im Regelkindergarten
- Voraussetzungen für Integration
- Wohnortorientierung
- Erziehung ohne Aussonderung
- Kooperation innerhalb des Teams
- Fortbildung der Mitarbeiterinnen
- Wissenschaftliche Begleitung
- Rahmenbedingungen für Integration
- Verkleinerte Gruppe
- Zusammensetzung der Gruppe
- Personalsituation
- Räumlichkeiten und Ausstattung
- Arbeit in Projekten
- Elternarbeit
- Dauer der Betreuung
- Die Finanzierung integrativer Kindergärten
- Bisherige Erfahrung mit Integration im Kindergarten
- Subjektive Bewertung durch Eltern oder Angehörige
- Objektive Bewertung durch wissenschaftliche Begleitforschung
- Behinderte Kinder
- Regelkinder
- Die Gefahr abgebrochener Integration
- Zusammenfassung
- Formen der Integration
- Therapie
- Begriffserläuterung
- Defektorientierte Therapie
- Ganzheitlich orientierte Therapie
- Der Zusammenhang von Therapie und Pädagogik
- Die Aufgabe der Pädagogik
- Der Auftrag an die Therapie
- Berührungspunkte von Pädagogik und Therapie
- Zusammenfassung
- Integrierte Therapie
- Definition
- Das Besondere der integrierten Therapie
- Kooperation von Pädagoginnen und Therapeutinnen
- Die Finanzierung von (integrierter) Therapie im integrativen Kindergarten
- Zusammenfassung: Vorteile der integrierten Therapie
- Die Konduktive Förderung nach Petö
- Definition
- Theoretische Grundlage der Konduktiven Förderung
- Die Zielgruppe
- Die Aufgaben der Konduktorin
- Die Rahmenbedingungen der Konduktiven Förderung
- Die Durchführung der therapeutischen Übungen
- Kritische Beurteilung
- Problematische Umsetzung in Deutschland
- Zusammenfassung
- Untersuchung der Konduktiven Förderung auf Kompatibilität mit integrierter Therapie
- Die Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten
- Die Unterschiede und Widersprüche
- Ein erträumter Petö-Kindergarten mit integrierter Therapie
- Fazit
- Herausforderung an integrative Kindergärten durch integrierte Therapie
- Veränderungen in der Arbeit der Therapeutinnen
- Abschließende Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Integration von Therapie in die Lebens- und Lernfelder behinderter Kinder in integrativen Kindertagesstätten. Ziel ist es, die Möglichkeiten und Herausforderungen einer integrierten Therapie im Kontext integrativer Pädagogik zu beleuchten und die Kompatibilität verschiedener Therapieansätze, beispielsweise der Konduktiven Förderung nach Petö, mit diesem Modell zu analysieren.
- Integration von Therapie in integrative Kindertagesstätten
- Kompatibilität verschiedener Therapieansätze mit integrativer Pädagogik
- Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für erfolgreiche Integration
- Kooperation zwischen Pädagogen und Therapeuten
- Finanzierung integrativer Maßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Masterarbeit ein und beschreibt den Forschungsansatz und die Relevanz der Thematik. Sie skizziert die zentrale Fragestellung nach der optimalen Integration von Therapie in integrative Kindertagesstätten. Die Einleitung stellt den roten Faden der Arbeit dar und leitet die folgenden Kapitel ein, indem sie die methodischen und theoretischen Grundlagen vorstellt.
Begriffserläuterungen: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Integration, Pädagogik, Therapie, Behinderung und integrative Kindertagesstätten. Es schafft eine gemeinsame Basis für das Verständnis der folgenden Kapitel und klärt potentielle Missverständnisse über die Verwendung der Fachbegriffe im Kontext der Arbeit.
Integrative Pädagogik: Dieses Kapitel beleuchtet die Prinzipien der integrativen Pädagogik, beschreibt das bisherige Erziehungssystem und setzt es in Relation zu integrativen Alternativen. Es werden die Bedeutung von Bewegung und Sprache für die geistige Entwicklung, die Grundzüge der Allgemeinen Entwicklungslogischen Didaktik nach Feuser, sowie der Ansatz der Stützpädagogik und des Kompetenztransfers ausführlich erläutert. Das Kapitel bildet die theoretische Grundlage für die spätere Diskussion der Integration von Therapie.
Integrative Erziehung im Kindergarten: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Formen der Integration im Kindergarten, den notwendigen Voraussetzungen wie Wohnortnähe, Kooperation im Team und Fortbildung, und den relevanten Rahmenbedingungen. Die Kapitel befasst sich ausführlich mit der Finanzierung und den Erfahrungen mit Integration im Kindergarten, sowohl aus subjektiver (Eltern) als auch aus objektiver (wissenschaftliche Begleitforschung) Perspektive.
Therapie: Das Kapitel beschreibt verschiedene Therapieansätze, differenziert zwischen defekt- und ganzheitlich orientierten Therapien und analysiert den Zusammenhang zwischen Therapie und Pädagogik. Es legt die theoretischen Grundlagen für die Diskussion der integrierten Therapie in den folgenden Kapiteln.
Integrierte Therapie: Dieses Kapitel definiert den Begriff der integrierten Therapie und beschreibt ihre Besonderheiten. Es untersucht die wichtige Kooperation zwischen Pädagoginnen und Therapeutinnen und die damit verbundenen Herausforderungen, sowie die Finanzierung der integrierten Therapie im integrativen Kindergarten. Der Fokus liegt auf den Vorteilen dieses Ansatzes.
Die Konduktive Förderung nach Petö: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Konduktive Förderung nach Petö, einschließlich ihrer theoretischen Grundlagen, Zielgruppe, Aufgaben der Konduktorin, Rahmenbedingungen und Durchführung der therapeutischen Übungen. Es beinhaltet auch eine kritische Beurteilung und die Herausforderungen bei der Umsetzung in Deutschland.
Untersuchung der Konduktiven Förderung auf Kompatibilität mit integrierter Therapie: Dieses Kapitel analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Konduktiven Förderung und der integrierten Therapie und diskutiert die Möglichkeiten ihrer Kombination in einem idealisierten Modell.
Schlüsselwörter
Integrative Pädagogik, integrierte Therapie, inklusive Bildung, Behinderung, Kindertagesstätte, Konduktive Förderung nach Petö, Kooperation, Rahmenbedingungen, Finanzierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Integration von Therapie in integrative Kindertagesstätten
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Integration von Therapie in die Lebens- und Lernfelder behinderter Kinder in integrativen Kindertagesstätten. Sie beleuchtet die Möglichkeiten und Herausforderungen einer integrierten Therapie im Kontext integrativer Pädagogik und analysiert die Kompatibilität verschiedener Therapieansätze, wie beispielsweise der Konduktiven Förderung nach Petö, mit diesem Modell.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Integration von Therapie in integrative Kindertagesstätten, die Kompatibilität verschiedener Therapieansätze mit integrativer Pädagogik, die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration, die Kooperation zwischen Pädagogen und Therapeuten und die Finanzierung integrativer Maßnahmen. Es werden verschiedene Therapieformen und die Konduktive Förderung nach Petö im Detail beschrieben und analysiert.
Welche Begriffe werden in der Arbeit definiert?
Die Arbeit definiert zentrale Begriffe wie Integration, Pädagogik, Therapie, Behinderung und integrative Kindertagesstätten. Dies dient der Schaffung einer gemeinsamen Basis für das Verständnis der Thematik und der Vermeidung von Missverständnissen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung und Begriffserklärungen. Es folgen Kapitel zu integrativer Pädagogik, integrativer Erziehung im Kindergarten, Therapie, integrierter Therapie und der Konduktiven Förderung nach Petö. Ein Kapitel widmet sich der Kompatibilität der Konduktiven Förderung mit integrierter Therapie. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und einer abschließenden Diskussion.
Welche Kapitel gibt es und was ist deren Inhalt?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Begriffserklärungen, Integrativer Pädagogik, Integrativer Erziehung im Kindergarten, Therapie, Integrierter Therapie, der Konduktiven Förderung nach Petö, der Untersuchung der Kompatibilität der Konduktiven Förderung mit integrierter Therapie, Fazit und abschließender Diskussion. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Integration von Therapie in integrative Kindertagesstätten.
Was sind die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte der Arbeit?
Die Zielsetzung ist die Untersuchung der Möglichkeiten und Herausforderungen einer integrierten Therapie in integrativen Kindertagesstätten. Die Themenschwerpunkte liegen auf der Integration von Therapie, der Kompatibilität verschiedener Therapieansätze mit integrativer Pädagogik, den Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration, der Kooperation zwischen Pädagogen und Therapeuten und der Finanzierung integrativer Maßnahmen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Integrative Pädagogik, integrierte Therapie, inklusive Bildung, Behinderung, Kindertagesstätte, Konduktive Förderung nach Petö, Kooperation, Rahmenbedingungen und Finanzierung.
Wie wird die Konduktive Förderung nach Petö in der Arbeit behandelt?
Die Konduktive Förderung nach Petö wird detailliert beschrieben, inklusive ihrer theoretischen Grundlagen, Zielgruppe, Aufgaben der Konduktorin, Rahmenbedingungen und Durchführung der therapeutischen Übungen. Es erfolgt eine kritische Beurteilung und die Herausforderungen bei der Umsetzung in Deutschland werden beleuchtet. Ihre Kompatibilität mit integrierter Therapie wird im Detail analysiert.
Welche Herausforderungen werden in der Arbeit angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Herausforderungen der Integration von Therapie in integrative Kindergärten, die Veränderungen in der Arbeit der Therapeuten und die Kompatibilität verschiedener Therapieansätze mit integrativer Pädagogik. Finanzierungsfragen und die Kooperation zwischen Pädagogen und Therapeuten werden ebenfalls als Herausforderungen betrachtet.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung jedes Kapitels, die den Inhalt und die Kernaussagen prägnant beschreibt.
- Quote paper
- Johanna El Karrioui (Author), 2008, Integrative Pädagogik und integrierte Therapie , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127067