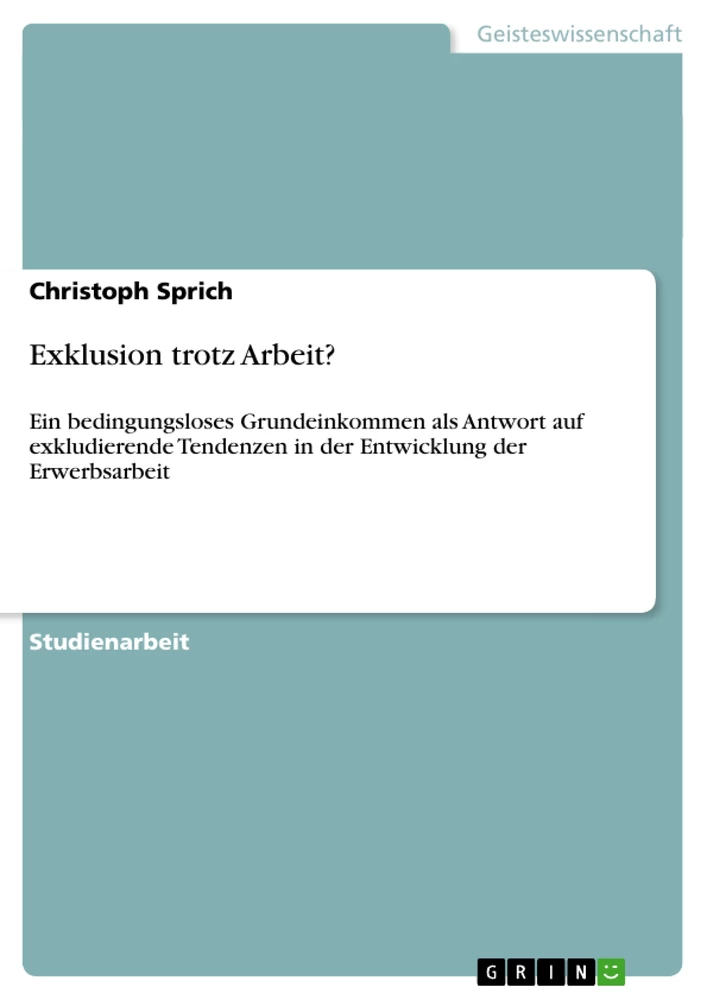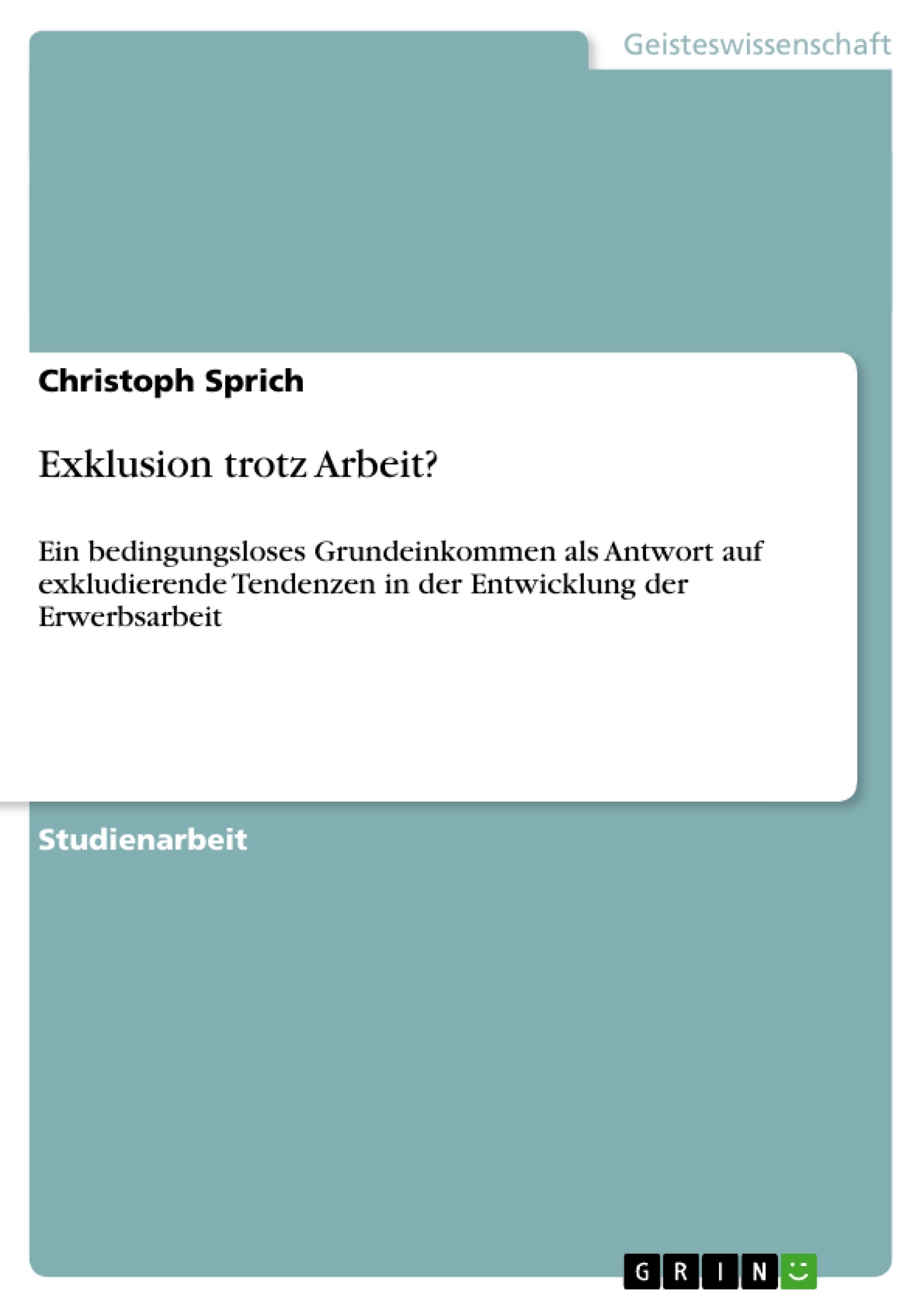Was bedeutet Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse und damit der Erwerbsbiographien, die Vermehrung von Teilzeitarbeit für die Möglichkeiten zur Teilhabe an der Gesellschaft? Um dies zu erfassen, bietet sich das Konzept sozialer Exklusion an, wie es Christoph Deutschmann in Abgrenzung sowohl zu klassischen Armutsforschungsansätzen, als auch zu Luhmanns Systemtheoretischem Ansatz entwickelt hat. Die Konstruktion von Inklusion / Exklusion über Geld als „Schlüsselmedium“ bietet die Möglichkeit, Teilhabechancen jenseits eines rein materiell definierten Armutsbegriffs zu verstehen.
Auf dieser Grundlage soll in der vorliegenden Arbeit folgende These belegt werden: Durch säkulare Entwicklungen der Arbeit verliert diese mehr und mehr ihren gesellschaftlich inkludierenden Charakter. Das Grundeinkommen kann eine Lösung dieses Problems liefern, indem es den Verlust des Inklusionspotentials ausgleicht. Um diese Argumentation zu belegen, werden in einem ersten Schritt die säkularen Tendenzen der Arbeitsgesellschaft dargelegt, in einem zweiten Schritt anhand des Inklusions- / Exklusionskonzeptes von Deutschmann auf ihre Auswirkungen auf die inkludierende Funktion von Lohnarbeit hin untersucht. In einem dritten Schritt schließlich sollen die Grundlinien der verschiedenen Grundeinkommenskonzepte im Sinne der These auf ihr Inklusionspotential überprüft werden. Dabei wird am Beispiel der Forderungen von André Gorz zu sehen sein, ob und auf welche Weise ein solches Grundein-kommen den Verlust der inkludierenden Funktion von Erwerbsarbeit kompensieren könnte.
Dabei soll in Abschnitt 1 das empirische Bild der Lage der Arbeit nur skizziert werden, da die potentiellen Bruchlinien zwischen Theorie und Empirie den Rahmen dieser Arbeit schnell sprengen könnten. Diese Skizze soll vielmehr die Relevanz der theoretischen Überlegungen in Abschnitt 2, insbesondere 2.2, verdeutlichen. Dabei ist es nicht entscheidend, eine möglichst schlüssige Verbindung zwischen den – nicht oder nur kursorisch behandelten - Armutsdefinitionen, die bei der Messung im empirischen Bereich verwandt werden, und dem Exklusionskonzept von Deutschmann zu finden. Vielmehr zeigen diese Erkenntnisse auf, welches exkludierende Potential in den beschriebenen Entwicklungen der Erwerbsarbeit liegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Säkulare Entwicklungen der Erwerbstätigkeit
- Das Normalarbeitsverhältnis
- Die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses und die Folgen
- Arbeit verliert ihre existenzsichernde Funktion: Die „Working Poor“
- Inklusion, Exklusion und Armut
- Geld als Schlüsselmedium der Inklusion
- Verliert die Arbeit ihre inkludierende Funktion?
- Grundeinkommen – garantiert, bedingungslos?
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die säkularen Entwicklungen der Erwerbstätigkeit in Deutschland und deren Auswirkungen auf die gesellschaftliche Inklusion. Sie argumentiert, dass die Arbeit durch Flexibilisierung und Prekarisierung zunehmend ihre inkludierende Funktion verliert und ein bedingungsloses Grundeinkommen als Lösung für diese Entwicklungen dienen kann.
- Erosion des Normalarbeitsverhältnisses und die Folgen für die Erwerbsbiographien
- Zunehmende Arbeitslosigkeit und die Entstehung der „Working Poor“
- Das Konzept der sozialen Exklusion und die Rolle von Geld als Schlüsselmedium der Inklusion
- Das Inklusionspotential des bedingungslosen Grundeinkommens
- Die Relevanz des Grundeinkommens für die Bewältigung der Herausforderungen der Arbeitsgesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die These der Arbeit vor: Durch säkulare Entwicklungen der Arbeit verliert diese mehr und mehr ihren gesellschaftlich inkludierenden Charakter. Das Grundeinkommen kann eine Lösung dieses Problems liefern, indem es den Verlust des Inklusionspotentials ausgleicht.
Das erste Kapitel beleuchtet die säkularen Entwicklungen der Erwerbstätigkeit in Deutschland. Es beschreibt das Normalarbeitsverhältnis als historisch gewachsenes Modell und analysiert die Erosion dieses Modells durch die Zunahme von Teilzeitbeschäftigung, Zeitarbeit und prekären Arbeitsverhältnissen.
Das zweite Kapitel untersucht die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die gesellschaftliche Inklusion. Es greift das Konzept der sozialen Exklusion von Christoph Deutschmann auf und analysiert die Rolle von Geld als Schlüsselmedium der Inklusion.
Das dritte Kapitel stellt verschiedene Konzepte des bedingungslosen Grundeinkommens vor und untersucht deren Inklusionspotential. Es zeigt am Beispiel der Forderungen von André Gorz, wie ein solches Grundeinkommen den Verlust der inkludierenden Funktion von Erwerbsarbeit kompensieren könnte.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses, die „Working Poor“, die soziale Exklusion, das bedingungslose Grundeinkommen, die Inklusionsfunktion von Arbeit und die gesellschaftliche Teilhabe. Die Arbeit analysiert die Entwicklungen der Arbeitsgesellschaft und die Herausforderungen, die sich daraus für die soziale Inklusion ergeben. Sie argumentiert, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung dieser Herausforderungen spielen kann.
- Citar trabajo
- Christoph Sprich (Autor), 2008, Exklusion trotz Arbeit? , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/127047