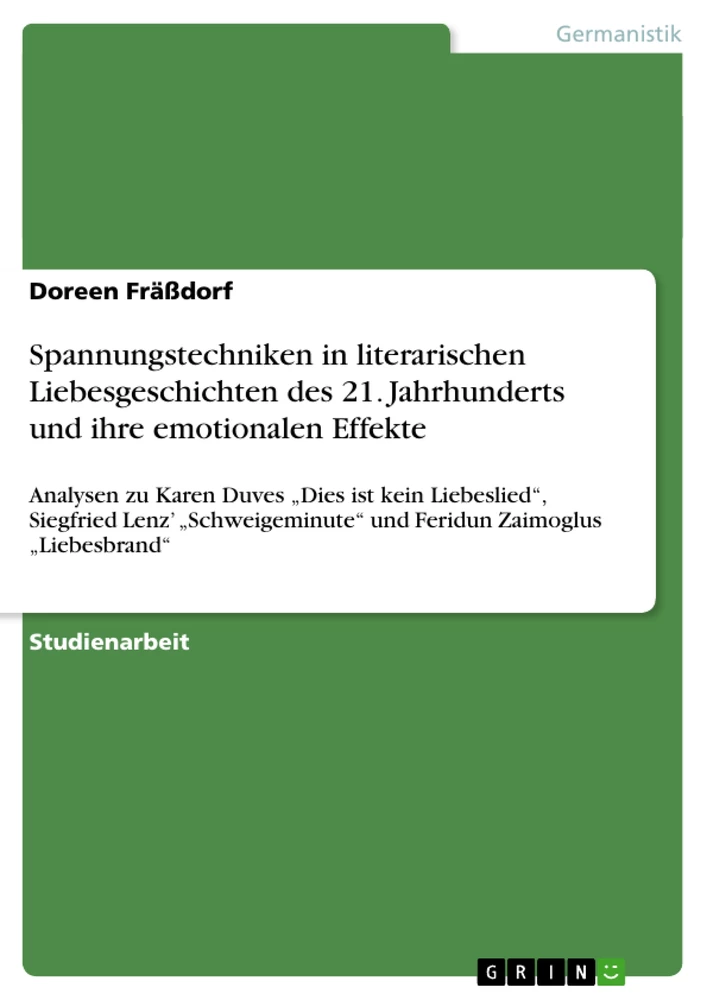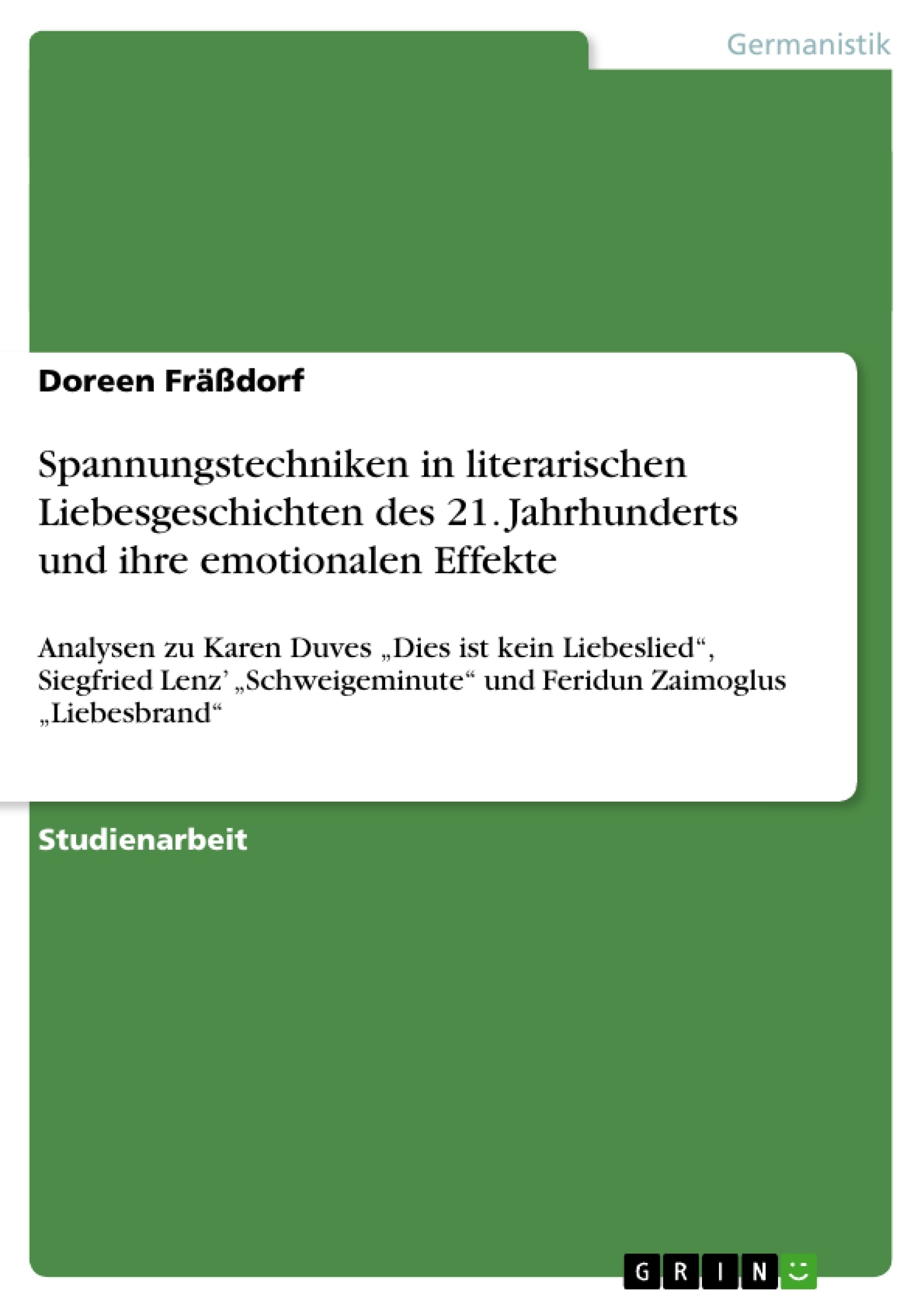"Die glückliche Liebe hat in der abendländischen Kultur keine Geschichte", stellte der Schweizer Kulturhistoriker Denis de Rougemont in seinem 1939 erschienenen Buch "Die Liebe und das Abendland" fest und stimmt so mit Niklas Luhmann überein, der für moderne Liebesliteratur dargestellt hat, dass das Sicheinlassen auf sexuelle Beziehungen Prägungen und Bindungen erzeugt, die ins Unglück führen. So liegt die Tragik, laut Luhmann, nicht mehr darin, dass die Liebenden nicht zueinander finden können, sondern dass sexuelle Beziehungen Liebe zur Folge haben und dass man sich dieser anschließend nicht mehr entziehen kann. Es ist wohl richtig, dass gerade in der Liebesliteratur immer wieder von gescheiterten Beziehungen, von Trennungen, der Suche nach dem richtigen Partner oder Eheproblemen die Rede ist; alles andere wäre ja auch nicht spannend und würde keineswegs zum Weiterlesen animieren. Viele Bestandteile von Liebescodes, wie sie Luhmann insbesondere aus Romanen rekonstruiert, verdanken ihre weite Verbreitung vor allem ihrem spannungsfördernden Potenzial. Ein Aspekt, den Luhmann allerdings übersieht.
In meiner Hausarbeit möchte ich anhand ausgewählter literarischer Liebesgeschichten des 21. Jahrhunderts eine Verbindung zwischen den von Luhmann rekonstruierten Liebescodes und den spannungsfördernden Tendenzen dieser schaffen. Des Weiteren werde ich herausarbeiten, welche emotionalen Effekte beim Leser durch Spannungstechniken erzeugt werden und welche Kunstgriffe es gibt, die bestimmte Affekte im Rezipienten stimulieren. Hier liegt es nahe, Spannungsanalysen als Textanalysen zu koppeln mit Reflexionen über dynamische Abläufe in der Psyche der Rezipienten.
An drei literarischen Liebesgeschichten im Besonderen möchte ich Spannungsanalysen vornehmen.
Im Verlauf der Arbeit soll nach einer Definition der Spannung, auf die Spannungsformen und die Manifestation der Spannung im Text eingegangen werden.
Spannungsanalysen versuchen eine Erklärung dafür zu liefern, warum Leser einen begonnenen Lektüreprozess fortsetzen wollen. In meiner Hausarbeit möchte ich Spannungsanalysen an den genannten Werken vornehmen. Dazu werde ich in erster Linie die von Thomas Anz vorgestellten Modelle zur Spannungsanalyse anwenden und Katja Mellmanns Untersuchung zur emotionspsychologischen Bestimmung von Spannung, um so herauszufinden, welche emotionalen Effekte beim Leser durch Spannung hervorgerufen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Phänomen Spannung in literarischen Texten
- Begriffsdefinition: Spannung
- Formen der Spannung
- Mittel der Spannungserzeugung
- Die Modelle der Spannungsanalyse nach Thomas Anz
- Emotionspsychologische Bestimmung von Spannung nach Katja Mellmann
- Spannungsanalysen zu ausgewählten Werken
- Siegfried Lenz: Schweigeminute
- Karen Duve: Dies ist kein Liebeslied
- Feridun Zaimoglu: Liebesbrand
- Einige von Luhmann rekonstruierte Liebescodes und ihr Bezug zur Spannung
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
- Primärtexte
- Forschungsliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen Spannung in literarischen Liebesgeschichten des 21. Jahrhunderts. Ziel ist es, die Verbindung zwischen den von Niklas Luhmann rekonstruierten Liebescodes und den spannungsfördernden Tendenzen dieser Geschichten aufzuzeigen. Darüber hinaus soll untersucht werden, welche emotionalen Effekte durch Spannungstechniken beim Leser erzeugt werden und welche Kunstgriffe es gibt, um bestimmte Affekte im Rezipienten zu stimulieren.
- Spannung in literarischen Texten und ihre Bedeutung für die Rezeption
- Die Rolle von Liebescodes in der Spannungserzeugung
- Emotionale Effekte von Spannungstechniken
- Analyse ausgewählter Liebesgeschichten des 21. Jahrhunderts
- Verbindung von Spannungsanalyse und Emotionspsychologie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Spannung in literarischen Liebesgeschichten ein und stellt die Relevanz des Themas dar. Sie beleuchtet die These, dass Spannung in der Liebesliteratur eine zentrale Rolle spielt, um den Leser zu fesseln und zum Weiterlesen zu animieren. Die Einleitung stellt die drei ausgewählten Werke vor und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Phänomen Spannung in literarischen Texten. Es werden verschiedene Begriffsdefinitionen von Spannung vorgestellt und die Formen der Spannung sowie die Mittel der Spannungserzeugung erläutert. Das Kapitel beleuchtet die Spannung als einen Zustand des Lesers, der durch Angespanntheit gekennzeichnet ist und durch die Narration erzeugt wird.
Das dritte Kapitel stellt die Modelle der Spannungsanalyse nach Thomas Anz vor. Anz beschreibt Spannung als einen Informationsmangel, der beim Leser ein Begehren nach dessen Beseitigung erzeugt. Dieses Begehren wird durch Hindernisse wachgehalten und gesteigert, was den Leser in einen Zustand zwischen vollkommener Unkenntnis und vollkommener Kenntnis versetzt.
Das vierte Kapitel widmet sich der emotionspsychologischen Bestimmung von Spannung nach Katja Mellmann. Mellmann untersucht die emotionalen Effekte von Spannung und zeigt auf, dass Spannung beim Leser sowohl Lust- als auch Unlustgefühle hervorrufen kann. Sie betont die enge Verbindung zwischen Spannung und Angstgefühlen.
Das fünfte Kapitel analysiert die Spannungstechniken in den drei ausgewählten Werken: „Schweigeminute“ von Siegfried Lenz, „Dies ist kein Liebeslied“ von Karen Duve und „Liebesbrand“ von Feridun Zaimoglu. Die Kapitel untersuchen, wie die Autoren Spannung erzeugen und welche emotionalen Effekte sie beim Leser erzielen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Spannung, Liebescodes, Liebesliteratur, emotionale Effekte, Spannungsanalyse, Thomas Anz, Katja Mellmann, Siegfried Lenz, Karen Duve, Feridun Zaimoglu, 21. Jahrhundert.
- Quote paper
- Doreen Fräßdorf (Author), 2009, Spannungstechniken in literarischen Liebesgeschichten des 21. Jahrhunderts und ihre emotionalen Effekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126938