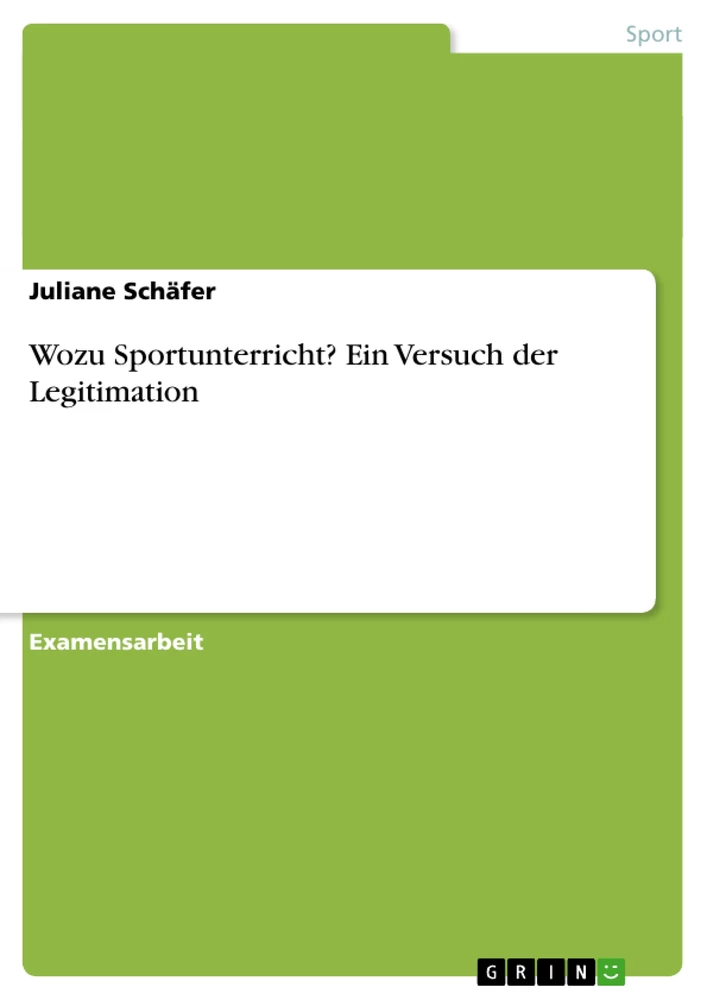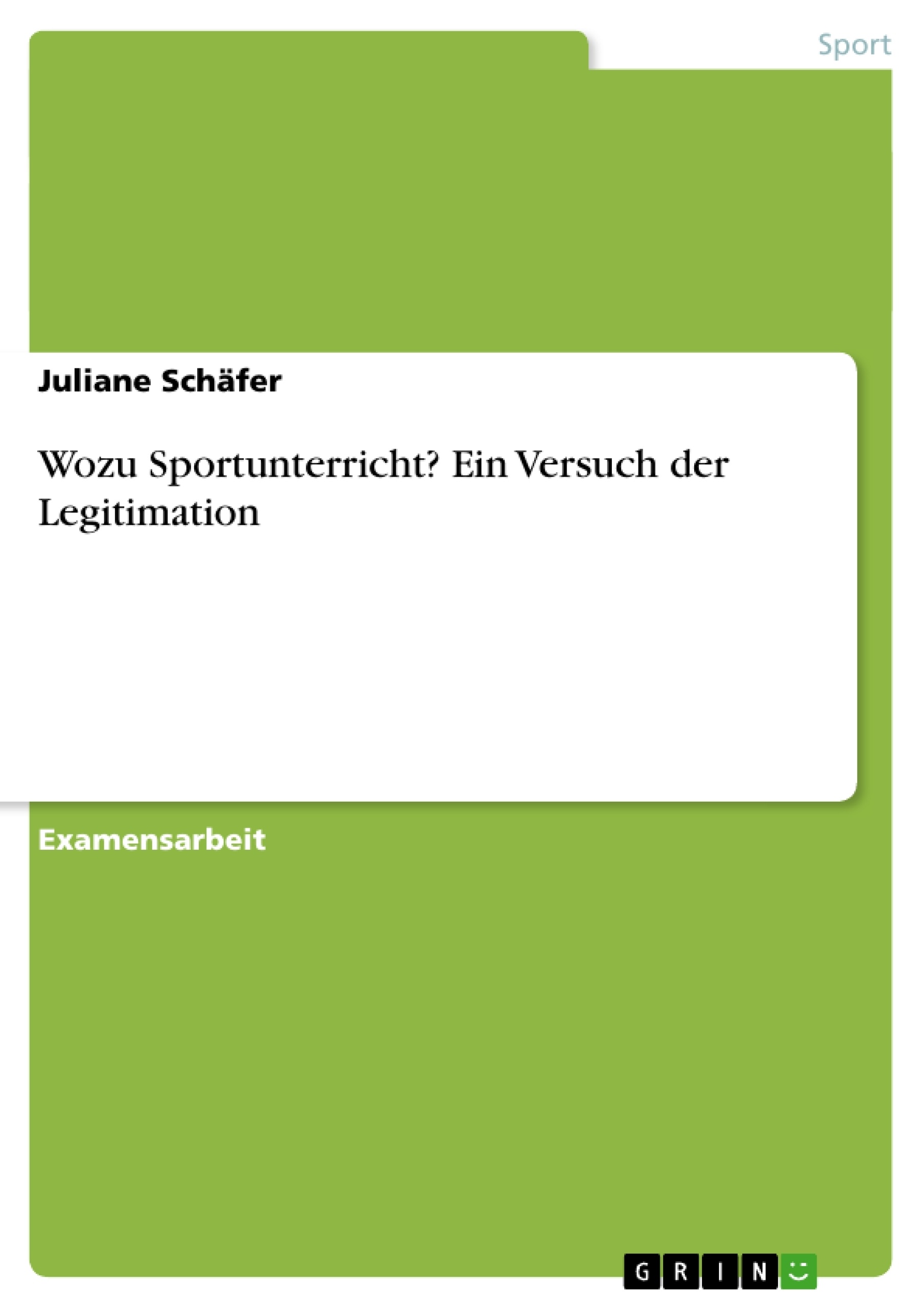Das „Wozu“ des Titels dient dazu, den Blick auf allgemein
proklamierte Zielsetzungen des Faches zu lenken, denn diese
zeigen als Richtschnur, wozu das Unterrichten im optimalen Fall
führen soll. Welche Ziele die Geschichte des Sportunterrichts prägten und wie es dazu kam, dass sich das Fach überhaupt im schulischen Fächerkanon etablierte, wird im historischen Diskurs (Kapitel 2) dargestellt. Wozu Sportunterricht? Ein Versuch der Legitimation. Anschließend sollen „aktuelle Zielsetzungen anhand der DSBSPRINT-Studie“ einen Überblick über Ziele geben, die dem
heutigen Sportunterricht übergeordnet sind. Herangezogen werden dazu aktuelle Lehrpläne und die Sicht beteiligter Akteure. Mit Hilfe der Ergebnisse dieses 3. Kapitels wird der geschichtliche Rückblick vervollständigt. Allerdings reichen Ziele allein als Legitimationsgrundlage für ein Fach nicht aus. Daher soll im vierten Schritt dargestellt werden, welche Wege verschiedene Autoren gehen und aufzeigen, um das Fach zu legitimieren. Nicht berücksichtigt wird die oft aufgeführte Kritik von LENZEN
(1999) und GIESECKE (1998), weil die kritische Auseinandersetzung mit dieser Thematik einen eigenen Arbeitsschwerpunkt darstellt. Ebenso verhält es sich mit der damit zusammenhängenden Legitimationsdebatte. In der Regel werden die einzelnen Kapitel der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit jeweils mit einer kurzen Einführung in den Aufbau eingeleitet und mit einem Zwischenfazit abgeschlossen. Zum Teil selbst hergestellte Abbildungen, welche keinen Literaturverweis enthalten, sollen der Veranschaulichung und einem besseren Überblick dienen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Historischer Diskurs
- „Wegbereiter“ des Sportunterrichts
- Schulturnen nach Adolf SPIESS
- Leibeserziehung der Reformpädagogik
- Politische Leibeserziehung im Dritten Reich
- Geteiltes Deutschland
- Körpererziehung im Osten
- Leibeserziehung im Westen
- Sportunterricht seit den 70er Jahren
- Zwischenfazit
- Aktuelle Zielsetzungen anhand der DSB-SPRINT-Studie
- Zielebene der Lehrpläne
- Stellenwert und Potenzial des Fachs
- Ziele der Bewegungsbildung
- Ziele der Allgemeinbildung
- Leistung, Gesundheit und soziales Lernen
- Zielsetzung aus Sicht der Schulleiter und Lehrer
- Bedeutung der Ergebnisse
- Legitimationsversuche
- Pfeiler der Legitimation nach PÜHSE
- Anthropologische Grundlegung
- Sache
- Kind und Jugendlicher
- Vorteilsargumentation nach SCHERLER
- Innerschulische Begründungen
- Außerschulische Begründungen
- Innersportliche Begründungen
- Übersportliche Begründungen
- Argumente nach BALZ
- Erziehung zum Sport: Sportartenkompetenz
- Erziehung im Sport: Handlungsfähigkeit
- Erziehung durch Sport: Lebenskunst
- Begründungsfaktoren nach GRÖSSING
- Begründungsfaktor Anthropologie
- Körperlichkeit
- Bewegung
- Sinn
- Kultur
- Begründungsfaktor Lebenswelt
- Familie
- Wohnbereich
- Kindergarten und Grundschule
- Zusammenfassung und Ergänzung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit der Legitimation des Sportunterrichts an Realschulen. Ziel ist es, die Bedeutung und Relevanz des Faches im Kontext der heutigen Gesellschaft zu beleuchten und verschiedene Legitimationsansätze zu analysieren. Die Arbeit untersucht die historische Entwicklung des Sportunterrichts, aktuelle Zielsetzungen und die Argumente, die für den Stellenwert des Faches sprechen.
- Historische Entwicklung des Sportunterrichts
- Aktuelle Zielsetzungen des Sportunterrichts
- Legitimationsansätze für den Sportunterricht
- Bedeutung des Sportunterrichts für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Relevanz des Sportunterrichts in der heutigen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit ein. Sie erläutert den aktuellen Diskurs um die Legitimation des Sportunterrichts und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Das zweite Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Sportunterrichts. Es werden verschiedene Epochen und Strömungen betrachtet, die den Sportunterricht geprägt haben, von den „Wegbereitern“ des Sportunterrichts über das Schulturnen nach Adolf SPIESS bis hin zur Leibeserziehung der Reformpädagogik und der politischen Leibeserziehung im Dritten Reich. Die Entwicklung des Sportunterrichts in der geteilten Bundesrepublik Deutschland wird ebenfalls beleuchtet, wobei die Unterschiede in der Körpererziehung im Osten und der Leibeserziehung im Westen hervorgehoben werden. Das Kapitel endet mit einem Zwischenfazit, das die wichtigsten Entwicklungen und Herausforderungen des Sportunterrichts zusammenfasst.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den aktuellen Zielsetzungen des Sportunterrichts anhand der DSB-SPRINT-Studie. Es werden die Ziele der Lehrpläne, die Zielsetzung aus Sicht der Schulleiter und Lehrer sowie die Bedeutung der Ergebnisse der Studie analysiert. Die Studie zeigt, dass der Sportunterricht einen hohen Stellenwert für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hat und wichtige Ziele in den Bereichen Bewegungsbildung, Allgemeinbildung, Leistung, Gesundheit und soziales Lernen verfolgt.
Das vierte Kapitel widmet sich verschiedenen Legitimationsversuchen für den Sportunterricht. Es werden die Pfeiler der Legitimation nach PÜHSE, die Vorteilsargumentation nach SCHERLER, die Argumente nach BALZ und die Begründungsfaktoren nach GRÖSSING vorgestellt und analysiert. Die verschiedenen Ansätze beleuchten die Bedeutung des Sportunterrichts aus unterschiedlichen Perspektiven und zeigen die vielfältigen Gründe für seine Relevanz auf.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Sportunterricht, die Legitimation, die historische Entwicklung, die aktuellen Zielsetzungen, die Bedeutung für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, die Relevanz in der heutigen Gesellschaft, die anthropologische Grundlegung, die Vorteilsargumentation, die Begründungsfaktoren und die verschiedenen Legitimationsansätze.
- Quote paper
- Juliane Schäfer (Author), 2007, Wozu Sportunterricht? Ein Versuch der Legitimation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126897