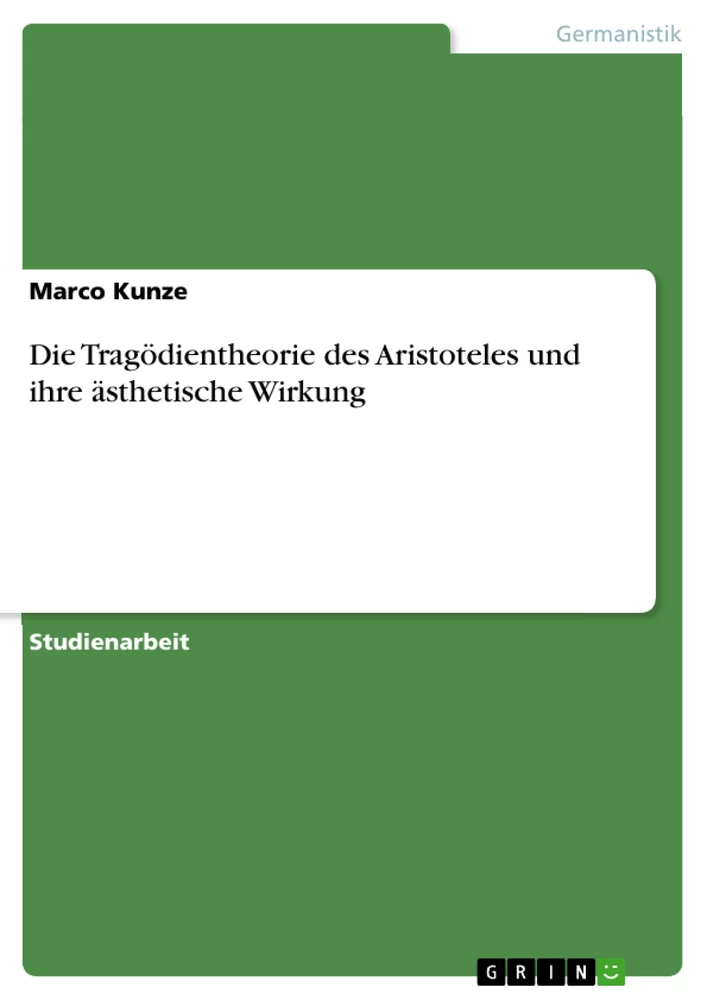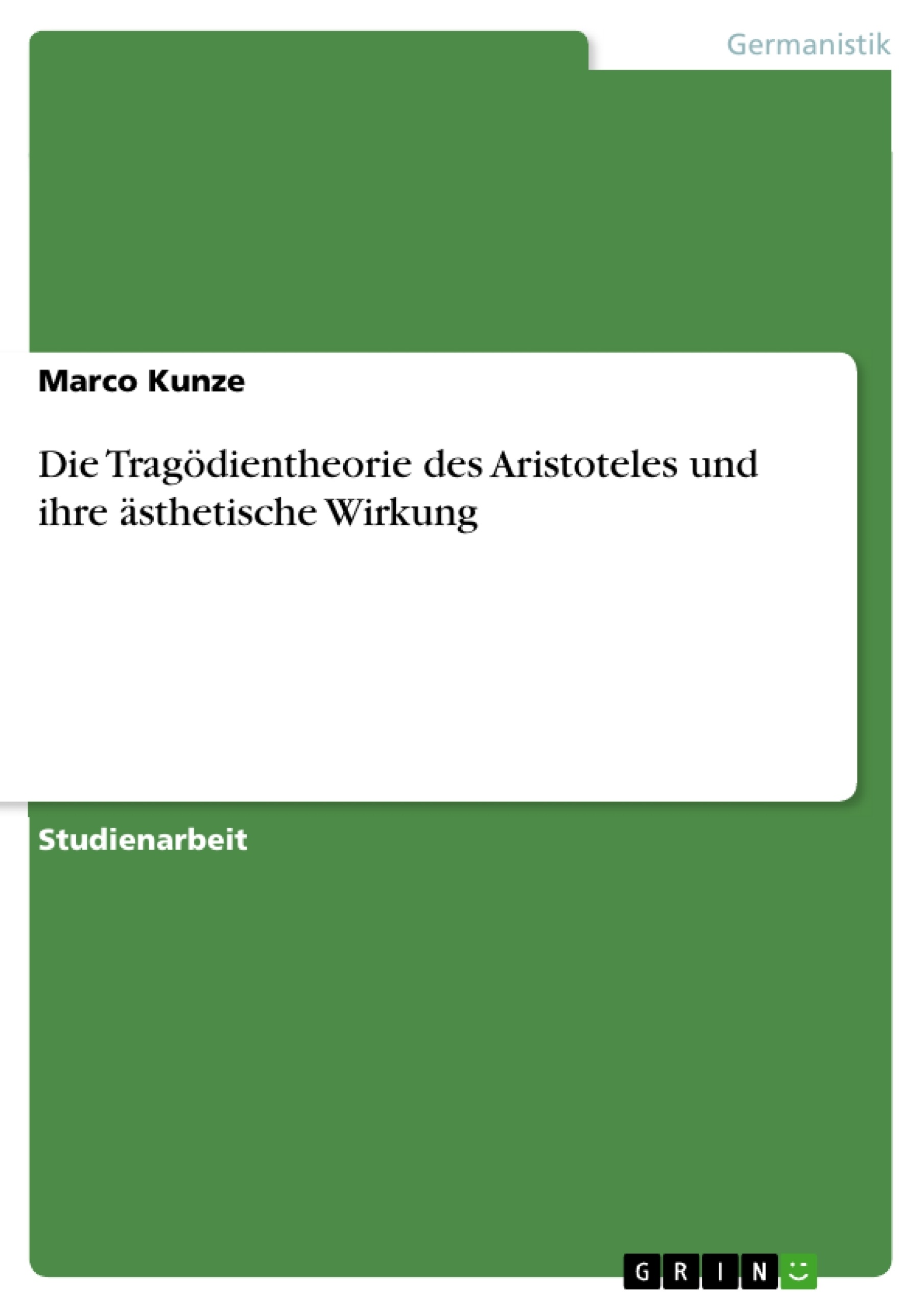Tragödien sind bei den Menschen seit der Antike beliebt. Woran liegen Faszination und Vergnügen an diesen Handlungen, in denen Menschen mehr oder weniger unverdient ins Unglück gestürzt werden. Aristoteles versuchte schon vor über 2000 Jahren Zusammensetzung und Wirkungsweise der Tragödie theoretisch darzulegen. Die Grundmerkmale seiner klassischen Tragödientheorie werden in der berühmten Definition aus Kapitel sechs seiner „Poetik“ aufgeführt:
„Die Tragödie ist Nachahmung einer guten und in sich geschlossenen Handlung bestimmter Größe, in anziehend geformter Sprache, wobei diese formenden Mittel in den einzelnen Abschnitten je verschieden angewandt werden – Nachahmung von Handelnden und nicht durch Bericht, die Jammer und Schaudern hervorruft und hierdurch eine Reinigung von derartigen Erregungszuständen bewirkt .“
Von den aufgeführten Punkten werden im Folgenden die beiden wichtigsten Wesensmerkmale Handlung und Charaktere, sowie die ästhetischen Wirkungsaspekte Jammer, Schaudern und Reinigung (griechisch: Eleos, Phobos und Katharsis) näher beleuchtet. Aufgrund der Kürze des Textes erfolgen die Erläuterungen nur relativ oberflächlich, wobei auch einige Aspekte ganz außer Betracht bleiben müssen.
Inhaltsverzeichnis
- Geschichte/Germanistik (B.A.)
- Tragödien sind bei den Menschen seit der Antike beliebt. Woran liegen Faszination und Vergnügen an diesen Handlungen, in denen Menschen mehr oder weniger unverdient ins Unglück gestürzt werden. Aristoteles versuchte schon vor über 2000 Jahren Zusammensetzung und Wirkungsweise der Tragödie theoretisch darzulegen. Die Grundmerkmale seiner klassischen Tragödientheorie werden in der berühmten Definition aus Kapitel sechs seiner „Poetik“ aufgeführt:
- Von den aufgeführten Punkten werden im Folgenden die beiden wichtigsten Wesensmerkmale Handlung und Charaktere, sowie die ästhetischen Wirkungsaspekte Jammer, Schaudern und Reinigung (griechisch: Eleos, Phobos und Katharsis) näher beleuchtet. Aufgrund der Kürze des Textes erfolgen die Erläuterungen nur relativ oberflächlich, wobei auch einige Aspekte ganz außer Betracht bleiben müssen.
- Richten wir den Blick zunächst auf die Handlung und ihre Struktur. Allgemein äußerlich hat die Tragödienhandlung zunächst eine bestimmte Geschlossenheit, Größe und Einheit zu wahren, wobei diese drei Merkmale eng miteinander verknüpft sind. Für das Theorem der Geschlossenheit wählt Aristoteles ganz pragmatisch die Definition, wonach die Tragödienhandlung einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat. Der Anfang führt in die Handlung ein, hat aber keine notwendigen Voraussetzungen, verlangt aber eine Fortsetzung. Die Mitte setzt den Anfang voraus und wirkt konsequent auf das Ende hin. Das Ende wird durch die beiden vorherigen Teile verursacht und schließt die Handlung endgültig. Die Handlung darf also weder an einem beliebigen Punkt einsetzen, noch abrupt abreißen oder über das Ende hinauswirken. Die Größe der Handlung richtet sich zunächst danach, dass sie für den Zuschauer nachvollziehbar und erinnerbar bis zum Ende bleibt und, dass die für den Wirkungszweck der Tragödie so wichtigen Elemente des Handlungsumschwunges vom Glück zum Unglück und der Widererkennung von Personen und Sachzusammenhängen durch die Charaktere darin Platz finden können. Die Einheit der Handlung ergibt sich nicht aus der einheitlichen Identität des tragischen Helden, sondern daraus, dass eben nur ein Thema Gegenstand der Handlung ist. Ist die Handlung einheitlich, können weder einzelne Teile umgestellt noch weggelassen werden.
- Im nächsten Schritt untersuchen wir, inwiefern die tragische Handlung mit der Wirklichkeit verknüpft ist. Aristoteles führt hier die strikte Unterscheidung von Dichtung und Geschichtsschreibung an. Die Historie teilt hiernach das Besondere, das was wirklich explizit geschehen ist, mit. Die Dichtung hingegen sei allgemeiner, philosophischer und stelle das anhand von Modellen das Mögliche und Wahrscheinliche dar. Es gilt hier das Postulat der Wahrscheinlichkeit, obwohl sich der Stoff der Handlung auf wahre historische Figuren stützt. Figuren und Ereignisse bekommen somit einen Modellcharakter, um die Identifikation der Zuschauer mit den Figuren zu bewerkstelligen. Aristoteles verändert somit die wahren Begebenheiten insoweit, dass sie dem Wirkungszweck der Tragödie, Jammer und Schaudern zu erzeugen, besser entsprechen können. Um diese Affekte jedoch wirkungsvoll hervorrufen zu können, müssen sie sich gemäß dem Postulat der Wahrscheinlichkeit, aber doch für den Zuschauer überraschend einstellen.
- Abschließend setzen wir uns mit den Handlungsarten und der quantitativen Einteilung der Tragödie auseinander, bevor wir uns dem Bereich des tragischen Charakters zuwenden. Aristoteles unterscheidet zwei Handlungsarten: die einfache und die komplizierte. In der einfachen Art vollzieht sich die Wende zum Unglück ohne Peripetie und Widererkennung. Diese Art zeugt nach Aristoteles von wenig dichterischer Qualität. In die komplizierte Handlung hingegen sind Peripetie und Widererkennung eingeflochten. Peripetie und Widererkennung können dort einfach oder mehrfach stattfinden. Die Peripetie ist das Umschlagen eines erstrebten Zieles eines oder mehrerer Charaktere in sein genaues Gegenteil. Sie unterliegt dem Postulat der Wahrscheinlichkeit. Die Widererkennung ist das Umschlagen von Unkenntnis in Kenntnis, im Bezug auf die Charaktere oder Sachzusammenhänge. Bei den Charakteren kann sie auch wechselseitig erfolgen. Sie tritt meistens in Verbindung mit der der Peripetie auf. Beide sind ursächlich für das schwere Leid oder die Katastrophe am Ende der Tragödie.
- Die Tragödie besteht aus Prolog, den Episoden, und dem Exodos, die von den Chorpartien Parodos (erste vollständige Partie des Chores) und Stasimon voneinander getrennt werden. Davon abgesehen gibt es die Sonderformen der Solo-Arie und das Klagelied Kommos.
- Richten wir nun das Augenmerk auf den tragischen Charakter. In diesem Abschnitt verlagert sich der Blickpunkt langsam von den inneren Wesensmerkmalen der Tragödie hin zur ästhetischen Wirkungsweise der Tragödie, dem Jammern, dem Schaudern und der Katharsis. Um Jammer und Schaudern auslösen zu können bedarf es zunächst einer emotionalen Verbindung, einer Identifikation mit der tragischen Hauptfigur. Daher muss der tragische Protagonist eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Zuschauer haben. Weiterhin muss er durch irgendeine Tat in der Handlung schweres Leid erfahren, damit das tragische Moment ausgelöst wird. Anhand von vier Beispielmodellen von Grundtypen nähert sich Aristoteles dem tragischen Charakter. Das Modell des tadellosen Menschen, der vom Glück ins Unglück stürzt, verwirft er, da dieses Modell nicht mit dem moralischen Weltbild der antiken Griechen konform ist. Das Modell, indem ein moralisch schlechter Mensch den Umschwung von Unglück ins Glück erlebt, verwirft Aristoteles als untragisch und menschenunfreundlich. Im Modell, in dem ein ganz schlechter Mensch vom Glück ins Unglück stürzt, bleiben nach Aristoteles Jammer und Schaudern aus, da das Leid durch die moralische Schuld verdient ist. Außerdem bleibt hierbei die Identifizierung des Publikums mit dem Charakter aus. Im vierten Modell wendet sich Aristoteles nun dem Idealtypus des tragischen Charakters und somit der besten Form der Tragödie zu. Dieser steht nun als „mittlerer Mann im Brennpunkt zwischen den moralisch-sittlichen Extremen von tadellos-gut und schlecht. In dieser Hinsicht entspricht er weitgehende der Allgemeinheit. Er unterscheidet sich jedoch im Hinblick auf seinen sozialen Status. Der tragische Charakter kommt meist aus begüterten Verhältnissen oder aus dem Adel. Durch diesen hervorgehobenen Staus wird an ihn eine höhere Moralität und Sittlichkeit geknüpft, was das tragische Moment noch weiter verstärkt. Weiterhin muss der tragische Held einen gleichmäßigen Charakter besitzen, in dem Sinne, dass er durch die gesamte Tragödie hindurch, stringent seinen gegebenen moralischen Vorstellungen treu bleibt, wobei Aristoteles auch Ausnahmen davon zulässt. Alles in allem hat der tragische Charakter ein etwas über dem Durchschnitt der Allgemeinheit angesiedeltes moralisch-sittliches Niveau. Des Weiteren besitzt der tragische Charakter, wie alle Personen, einen gewissen Grad an Erkenntnisfähigkeit (griechisch: dianoia) der Situationen und Sachzusammenhänge um ihn herum. So weit zum Charakter an sich. Wie und warum aber erfolgt nun der Umschwung vom Glück ins Unglück, und das, wie bereits eingangs erwähnt, unverdienterweise? Aristoteles benennt es bei einem ganz einfachen Namen: der tragische Held begeht ganz klassisch einen Fehler (griechisch: hamartia), durch den der Umschwung vom Glück ins Unglück ausgelöst wird. Dieser Fehler begründet sich jedoch nicht oder nur zum geringen Teil in einer Schwäche des moralisch-sittlichen Charakters des Protagonisten. Bei einer schweren moralisch verwerflichen Tat wäre das Unglück ja verdient, was es in der Tragödie eben nicht sein darf. Vielmehr begründet sich der Fehler aufgrund einer Schwäche oder Unterentwicklung der Erkenntnisfähigkeit, aufgrund derer er die falschen Schlüsse aus den ihn umgebenden Situationen zieht, und in den entscheidenden Situation schlicht und einfach falsch reagiert, wodurch das Verhängnis ausgelöst wird. Der Fehler ist eine menschliche Schwäche im Intellekt des tragischen Charakters. Das aus dem Fehler resultierende Unglück muss aber nicht nur ein schweres Leiden sein, vielmehr kann es auch eine schreckliche Tat wie Mord und Selbstmord sein. Der Fehler selbst wird in der Tragödienhandlung von Handlungsumschwüngen und Widererkennung bedingt.
- Die Intensität der tragischen Wirkung richtet sich weiterhin stark nach der Beziehung der einzelnen Charaktere untereinander. Je näher sich diese im Rahmen von Handlung und Tat stehen, desto mehr Jammer und Schaudern kann beim Publikum erreicht werden. Ein weiterer Aspekt im Hinblick auf die Intensität der Tragik ist das Spannungsfeld zwischen Ausführung und Nichtausführung der Tat, sowie wissentlichem und unwissentlichem Tun.
- Nachdem wir uns bisher mit der grundsätzlichen inneren Struktur der aristotelischen Tragödie angeschaut haben, wenden wir nun im letzten Schritt der äußeren Wirkungsweise der Tragödie zu. Aristoteles sagt zur Wirkungsweise der Tragödie, dass diese Jammer (Eleos) und Schaudern (Phobos) erregen, und hierdurch eine Reinigung (Katharsis) von diesen Affekten bewirkt werden soll. Um dieses Paradoxon zu lösen werden wir zunächst versuchen die einzelnen Begriffe zu erklären. Jammer meint in diesem Zusammenhang quasi das Mitfühlen mit dem tragischen Charakter. Er bleibt nicht diese entfernte Figur der tragischen Geschichte, er geht uns nahe, bestärkt durch das unverdiente Leid, dass ihm durch seinen Fehler widerfährt. Weiterhin offenbart sich hierdurch, dass der Charakter das gleiche moralisch-sittliche Niveau in sich trägt, wie der Zuschauer selbst. Das Schaudern treibt diesen Gedanken weiter. Eben durch dieses unverdiente Schicksal und die Ähnlichkeit zum Zuschauer, befürchtet dieser nun selbst die Möglichkeit diese schwere Leid erdulden zu müssen, denn auch er könnte durch diesen allzu menschlichen Fehler, der in die Katastrophe führt, begehen. Diese psychischen Affekte werden aber nicht von der Tragödie ausgelöst, sie schlummern in einer gewissen Intensität in der Psyche der Menschen. Jammer und Schaudern beeinträchtigen als ungemäßigte Affektzustände das seelische Gleichgewicht des Menschen und müssen als
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Tragödientheorie des Aristoteles und untersucht deren ästhetische Wirkungsweise. Ziel ist es, die zentralen Elemente der Theorie, insbesondere die Handlungsstruktur, den tragischen Charakter und die Affekte Jammer, Schaudern und Katharsis, zu analysieren und zu erläutern.
- Die Struktur der Tragödie: Geschlossenheit, Größe und Einheit der Handlung
- Die Beziehung zwischen Dichtung und Wirklichkeit in der Tragödie
- Der tragische Charakter: Eigenschaften, Fehler und moralische Ambivalenz
- Die ästhetische Wirkungsweise der Tragödie: Jammer, Schaudern und Katharsis
- Die Rolle der Peripetie und Widererkennung in der Tragödie
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Einführung in die Tragödientheorie des Aristoteles und stellt die zentrale Definition aus der „Poetik“ vor. Anschließend werden die wichtigsten Wesensmerkmale der Tragödie, Handlung und Charakter, sowie die ästhetischen Wirkungsaspekte Jammer, Schaudern und Reinigung näher beleuchtet.
Im ersten Kapitel wird die Handlungsstruktur der Tragödie analysiert. Aristoteles betont die Bedeutung von Geschlossenheit, Größe und Einheit der Handlung. Die Handlung muss einen klaren Anfang, eine Mitte und ein Ende haben, wobei die einzelnen Teile logisch miteinander verbunden sind. Die Größe der Handlung muss für den Zuschauer nachvollziehbar und erinnerbar sein, und die für die Tragödie wichtigen Elemente des Handlungsumschwunges vom Glück zum Unglück und der Widererkennung von Personen und Sachzusammenhängen müssen darin Platz finden.
Im zweiten Kapitel wird die Beziehung zwischen Dichtung und Wirklichkeit in der Tragödie untersucht. Aristoteles unterscheidet zwischen Dichtung und Geschichtsschreibung. Die Dichtung ist allgemeiner und philosophischer und stellt das Mögliche und Wahrscheinliche dar, während die Geschichtsschreibung das Besondere, das was wirklich geschehen ist, mitteilt. Die Figuren und Ereignisse in der Tragödie haben somit einen Modellcharakter, um die Identifikation der Zuschauer zu fördern. Aristoteles verändert die wahren Begebenheiten insoweit, dass sie dem Wirkungszweck der Tragödie, Jammer und Schaudern zu erzeugen, besser entsprechen.
Im dritten Kapitel wird der tragische Charakter analysiert. Aristoteles beschreibt den tragischen Helden als „mittleren Mann“, der zwischen den moralisch-sittlichen Extremen von tadellos-gut und schlecht steht. Der tragische Charakter muss eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Zuschauer haben, um Empathie und Identifikation zu ermöglichen. Er muss durch eine Tat in der Handlung schweres Leid erfahren, um das tragische Moment auszulösen. Der tragische Held begeht einen Fehler (hamartia), der den Umschwung vom Glück ins Unglück auslöst. Dieser Fehler ist nicht unbedingt eine moralische Schwäche, sondern eher eine Unterentwicklung der Erkenntnisfähigkeit, die den Helden dazu bringt, in entscheidenden Situationen falsch zu reagieren.
Im vierten Kapitel wird die ästhetische Wirkungsweise der Tragödie behandelt. Aristoteles betont, dass die Tragödie Jammer (Eleos) und Schaudern (Phobos) erregen soll, um hierdurch eine Reinigung (Katharsis) von diesen Affekten zu bewirken. Jammer entsteht durch das Mitfühlen mit dem tragischen Charakter, der unverdientes Leid erfährt. Schaudern entsteht durch die Angst des Zuschauers, selbst ein ähnliches Schicksal erleiden zu müssen. Die Katharsis ist die Reinigung von diesen Affekten, die durch die Tragödie ausgelöst werden.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Tragödientheorie des Aristoteles, die Handlungsstruktur, den tragischen Charakter, Jammer, Schaudern, Katharsis, Peripetie, Widererkennung, Dichtung, Wirklichkeit, Modellcharakter, Affekte, moralische Ambivalenz, Fehler (hamartia), Erkenntnisfähigkeit, Identifikation, Empathie und ästhetische Wirkungsweise.
- Quote paper
- Marco Kunze (Author), 2005, Die Tragödientheorie des Aristoteles und ihre ästhetische Wirkung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126868