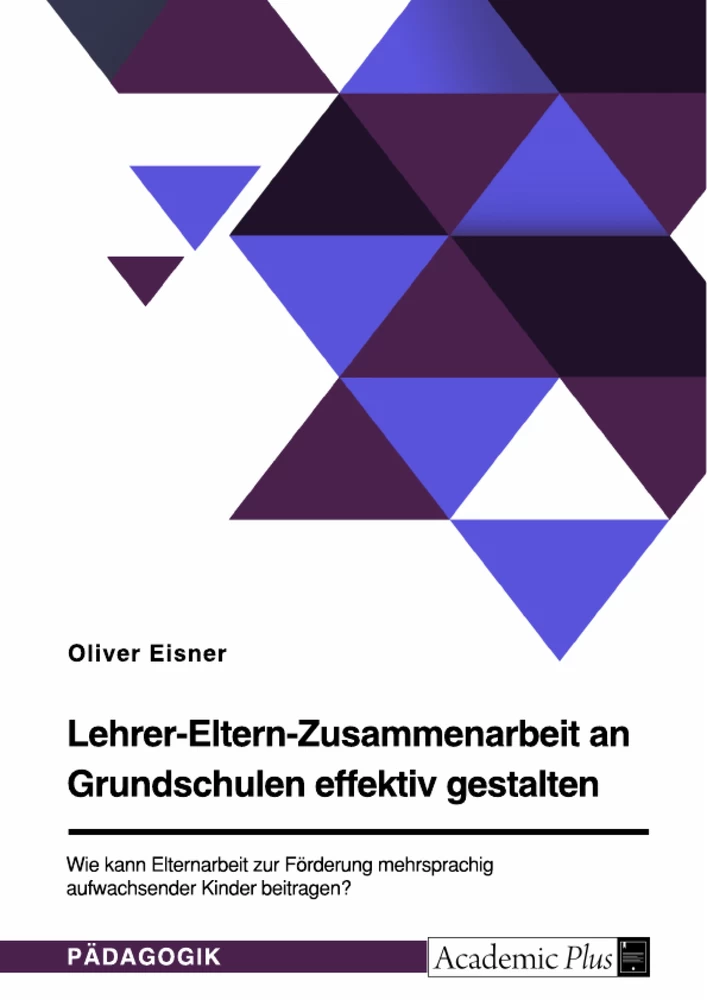Diese Arbeit stellt sich die Frage, was aktuell unternommen wird und unternommen werden kann, um der Mehrsprachigkeit in Schulen schon jetzt gerecht zu werden. Ein wichtiger Punkt wird bislang häufig noch ausgeklammert oder vernachlässigt: die Elternarbeit. Untersuchungen der PISA-Studie ergaben, dass Familien mehr als doppelt so viel Einfluss auf den Schulerfolg nehmen, als die Schule, Lehrkräfte und Unterricht kombiniert. Daher stellt sich die Frage: Inwiefern arbeiten Lehrkräfte bzw. die Grundschulen mit den Eltern der mehrsprachig aufwachsenden Kinder zusammen, um die Kinder bestmöglich zu fördern? Wie sieht die Kommunikation überhaupt aus? Eine Zusammenarbeit wäre essenziell, da die Kinder vor allem auch durch das Elternhaus im schulischen Kontext stark profitieren. Das Elternhaus hat laut Hattie-Studie mehr Determinanten und Einflussfaktoren für den schulischen Lernerfolg als die Schule selbst. Besonders die Negativeffekte, die es zu verhindern gilt, liegen im Bereich des Elternhauses. Also ist hier eine Zusammenarbeit von sehr hoher Bedeutung, gerade für mehrsprachig aufwachsende Kinder, da vor allem Eltern mit Migrationshintergrund der Annahme sind, sie können nichts zum Bildungserfolg ihrer Kinder beitragen.
Was ist (die deutsche) Sprache? Vor dem Hintergrund zunehmender Zuwanderung gerät das deutsche Schul- und Bildungssystem vermehrt unter Druck. Menschen aus allen Teilen der Welt fassen, oftmals notgedrungen aufgrund von Flucht, den Entschluss, nach Deutschland zu kommen. Die ausländischen Kinder sind in Deutschland somit schulpflichtig, müssen fortan die von der Kultusministerkonferenz formulierten Bildungsstandards erreichen und nach den föderalen Curricula sowie den schulinternen Arbeitsplänen beschult werden. Das alles findet in der Grundschule in aller Regel, abgesehen vom Englischunterricht, in der deutschen Sprache statt, obgleich viele dieser Kinder zumeist der deutschen Sprache noch nicht mächtig sind. Das bedeutet allerdings längst nicht, dass diese Kinder lernschwach sind oder andere Defizite aufweisen. Hier macht sich bereits ein großes Problem erkennbar. Es wirft die Frage auf, ob mehrsprachig aufwachsende Kinder aktuell unabhängig von ihrem Kenntnisstand über die deutsche Sprache beschult werden bzw. beschult werden können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretisches Fundament
- 2.1 Mehrsprachigkeit
- 2.2 Migration/Migrationshintergrund
- 2.3 Deutsch als Zweitsprache bzw. Fremdsprache
- 2.4 Zwischenfazit I
- 3 Lehrer*innen-Eltern-Zusammenarbeit
- 3.1 Elternarbeit
- 3.2 Parental Involvement
- 3.3 Einseitiges Machtgefälle
- 3.4 Formen der Zusammenarbeit
- 3.4.1 Heim- und schulbasiertes Eltern-Engagement
- 3.4.2 Elternberatung und Elterntrainings
- 3.4.3 Eltern-LehrerInnen-Kontakte
- 3.4.5 Elternmitbestimmung
- 3.5 (Aus)Wirkungen von Lehrer*innen-Eltern-Zusammenarbeit auf die Akteure
- 3.6 Aufgaben der Zusammenarbeit
- 3.7 Zwischenfazit II
- 3.8 Mehrsprachigkeit in der Lehrer*innen-Eltern-Zusammenarbeit
- 3.9 Kommunikation
- 4 Exkurs: Lehrer*innen-Einstellungen und erworbene Kompetenzen zum Thema Mehrsprachigkeit
- 5 Das voXmi-Schulnetzwerk
- 5.1 Grundlegendes
- 5.2 Stellung der Lehrer*innen-Eltern-Zusammenarbeit im Kontext von voXmi
- 6 Studie: Lehrer*innen-Eltern-Zusammenarbeit im Kontext der Mehrsprachigkeit an einer niedersächsischen Grundschule verglichen mit einer österreichischen voXmi-Schule
- 6.1 Forschungsinteresse
- 6.2 Forschungsdesign, Erhebungs- und Auswertungsmethode
- 6.3 Auswertung der Daten
- 6.4 Interpretation der Daten
- 6.4.1 Interview 1: Grundschule in Niedersachsen
- 6.4.2 Interview 2: Volksschule in Österreich
- 6.5 Vergleich der beiden Schulen
- 7 Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Lehrer*innen-Eltern-Zusammenarbeit an Grundschulen im Kontext der Mehrsprachigkeit. Sie untersucht die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der zunehmenden Vielfalt an Sprach- und Kulturhintergründen in deutschen Grundschulen ergeben. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Eltern im Kontext der Mehrsprachigkeit zu entwickeln und praxisrelevante Erkenntnisse für die Gestaltung einer inklusiven und erfolgreichen Schulkultur zu gewinnen.
- Mehrsprachigkeit als Ressource und Herausforderung in der Grundschule
- Herausforderungen und Chancen der Lehrer*innen-Eltern-Zusammenarbeit im Kontext der Mehrsprachigkeit
- Entwicklung und Förderung der Sprachkompetenz von mehrsprachig aufwachsenden Kindern
- Kommunikation und Interaktion zwischen Lehrkräften, Eltern und mehrsprachigen Kindern
- Praxisbeispiele für die Gestaltung einer inklusiven Schulkultur im Kontext der Mehrsprachigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema Lehrer*innen-Eltern-Zusammenarbeit im Kontext der Mehrsprachigkeit einführt und den Forschungsstand beleuchtet. Im zweiten Kapitel wird das theoretische Fundament der Arbeit gelegt. Hier werden die Konzepte der Mehrsprachigkeit, Migration und Deutsch als Zweitsprache bzw. Fremdsprache erläutert und in Bezug auf die Herausforderungen und Chancen der Grundschule gesetzt. Im dritten Kapitel wird die Lehrer*innen-Eltern-Zusammenarbeit im Detail betrachtet. Es werden verschiedene Formen der Zusammenarbeit vorgestellt und deren Auswirkung auf die Akteure diskutiert. Das Kapitel beleuchtet auch die Bedeutung der Kommunikation und Interaktion im Kontext der Mehrsprachigkeit. Im vierten Kapitel wird ein Exkurs zu Lehrer*innen-Einstellungen und Kompetenzen zum Thema Mehrsprachigkeit unternommen. Das fünfte Kapitel widmet sich dem voXmi-Schulnetzwerk, einem Modellprojekt zur Förderung von Mehrsprachigkeit an Grundschulen. Im sechsten Kapitel wird eine empirische Studie vorgestellt, die die Lehrer*innen-Eltern-Zusammenarbeit an einer niedersächsischen Grundschule mit einer österreichischen voXmi-Schule vergleicht. Die Studie beleuchtet die unterschiedlichen Herangehensweisen und Praxisbeispiele im Kontext der Mehrsprachigkeit.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Arbeit sind: Mehrsprachigkeit, Lehrer*innen-Eltern-Zusammenarbeit, Migration/Migrationshintergrund, Deutsch als Zweitsprache, Inklusion, Interkulturelle Kompetenz, Sprachförderung, Kommunikation, Elternarbeit, Parental Involvement, voXmi-Schulnetzwerk, empirische Studie, Grundschule.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hat das Elternhaus auf den Schulerfolg?
Laut PISA- und Hattie-Studien hat die Familie mehr als doppelt so viel Einfluss auf den Schulerfolg wie Schule, Lehrkräfte und Unterricht zusammen.
Was ist das voXmi-Schulnetzwerk?
voXmi ist ein Modellprojekt zur Förderung von Mehrsprachigkeit, das eine inklusive Schulkultur und eine enge Zusammenarbeit mit Eltern unterstützt.
Warum ist Elternarbeit bei Kindern mit Migrationshintergrund besonders wichtig?
Viele Eltern mit Migrationshintergrund glauben fälschlicherweise, sie könnten nichts zum Bildungserfolg beitragen; eine Zusammenarbeit stärkt ihre Rolle und fördert das Kind.
Wie wirkt sich Mehrsprachigkeit auf den Unterricht in Deutschland aus?
Obwohl der Unterricht meist auf Deutsch stattfindet, ist Mehrsprachigkeit eine Ressource, die durch gezielte Kommunikation und inklusive Konzepte genutzt werden sollte.
Welche Formen der Lehrer-Eltern-Zusammenarbeit gibt es?
Die Arbeit nennt unter anderem heim- und schulbasiertes Engagement, Elternberatung, Elterntrainings sowie direkte Eltern-Lehrer-Kontakte.
- Arbeit zitieren
- Oliver Eisner (Autor:in), 2022, Lehrer-Eltern-Zusammenarbeit an Grundschulen effektiv gestalten. Wie kann Elternarbeit zur Förderung mehrsprachig aufwachsender Kinder beitragen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1268246