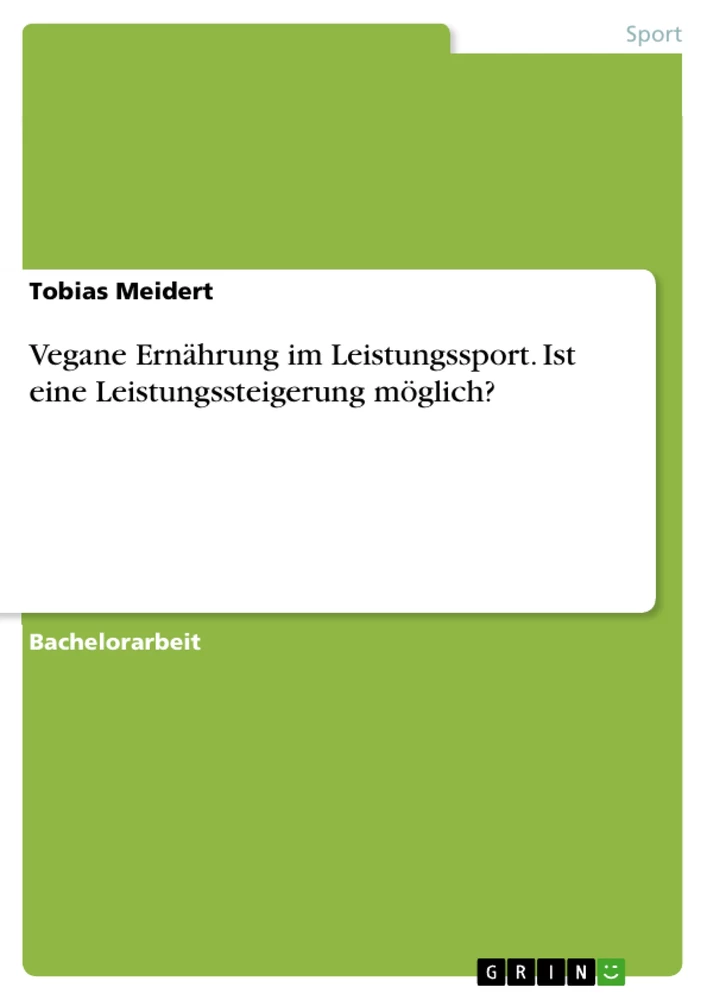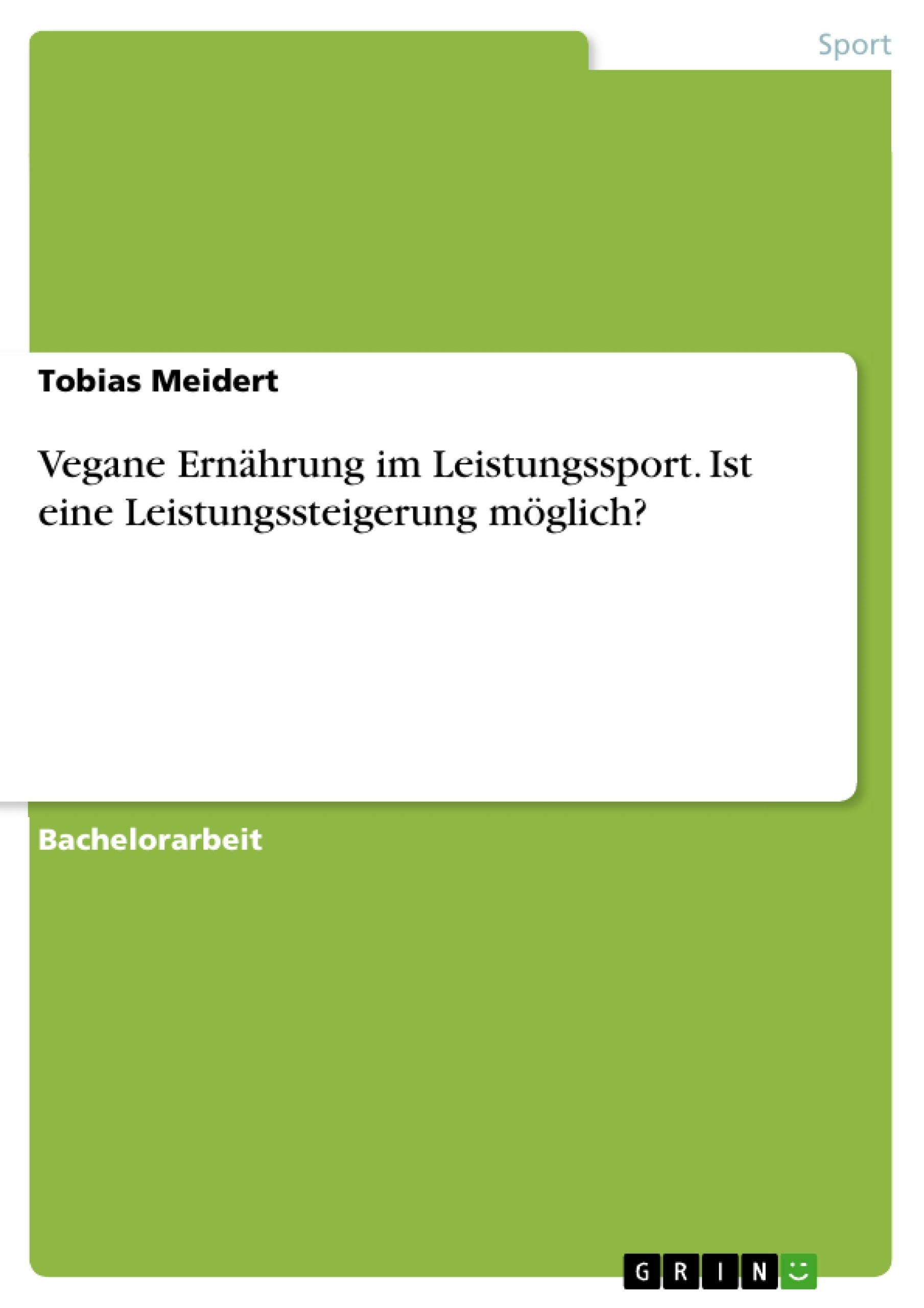Vegane Ernährung. Ein neuer Trend, der immer mehr Menschen anzieht. Was geht diese Ernährungsweise? Welche Arten davon gibt es? Die Arten der Ernährungsweise werden dargelegt, sowie die ernährungsphysiologische Grundlage. Gleichzeitig wird die vegane Ernährungsweise im Hinblick auf Leistungssport untersucht.
Die vegane Ernährungsweise hat eine weit zurückreichende Geschichte. So versuchten schon die Gladiatoren im alten Rom, sich hauptsächlich pflanzlich zu ernähren. Immer wieder kam diese Art der Ernährung auf, bis hin ins späte 20. Jahrhundert, als es noch bis vor dreißig bis vierzig Jahren als sehr exotisch und anormal galt, wenn auf Fleisch verzichtet wurde (Kriegszeiten ausgenommen). In den letzten Jahren aber bekam die vegane Ernährungsweise einen enormen Zulauf und wurde immer mehr zum Trend, was man auch an der erhöhten Publikation von Büchern zur veganen Ernährungsweise ablesen kann. Anfangs lag die Motivation in rein ethischer (Tierwohl) und religiöser Natur, wobei in den letzten zwei Jahren immer mehr gesundheitliche und ökologische Gründe (Umweltschutz) hinzukamen. Vor allem im Leistungssport gilt die vorherrschende Meinung, dass eine vegane Ernährungsweise eher kontraproduktiv in Bezug auf eine erwünschte Leistungssteigerung wirken würde. Erst die mediale Aufmerksamkeit, die mehrere Profisportler durch ihre Umstellung auf vegane Ernährung erzeugt haben, führte zu einem Umdenken. Dadurch, dass die Zahl der Veganer in der Bevölkerung und im Leistungssport stetig angestiegen ist, wurde die Wissenschaft immer mehr aktiv, indem sie spezifische Studien startete.
Im Zuge dessen wurde in letzter Zeit immer mehr der Frage nachgegangen, ob und vor allem inwiefern vegane Ernährung im Leistungssport möglich sei, vielleicht sogar eine Leistungssteigerung hervorrufe. Zu dieser Frage wird in der nachfolgenden Arbeit ein Überblick über die aktuelle wissenschaftliche Lage gegeben; ebenso wird ein Blick in die Praxis geworfen, indem Erfahrungen ausgewählter Leistungssportler zusammengetragen und ausgewertet werden. Das Hauptproblem muss gleich vorneweg genannt werden: Da es eine sehr "junge" Fragestellung ist, gibt es nur eine geringe Anzahl von Untersuchungen in diesem Bereich; dabei wurde mittlerweile vor allem zur vegetarischen Ernährung im Leistungssport publiziert, jedoch zur veganen Ernährung kaum (immerhin die Pilotstudie des ASV Dachau).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Vegane Ernährung
- 2.1 Kurze Historie veganer Ernährungsweisen
- 2.2 Definition der veganen Ernährung und die verschiedenen Arten
- 3 Wissenschaftliche Studienlage
- 4 Ernährungsphysiologische Erkenntnisse in Bezug auf Sport/Leistungssport
- 4.1 Kohlenhydrate und Proteine
- 4.2 Fette
- 4.3 Vitamine
- 4.4 Vitaminoide
- 4.5 Mineralstoffe
- 4.6 Sekundäreffekte
- 4.7 „Ernährungsteller“/DGE
- 5 Hinweise aus der Praxis/Erfahrungsberichte ausgewählter Leistungssportler
- 5.1 Brendan Brazier (Ausdauersport)
- 5.2 Patrick Baboumian (Kraftsport)
- 5.3 Novak Djokovic
- 5.4 ASV Dachau-Volleyball
- 5.5 Bewertung
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen veganer Ernährung im Leistungssport. Ziel ist es, einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu geben und diesen mit praktischen Erfahrungen von Leistungssportlern zu vergleichen. Die Arbeit beleuchtet die Frage, ob und inwiefern vegane Ernährung im Leistungssport leistungsfördernd sein kann.
- Historische Entwicklung veganer Ernährung
- Definition und verschiedene Ausprägungen veganer Ernährung
- Ernährungsphysiologische Aspekte veganer Ernährung im Leistungssport
- Erfahrungsberichte von Leistungssportlern mit veganer Ernährung
- Aktuelle wissenschaftliche Studienlage zur veganen Ernährung im Leistungssport
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung skizziert die historische Entwicklung der veganen Ernährung, von ihren Anfängen bis zum aktuellen Trend. Sie hebt den scheinbaren Widerspruch zwischen der vorherrschenden Meinung über die Leistungsminderung durch vegane Ernährung im Leistungssport und dem Umdenken, ausgelöst durch mediale Aufmerksamkeit auf erfolgreiche vegan lebende Profisportler hervor. Die Arbeit kündigt ihren Fokus auf die aktuelle wissenschaftliche Lage und die Auswertung praktischer Erfahrungen an, wobei die begrenzte Anzahl von Studien in diesem Bereich hervorgehoben wird.
2 Vegane Ernährung: Dieses Kapitel beleuchtet die traditionelle Motivation hinter veganer Ernährung (ethisch-moralische Gründe), im Gegensatz zu den oft situativ bedingten pflanzlichen Ernährungsformen in Entwicklungsländern. Es werden unterschiedliche Schätzungen zum Anteil vegan lebender Menschen in Deutschland genannt und führt in die kurze Historie der veganen Ernährung ein, beginnend mit dem Begriff „vegetarisch“ und dessen Entwicklung bis hin zum Begriff „vegan“ durch Donald Watson im Jahre 1944. Das Kapitel zeigt die Entwicklung vom anfänglichen Fokus auf ethische und religiöse Motive hin zu den gesundheitlichen und ökologischen Aspekten in der heutigen Zeit auf.
2.2 Definition der veganen Ernährung und die verschiedenen Arten: Dieses Kapitel definiert die vegane Ernährung anhand der rechtsverbindlichen Definition der Verbraucherschutzministerkonferenz von 2016. Es hebt die Bedeutung der ethisch-moralischen Komponente neben den gesundheitlichen Aspekten hervor und erläutert die Entstehung verschiedener Untergruppen und Ausprägungen veganer Ernährungsweisen, die sich von konsequentem Veganismus bis hin zu flexibleren Formen wie dem „Flexigananismus“ erstrecken.
Häufig gestellte Fragen: Vegane Ernährung im Leistungssport
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen veganer Ernährung im Leistungssport. Sie beleuchtet die Frage, ob und inwiefern vegane Ernährung im Leistungssport leistungsfördernd sein kann.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst die historische Entwicklung veganer Ernährung, Definitionen und verschiedene Ausprägungen veganer Ernährungsweisen, ernährungsphysiologische Aspekte veganer Ernährung im Leistungssport, Erfahrungsberichte von Leistungssportlern mit veganer Ernährung und die aktuelle wissenschaftliche Studienlage dazu.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Vegane Ernährung (inkl. Historie und Definition verschiedener Arten), Wissenschaftliche Studienlage, Ernährungsphysiologische Erkenntnisse in Bezug auf Sport/Leistungssport (inkl. Kohlenhydrate, Proteine, Fette, Vitamine, Vitaminoide, Mineralstoffe, Sekundäreffekte und den Ernährungsteller der DGE), Hinweise aus der Praxis/Erfahrungsberichte ausgewählter Leistungssportler (inkl. Brendan Brazier, Patrick Baboumian, Novak Djokovic, ASV Dachau-Volleyball und einer Bewertung) und Fazit.
Wie wird die vegane Ernährung definiert?
Die Arbeit verwendet die rechtsverbindliche Definition der Verbraucherschutzministerkonferenz von 2016 zur Definition veganer Ernährung. Es wird die ethisch-moralische Komponente neben den gesundheitlichen Aspekten hervorgehoben.
Welche Ernährungsphysiologischen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Kohlenhydraten, Proteinen, Fetten, Vitaminen, Vitaminoiden und Mineralstoffen im Zusammenhang mit veganer Ernährung im Leistungssport. Sekundäreffekte und der „Ernährungsteller“ der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) werden ebenfalls behandelt.
Werden Erfahrungsberichte von Leistungssportlern berücksichtigt?
Ja, die Arbeit beinhaltet Erfahrungsberichte von verschiedenen Leistungssportlern, darunter Brendan Brazier (Ausdauersport), Patrick Baboumian (Kraftsport), Novak Djokovic und dem ASV Dachau-Volleyball. Diese Berichte werden bewertet.
Wie lautet die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zur veganen Ernährung im Leistungssport zu geben und diesen mit praktischen Erfahrungen von Leistungssportlern zu vergleichen.
Welche Einschränkungen der Studienlage werden angesprochen?
Die Arbeit weist auf die begrenzte Anzahl von Studien zu veganer Ernährung im Leistungssport hin.
Welche verschiedenen Ausprägungen veganer Ernährung werden genannt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Ausprägungen, von konsequentem Veganismus bis hin zu flexibleren Formen wie dem „Flexigananismus“.
Wie wird die historische Entwicklung der veganen Ernährung dargestellt?
Die Arbeit skizziert die historische Entwicklung von den Anfängen über die Entstehung des Begriffs „vegetarisch“ und „vegan“ (durch Donald Watson 1944) bis zum heutigen Trend. Sie zeigt die Entwicklung der Motive von ethisch-religiösen hin zu gesundheitlichen und ökologischen Aspekten auf.
- Quote paper
- Tobias Meidert (Author), 2020, Vegane Ernährung im Leistungssport. Ist eine Leistungssteigerung möglich?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1267990