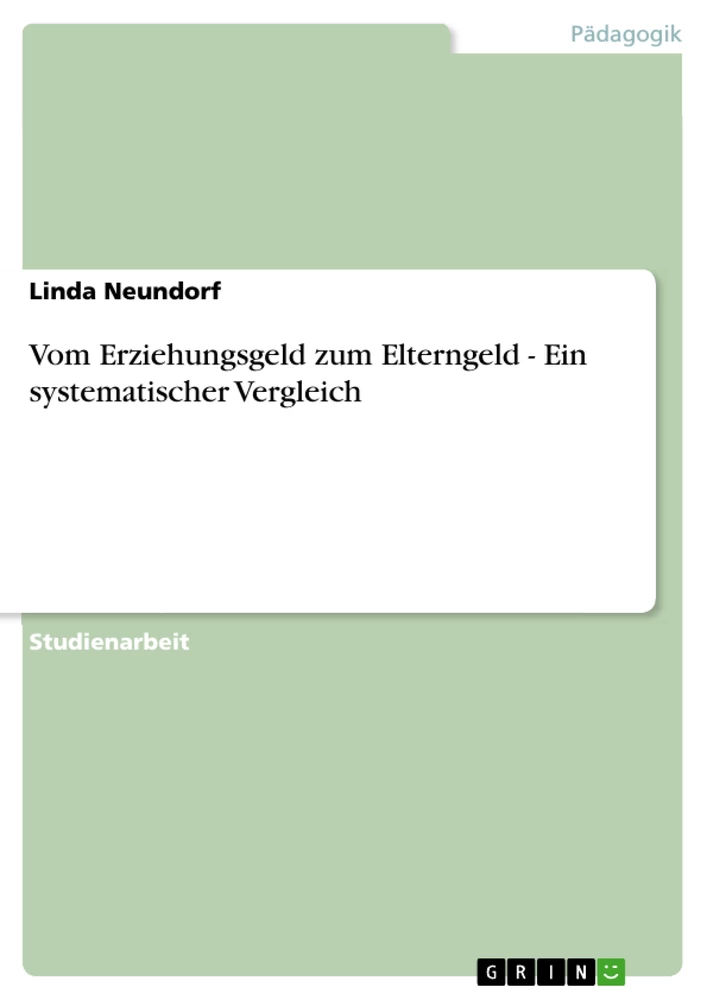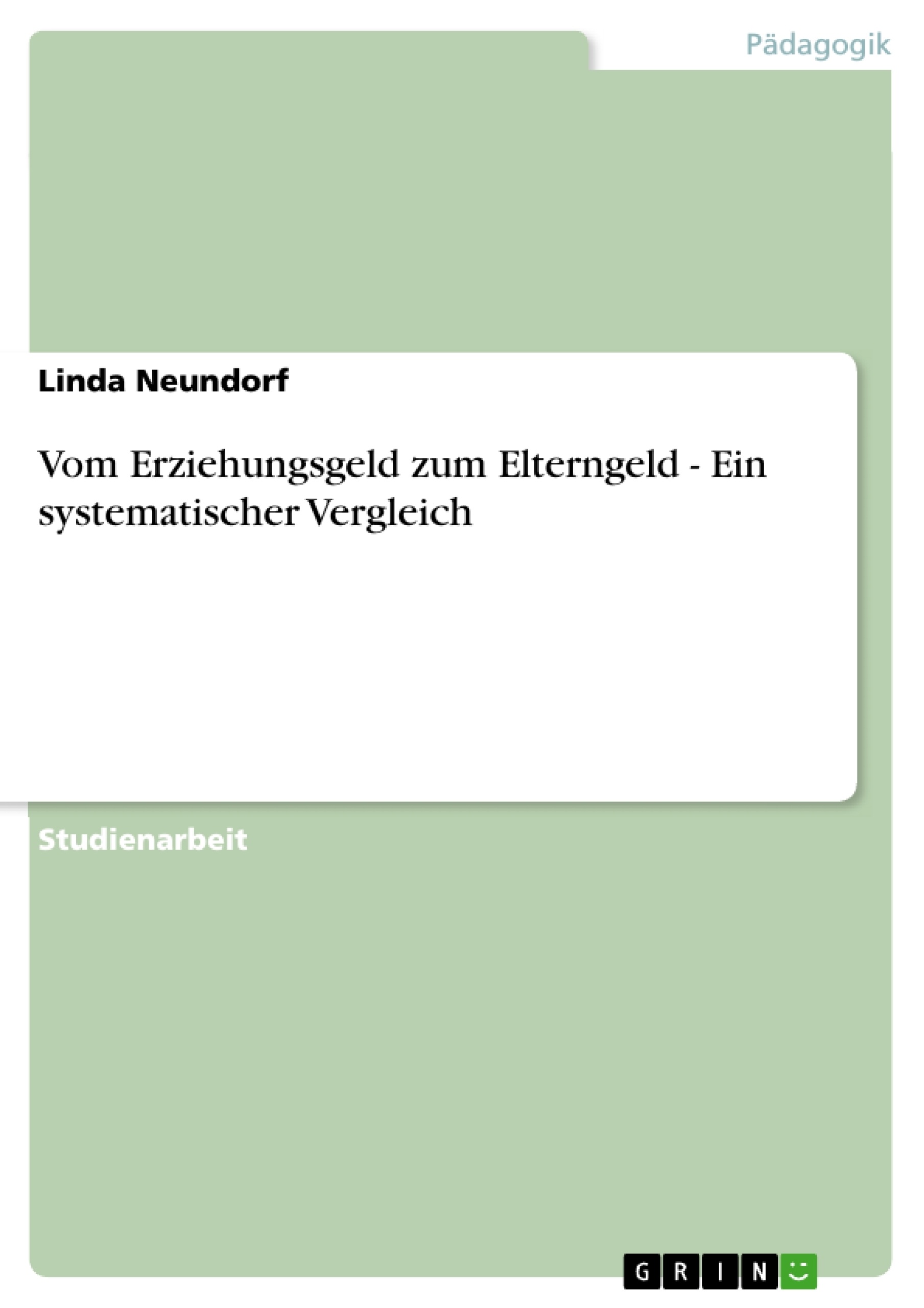„Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik hat die Familienpolitik eine so zentrale Rolle gespielt wie in der Gegenwart. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht debattiert wird über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Schaffung neuer Betreuungsplätze oder bessere Bildungsangebote in Kindergärten, Schulen und Hochschulen.“ (Votsmeier 2007, S. V) An diesen anhaltenden Diskussionen ist kein „Vorbeikommen“, vor allem nicht als Pädagogikstudentin. Die letzte, sehr populäre und in den Medien sehr verbreitete Debatte, galt der Einführung des Elterngeldes am 01.01.2007. Hierbei wurde die soziale Ungerechtigkeit des Elterngeldes im Vergleich zu Erziehungsgeld diskutiert. Die Stichtagregelung wurde kritisiert und auch die Regelung der so genannten Vätermonate wurde erörtert.
Durch diese Streitgespräche bin ich auf Fragen gestoßen, die ich innerhalb dieser Arbeit klären möchte. Zum einem möchte ich die rechtlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Familienleistungen herausstellen und die Frage klären, wer die Verlierer und Gewinner des Überganges vom Erziehungsgeld zum Elterngeld sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinitionen
- Das Erziehungsgeld
- Zielsetzung
- Anspruchsberechtigte
- Dauer des Bezuges
- Höhe des Erziehungsgeldes und Einkommensgrenzen
- Berechnung des Einkommens
- Antrag
- Das Elterngeld
- Zielsetzung
- Anspruchsberechtigte
- Dauer des Bezuges
- Höhe des Elterngeldes
- Berechnung des Einkommens
- Antrag
- Erziehungsgeld versus Elterngeld
- Zielsetzung
- Anspruchsberechtigte
- Dauer des Bezuges
- Höhe der finanziellen Leistung
- Berechnung des Einkommens
- Antrag
- Fazit und Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Familienleistungen Erziehungsgeld und Elterngeld systematisch zu vergleichen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede aufzuzeigen. Besonders im Fokus steht die Frage nach den Gewinnern und Verlierern des Übergangs vom Erziehungsgeld zum Elterngeld.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe Erziehungsgeld und Elterngeld
- Vergleich der Anspruchsvoraussetzungen beider Leistungen
- Analyse der Höhe und Berechnung der finanziellen Unterstützung
- Untersuchung der Dauer des Leistungsbezugs
- Bewertung der familienpolitischen Ziele beider Systeme
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den aktuellen Diskurs um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Deutschland und führt die Einführung des Elterngeldes als Anlass für diese Arbeit an. Die Autorin kündigt die Klärung rechtlicher Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Leistungen sowie die Identifizierung von Gewinnern und Verlierern des Systemwechsels an. Die Struktur der Arbeit wird skizziert, mit der Definition grundlegender Begriffe im ersten Teil und anschließendem Vergleich der beiden Systeme.
Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel klärt zentrale Begriffe wie Erziehungsgeld (einkommensabhängige, steuerfinanzierte Leistung), Regelmodell und Budgetmodell (verschiedene Auszahlungsarten des Erziehungsgeldes), Einkommensgrenzen (abhängig von Auszahlungsmodell und Kindesalter), Werbungskostenpauschbetrag/Arbeitnehmerpauschbetrag (Anrechnung auf Erziehungsgeld und Elterngeld) und Elterngeld (Ersatz für wegfallendes Erwerbseinkommen) und Partner-/Vätermonate (zusätzliche Bezugsdauer bei Beteiligung des zweiten Elternteils).
Das Erziehungsgeld: Dieses Kapitel beschreibt das Bundeserziehungsgeldgesetz (BErzGG), gültig bis 31.12.2006. Es erläutert die Zielsetzung des Erziehungsgeldes als Anerkennung der Erziehungsleistung und Unterstützung arbeitender Eltern. Die Anspruchsberechtigung wird detailliert dargestellt, inklusive der Kriterien Wohnsitz, Personensorge, Kindesbetreuung und Erwerbstätigkeit. Die verschiedenen Aspekte wie Dauer, Höhe und Berechnung des Erziehungsgeldes sowie die Antragstellung werden thematisiert.
Schlüsselwörter
Erziehungsgeld, Elterngeld, Familienpolitik, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Sozialleistungen, Einkommensgrenzen, Anspruchsberechtigung, Familienleistungen, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Vergleich von Erziehungsgeld und Elterngeld
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht systematisch die Familienleistungen Erziehungsgeld und Elterngeld in Deutschland. Sie beleuchtet Gemeinsamkeiten und Unterschiede und analysiert insbesondere die Auswirkungen des Übergangs vom Erziehungsgeld zum Elterngeld auf betroffene Familien.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst Definitionen der Begriffe Erziehungsgeld und Elterngeld, einen Vergleich der Anspruchsvoraussetzungen, eine Analyse der Höhe und Berechnung der Leistungen, eine Untersuchung der Bezugsdauer und eine Bewertung der familienpolitischen Ziele beider Systeme. Sie beleuchtet auch die Gewinner und Verlierer des Systemwechsels.
Wie sind die Inhalte strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, gefolgt von einer Klärung der zentralen Begriffe. Es folgen Kapitel zum Erziehungsgeld und zum Elterngeld, die jeweils die Zielsetzung, Anspruchsberechtigung, Bezugsdauer, Höhe und Berechnung der Leistungen sowie die Antragstellung behandeln. Ein abschließendes Kapitel vergleicht beide Systeme und zieht ein Fazit.
Was wird unter Erziehungsgeld verstanden?
Erziehungsgeld ist eine einkommensabhängige, steuerfinanzierte Leistung, die bis Ende 2006 gezahlt wurde. Es gab verschiedene Auszahlungsmodelle (Regelmodell und Budgetmodell) mit unterschiedlichen Einkommensgrenzen, abhängig vom Kindesalter. Werbungskostenpauschbetrag und Arbeitnehmerpauschbetrag konnten angerechnet werden.
Was wird unter Elterngeld verstanden?
Elterngeld ist ein Ersatz für wegfallendes Erwerbseinkommen. Es wird an Eltern gezahlt, die nach der Geburt ihres Kindes für eine bestimmte Zeit ihre Erwerbstätigkeit reduzieren oder unterbrechen. Es beinhaltet die Möglichkeit von Partner-/Vätermonaten.
Welche Kriterien sind für den Bezug von Erziehungsgeld relevant?
Für den Bezug von Erziehungsgeld waren Kriterien wie Wohnsitz, Personensorge, Kindesbetreuung und Erwerbstätigkeit relevant. Die genauen Bedingungen waren im Bundeserziehungsgeldgesetz (BErzGG) geregelt.
Welche Kriterien sind für den Bezug von Elterngeld relevant?
Die Anspruchsvoraussetzungen für Elterngeld werden in der Arbeit detailliert beschrieben, sind aber im Vergleich zum Erziehungsgeld anders gelagert und fokussieren stärker auf den Ersatz des wegfallenden Einkommens.
Wie werden Erziehungsgeld und Elterngeld berechnet?
Die Berechnung des Erziehungsgeldes und des Elterngeldes wird in der Arbeit detailliert erläutert, wobei die jeweiligen Berechnungsmethoden und die Berücksichtigung des Einkommens im Vordergrund stehen. Es werden Unterschiede im Berechnungsansatz zwischen den beiden Systemen aufgezeigt.
Wie lange konnten Erziehungsgeld und Elterngeld bezogen werden?
Die Bezugsdauer des Erziehungsgeldes und des Elterngeldes unterschied sich und ist ein zentraler Vergleichspunkt der Arbeit. Die jeweiligen Bezugsdauern werden in den entsprechenden Kapiteln detailliert beschrieben.
Welche familienpolitischen Ziele verfolgen Erziehungsgeld und Elterngeld?
Die Arbeit analysiert die familienpolitischen Ziele beider Systeme und vergleicht diese miteinander. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Schwerpunkte und die beabsichtigten Auswirkungen auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Wer waren die Gewinner und Verlierer beim Übergang vom Erziehungsgeld zum Elterngeld?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen des Systemwechsels und identifiziert die Familien, die vom Übergang zum Elterngeld profitierten, und jene, die benachteiligt wurden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Erziehungsgeld, Elterngeld, Familienpolitik, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Sozialleistungen, Einkommensgrenzen, Anspruchsberechtigung, Familienleistungen, Deutschland.
- Quote paper
- Linda Neundorf (Author), 2008, Vom Erziehungsgeld zum Elterngeld - Ein systematischer Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126769