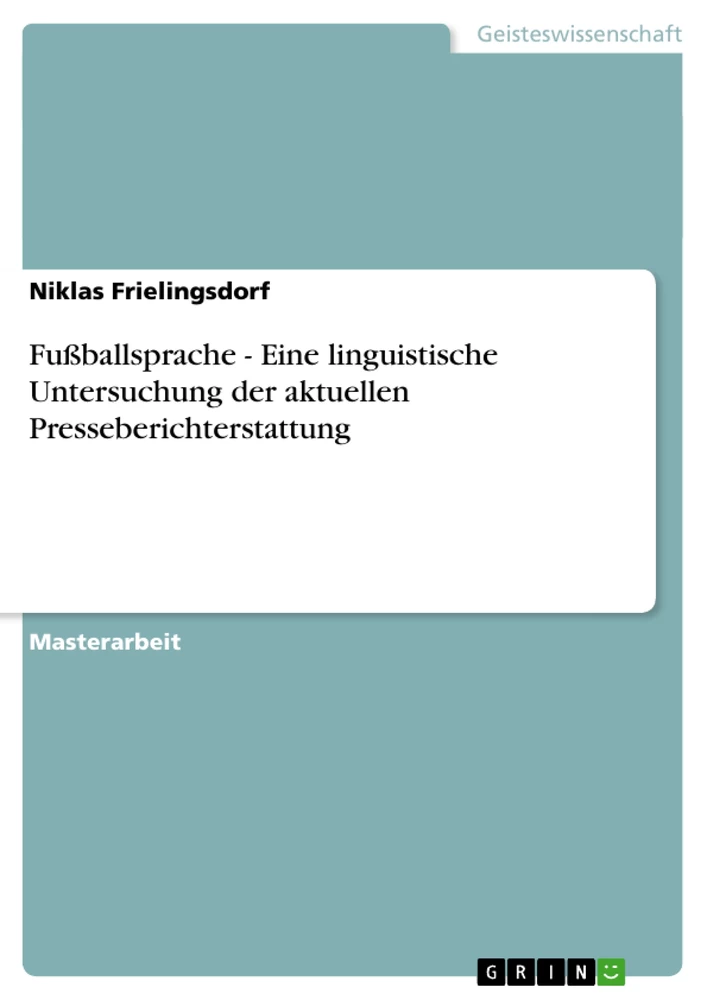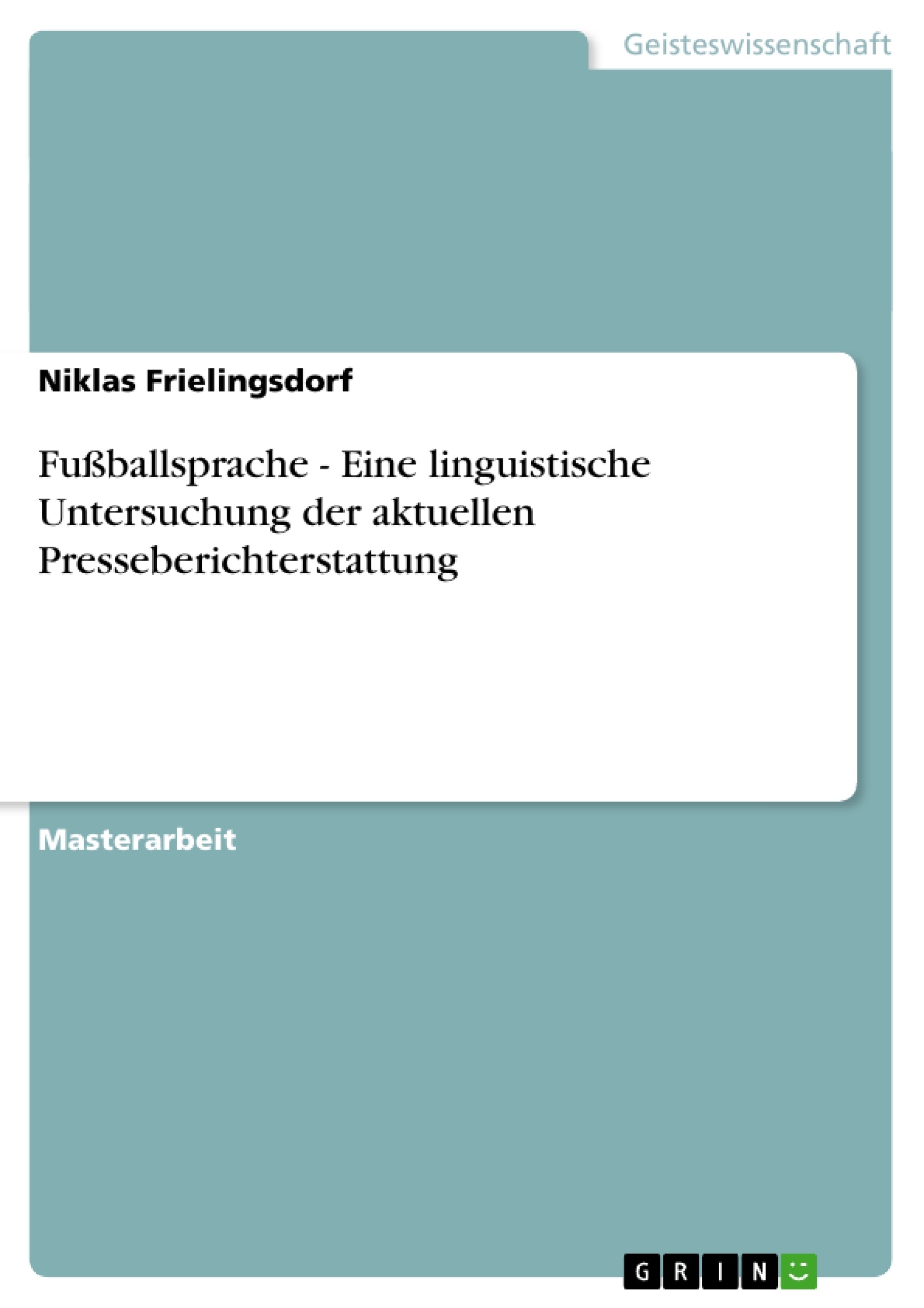„Die schönste Nebensache der Welt“, „Volkssport Nummer eins“ oder „König Fußball“, der immense Beliebtheitsgrad des Fußballsports ist nicht nur in den zahlreichen liebevollen Umschreibungen durch Fußballinteressierte zu erkennen, sondern ebenfalls durch die Entwicklung einer eigenen (Fach-)Sprache dieser Sportart. (Fragwürdige) Metaphern, (befremdliche) Wortneubildungen und andere sprachliche Erscheinungsformen haben durch Expertenanalysen, Fandiskussionen sowie Äußerungen der Aktiven auf dem Spielfeld im Laufe der Zeit ein manchmal undurchdringbares „Sprachknäuel“ gebildet, das vor allem durch die Printmedien immer größere Verbreitung erfahren hat. Die Faszination des scheinbar so einfach zu begreifenden Sports findet dabei in der Kommunikation nur selten eine entsprechende und lapidare Äußerungsform.
Diese Arbeit versucht, einen Blick auf die Entwicklung der Sprache rund um das runde Leder zu werfen. Der Fokus ist hier auf die sprachliche Entwicklung der Presseberichterstattung gerichtet, die die Fußball-Kommunikation, die Fußballsprache am intensivsten beeinflusst und verbreitet hat. Die zarten (sprachlichen) Anfänge der Fußballberichterstattung, die mit der wachsenden Popularität dieser Sportart einher gingen, sollen bis zum heutigen Tag nachgezeichnet werden. Eine Analyse der aktuellen Fußballberichterstattung in verschiedenen Zeitungen bildet dabei den Kern dieser Arbeit, ordnet ein und bewertet die fußballsprachliche Entwicklung und die aktuelle Fußballsprache der Presse bis zum heutigen Tag.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Fußballsprache als ein Gebilde aus drei Teilbereichen
- 2. Gesellschaftliche und geschichtliche Einflüsse und Entwicklungen
- 2.1 Die,,Geburtsstunde“ des Fußballs in Deutschland und der Beginn des Fußball-Vokabulars
- 2.2 Entstehung der Fachsprache durch die Popularität des Fußballs
- 3. Warum Fußball eine Fachsprache ist
- 3.1 Drei grundlegende semantische Prinzipien
- 3.1.1 Metonymie
- 3.1.2 Metapher
- 3.1.3 Simplifizierende Abstraktion
- 4. Fußballsprache als Komplex aus drei Teilbereichen
- 4.1 Wechselwirkung der fußballsprachlichen Teilbereiche
- 5. Einflüsse anderer (Fach-)Sprachen auf die Fußballsprache
- 5.1 Einfluss von Anglizismen
- 5.2 Einfluss von Fachsprachen anderer Sportarten
- 5.3 Einfluss von Fachsprachen von Musik, Theater und Spielen
- 5.4 Einfluss von Kriegsbegriffen und der Fachsprache des Militärs
- 5.5 Einfluss der Fachsprache des Fachbereichs Technik
- 6. Die Beeinflussung der Fußballsprache durch die Gemeinsprache
- 6.1 Die Beeinflussung der Gemeinsprache durch die Fußballsprache
- 7. Geschichte und Entwicklung der Fußball-Berichterstattung in der Presse
- 7. 1 Die (Fußball-)Sprache der Presseberichterstattung
- 7.2 Unterscheidung von Positions-, Tabellen- und Spielsprache innerhalb der Sprache der Presseberichterstattung
- 7.2.1 Positionssprache
- 7.2.2 Tabellensprache
- 7.2.3 Spielsprache
- 7.3 Inhalte der Berichterstattung
- 7.4 Merkmale des Stils der Reportsprache
- 7.4.1 Metaphern und Beiwörter
- 7.4.2 Worthülsen als „,k,,Klassiker"
- 7.4.3 Zwischen „Verbrüderung“ und Distanzierung von Sportler, Redakteur und Rezipient
- 7.4.4 Monotonie
- 7.4.5 Superlativische, hyperbolische Ausdrucksweise
- 7.5 Zusammenfassende Überlegungen zu den stilistischen Merkmalen der Reportsprache
- 7.6 Die Kritik an der Fußballberichterstattung
- 7.6.1 Übermäßiger Gebrauch von Metaphern und Fremdwörtern
- 7.6.2 Fußballspiele als „Ersatzkriege“
- 8. Erklärungen und Relativierungen der Kritik -Begrenzte Autonomie und Zeitdruck vs. Versuche der Vermeidung von Monotonie
- 9. Schlussbemerkung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit befasst sich mit der Entwicklung der Fußballsprache, insbesondere im Kontext der Presseberichterstattung. Ziel ist es, die sprachlichen Veränderungen und Besonderheiten der Fußballsprache im Laufe der Zeit zu analysieren und zu bewerten. Dabei wird der Fokus auf die aktuelle Fußballberichterstattung in verschiedenen Zeitungen gelegt, um die Entwicklung der Sprache und die aktuellen Merkmale der Reportsprache zu beleuchten.
- Entwicklung der Fußballsprache im Kontext der Presseberichterstattung
- Analyse der aktuellen Fußballberichterstattung in verschiedenen Zeitungen
- Merkmale der Reportsprache, wie Metaphern, Worthülsen und Stilmittel
- Kritik an der Fußballberichterstattung und deren Relativierung
- Einflüsse anderer Sprachen und Fachsprachen auf die Fußballsprache
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Fußballsprache ein und erläutert die Relevanz der Presseberichterstattung für die Entwicklung dieser Fachsprache. Kapitel 1 definiert den Begriff „Fußballsprache“ und stellt die drei Teilbereiche Sportjargon, Sprache der Sportberichterstattung und Sach- und Regelsprache des Sports vor. Kapitel 2 beleuchtet die gesellschaftlichen und geschichtlichen Einflüsse auf die Entwicklung der Fußballsprache, beginnend mit der „Geburtsstunde“ des Fußballs in Deutschland. Kapitel 3 untersucht die Gründe, warum Fußball eine Fachsprache ist, und analysiert drei grundlegende semantische Prinzipien: Metonymie, Metapher und Simplifizierende Abstraktion. Kapitel 4 beleuchtet die Wechselwirkung der drei Teilbereiche der Fußballsprache und zeigt die Komplexität dieser Fachsprache auf. Kapitel 5 untersucht die Einflüsse anderer Sprachen und Fachsprachen auf die Fußballsprache, wie Anglizismen, Fachsprachen anderer Sportarten, Musik, Theater und Spiele, Kriegsbegriffe und die Fachsprache des Militärs sowie die Fachsprache des Fachbereichs Technik. Kapitel 6 analysiert die Beeinflussung der Fußballsprache durch die Gemeinsprache und umgekehrt. Kapitel 7 befasst sich mit der Geschichte und Entwicklung der Fußball-Berichterstattung in der Presse, wobei die Sprache der Presseberichterstattung, die Unterscheidung von Positions-, Tabellen- und Spielsprache sowie die Inhalte der Berichterstattung im Fokus stehen. Kapitel 7.4 analysiert die Merkmale des Stils der Reportsprache, wie Metaphern, Worthülsen, „Verbrüderung“ und Distanzierung von Sportler, Redakteur und Rezipient, Monotonie und superlativische, hyperbolische Ausdrucksweise. Kapitel 7.5 fasst die stilistischen Merkmale der Reportsprache zusammen und Kapitel 7.6 beleuchtet die Kritik an der Fußballberichterstattung, insbesondere den übermäßigen Gebrauch von Metaphern und Fremdwörtern sowie die Darstellung von Fußballspielen als „Ersatzkriege“. Kapitel 8 erklärt und relativiert die Kritik an der Fußballberichterstattung, indem es die begrenzte Autonomie und den Zeitdruck der Reporter sowie die Versuche der Vermeidung von Monotonie in den Vordergrund stellt. Die Schlussbemerkung fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsfelder.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Fußballsprache, die Presseberichterstattung, die Entwicklung der Sprache, die Merkmale der Reportsprache, die Kritik an der Fußballberichterstattung, die Einflüsse anderer Sprachen und Fachsprachen, die Metonymie, die Metapher, die Simplifizierende Abstraktion, die Anglizismen, die Fachsprachen anderer Sportarten, die Kriegsbegriffe, die Fachsprache des Militärs, die Fachsprache des Fachbereichs Technik, die Gemeinsprache, die Positions-, Tabellen- und Spielsprache, die Inhalte der Berichterstattung, die Worthülsen, die „Verbrüderung“ und Distanzierung von Sportler, Redakteur und Rezipient, die Monotonie, die superlativische, hyperbolische Ausdrucksweise und die begrenzte Autonomie und der Zeitdruck der Reporter.
- Quote paper
- Niklas Frielingsdorf (Author), 2008, Fußballsprache - Eine linguistische Untersuchung der aktuellen Presseberichterstattung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126767