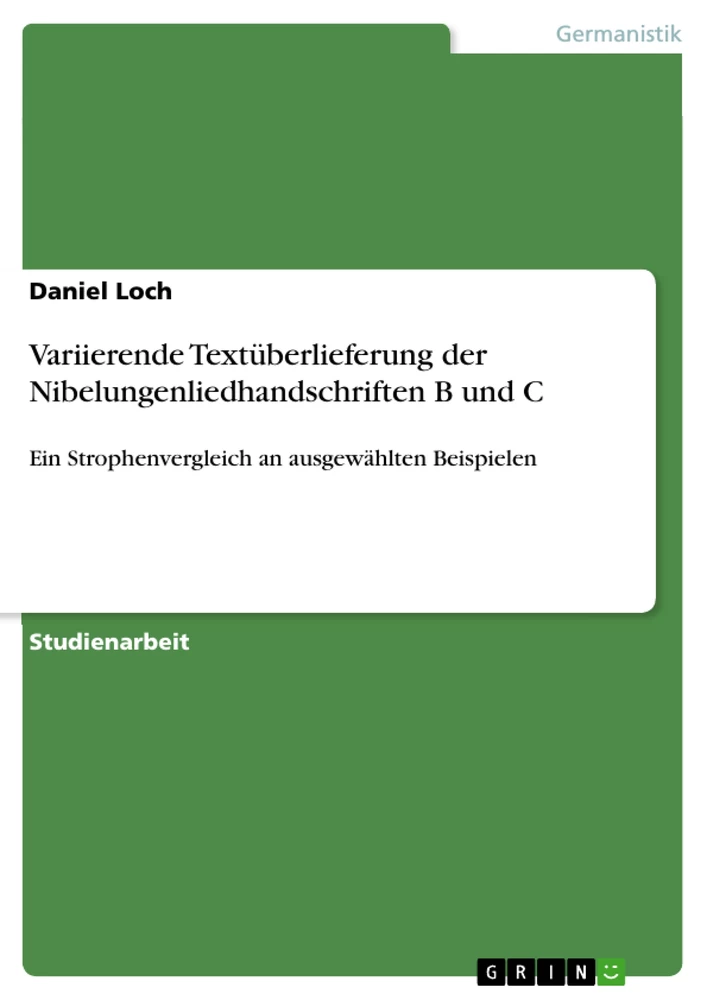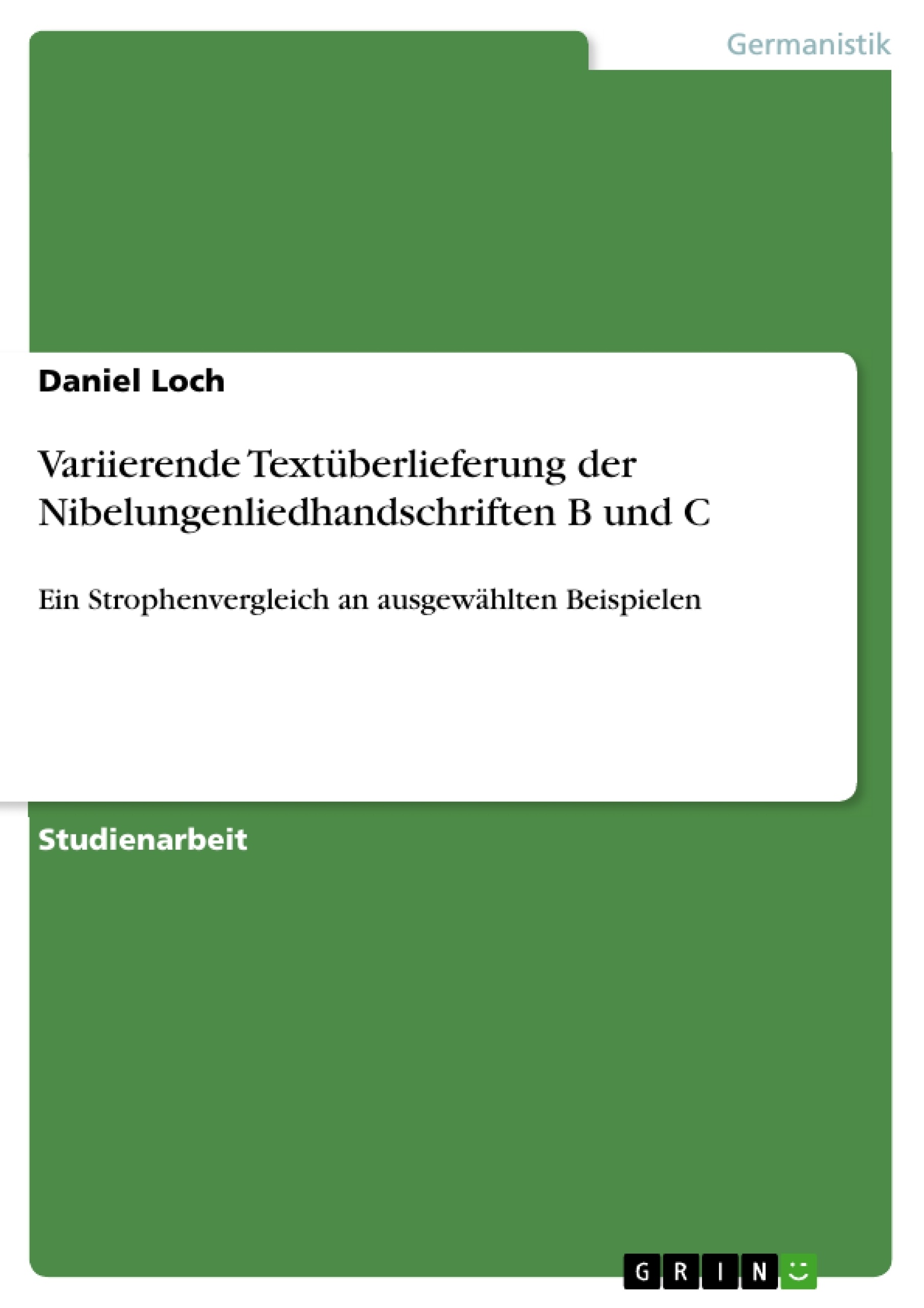Es ist nicht der Regelfall, dass mittelalterliche Literatur in einer festen Überlieferung vorliegt, auch wenn Heldendichtungen in der Rezeptionspraxis für institutionelle Zwecke (z.B. den Deutschunterricht) aufgrund ihrer Komplexität unter einem beschränkten textkritischen Blickwinkel gelesen werden. Ebenso ist mit dem Nibelungenlied das wohl populärste deutsche Heldenepos in mehrfacher Überlieferung verfügbar. Insoweit muss seine wissenschaftliche Betrachtung als geschlossenes und gebildehaftes Werk mit Vorsicht genossen werden. Diese Asymmetrie wirft viele Fragen auf, von denen die meisten bis heute nicht eindeutig geklärt werden konnten: Gibt es mehrere Autoren, die unterschiedliche Texte verfasst haben, oder lassen sich alle Handschriften auf denselben Autor zurückführen? Sind die buchepischen Verschriftlichungen Auslaufformen mündlicher Vorgängerfassungen? Unterscheiden sich die Fassungen in ihren narrativen Strukturen und erzwingen sie damit unterschiedliche hermeneutische Herangehensweisen?
Letztere soll die Leitfrage dieser Arbeit sein, wobei eine Beschränkung auf die Nibelungenliedhandschriften B und C erforderlich ist, um den Rahmen dieser Analyse nicht zu sprengen. In einem vergleichenden Analyseverfahren sollen die divergierenden narrativen Schemata der Fassungen *B und *C an ausgewählten Aventiure- und Strophenbeispielen herausgearbeitet und ferner ihre unterschiedlichen Konzeptionierungen offengelegt werden.
Zunächst bedarf es jedoch der Klärung, welche Voraussetzungen notwendig sind, um mittelalterliche Texte eingehend studieren zu können, damit auf dieser Grundlage erzähltechnische Textdiskrepanzen zum Vorschein gelangen. Dazu sollen im Folgenden signifikante Unterschiede des modernen und mittelalterlichen Textualitätsverständnis gegenübergestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Textualität
- 2.1 Textualitätsverständnis der Moderne
- 2.2 Textualitätsverständnis des Mittelalters
- 3. Vergleich ausgewählter Nibelungenliedstrophen aus den Handschriften B und C
- 3.1 Strophenvergleiche aus der 6. – 9. Aventiure: Siegfried vs. Hagen von Tronje
- 3.2 Strophenvergleiche aus der 31.-33. Aventiure: Kriemhilds Schuld am Tod Ortliebs
- 4. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die variierende Textüberlieferung der Nibelungenliedhandschriften B und C. Die Leitfrage ist, inwiefern die divergierenden narrativen Schemata der Fassungen B und C unterschiedliche hermeneutische Herangehensweisen erzwingen. Die Analyse konzentriert sich auf ausgewählte Strophen, um die unterschiedlichen Konzeptionierungen der beiden Fassungen aufzuzeigen. Dabei werden zunächst die Unterschiede im modernen und mittelalterlichen Textualitätsverständnis geklärt.
- Vergleich der Textüberlieferungen der Nibelungenliedhandschriften B und C
- Analyse der narrativen Schemata in den ausgewählten Strophen
- Untersuchung der unterschiedlichen Konzeptionierungen in den Fassungen B und C
- Klärung des modernen und mittelalterlichen Textualitätsverständnisses
- Herausarbeitung der Implikationen für die Interpretation des Nibelungenlieds
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Auswirkungen unterschiedlicher Textüberlieferungen auf die Interpretation des Nibelungenlieds vor. Sie problematisiert die Annahme eines festen, autornahen Textes im Mittelalter und betont die Vielfältigkeit der Überlieferungsformen des Nibelungenlieds, insbesondere die Handschriften B und C. Der Fokus der Arbeit wird auf den Vergleich dieser beiden Fassungen gelegt, um deren divergierende narrative Schemata und Konzeptionierungen aufzuzeigen. Die Notwendigkeit, das mittelalterliche und moderne Textverständnis zu differenzieren, um erzähltechnische Diskrepanzen zu analysieren, wird ebenfalls hervorgehoben.
2. Textualität: Dieses Kapitel vergleicht das moderne und mittelalterliche Textverständnis. Es beginnt mit der Feststellung, dass mittelalterliche Texte für moderne Leser oft schwer verständlich sind, da sie sich von modernen Textkonzeptionen deutlich unterscheiden. Der moderne Textbegriff wird anhand linguistischer Definitionen erläutert, die die Kohärenz und kommunikative Funktion von Texten betonen und die Bedeutung von Sinnzusammenhängen und Handlungsstrukturen hervorheben. Im Gegensatz dazu wird die Andersartigkeit mittelalterlicher Texte beschrieben, die auf einer unterschiedlichen Auffassung von Textualität und Erzählstrukturen beruht. Der Unterschied zwischen faktualem und fiktionalem Erzählen sowie die Komplexität des modernen Textverständnisses werden diskutiert.
3. Vergleich ausgewählter Nibelungenliedstrophen aus den Handschriften B und C: Dieses Kapitel beinhaltet einen detaillierten Vergleich ausgewählter Strophen aus den Handschriften B und C. Es analysiert die unterschiedlichen narrativen Schemata und Konzeptionierungen in den ausgewählten Aventiuren. Der Vergleich soll zeigen, wie die verschiedenen Überlieferungen zu unterschiedlichen Interpretationen der Handlung und der Figuren führen können. Die Analyse beleuchtet die spezifischen Unterschiede in der Darstellung der Ereignisse und der Charaktere in den beiden Fassungen, um die Auswirkungen auf das Gesamtverständnis des Werkes aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Nibelungenlied, Handschriften B und C, Textualität, Textüberlieferung, narratives Schema, mittelalterliche Literatur, Textvergleich, Hermeneutik, Erzähltheorie, mittelalterliches Textverständnis, modernes Textverständnis.
Häufig gestellte Fragen zum Nibelungenlied-Handschriftenvergleich
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Unterschiede in der Textüberlieferung der Nibelungenlied-Handschriften B und C und deren Auswirkungen auf die Interpretation des Werkes. Der Fokus liegt auf dem Vergleich ausgewählter Strophen, um die divergierenden narrativen Schemata und Konzeptionierungen beider Fassungen aufzuzeigen.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern erzwingen die divergierenden narrativen Schemata der Fassungen B und C unterschiedliche hermeneutische Herangehensweisen an das Nibelungenlied?
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Textualitätsverständnis (modern und mittelalterlich), ein Kapitel mit dem detaillierten Vergleich ausgewählter Strophen aus den Handschriften B und C und eine Schlussbetrachtung.
Welche Strophen werden verglichen?
Der Vergleich konzentriert sich auf ausgewählte Strophen aus der 6. – 9. Aventiure (Siegfried vs. Hagen von Tronje) und der 31. – 33. Aventiure (Kriemhilds Schuld am Tod Ortliebs).
Wie wird der Vergleich der Strophen durchgeführt?
Der Vergleich analysiert die unterschiedlichen narrativen Schemata und Konzeptionierungen in den ausgewählten Aventiuren und zeigt auf, wie die verschiedenen Überlieferungen zu unterschiedlichen Interpretationen der Handlung und der Figuren führen können. Die Analyse beleuchtet die spezifischen Unterschiede in der Darstellung der Ereignisse und der Charaktere in den beiden Fassungen.
Welchen Stellenwert hat das Textualitätsverständnis?
Die Arbeit betont die Bedeutung des unterschiedlichen Textualitätsverständnisses im Mittelalter und in der Moderne. Es wird gezeigt, wie das mittelalterliche Textverständnis von dem modernen abweicht und wie diese Unterschiede die Interpretation des Nibelungenlieds beeinflussen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Nibelungenlied, Handschriften B und C, Textualität, Textüberlieferung, narratives Schema, mittelalterliche Literatur, Textvergleich, Hermeneutik, Erzähltheorie, mittelalterliches Textverständnis, modernes Textverständnis.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Auswirkungen unterschiedlicher Textüberlieferungen auf die Interpretation des Nibelungenlieds aufzuzeigen und ein tieferes Verständnis der Komplexität des Werkes zu vermitteln.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Die Schlussfolgerungen sind nicht explizit in der Zusammenfassung enthalten und müssen aus der vollständigen Arbeit entnommen werden.)
- Quote paper
- Daniel Loch (Author), 2008, Variierende Textüberlieferung der Nibelungenliedhandschriften B und C, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126707