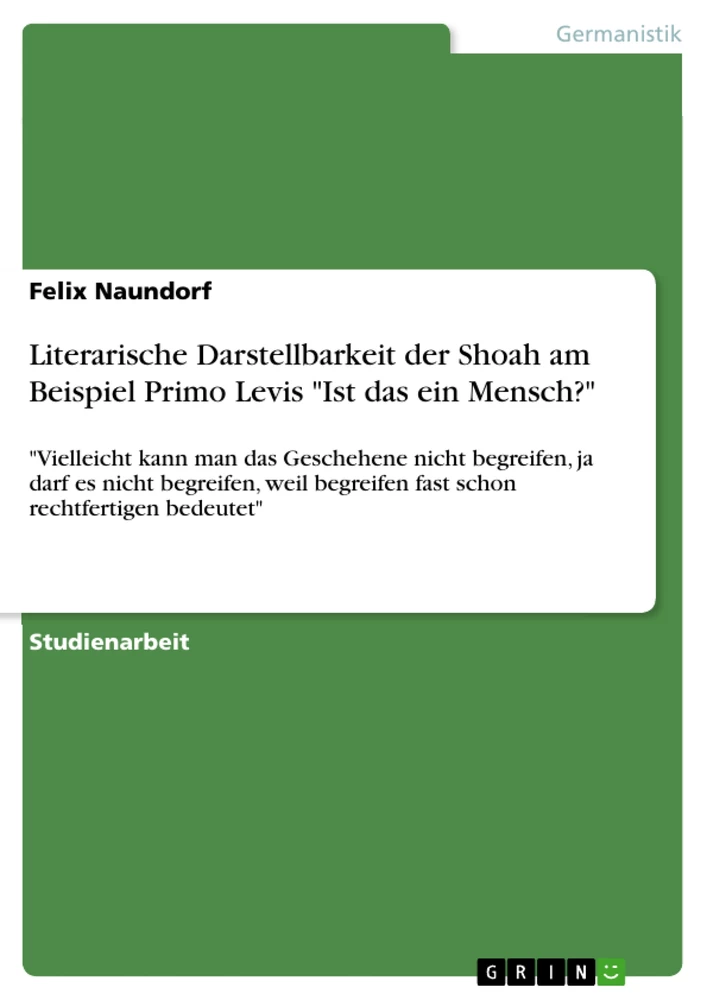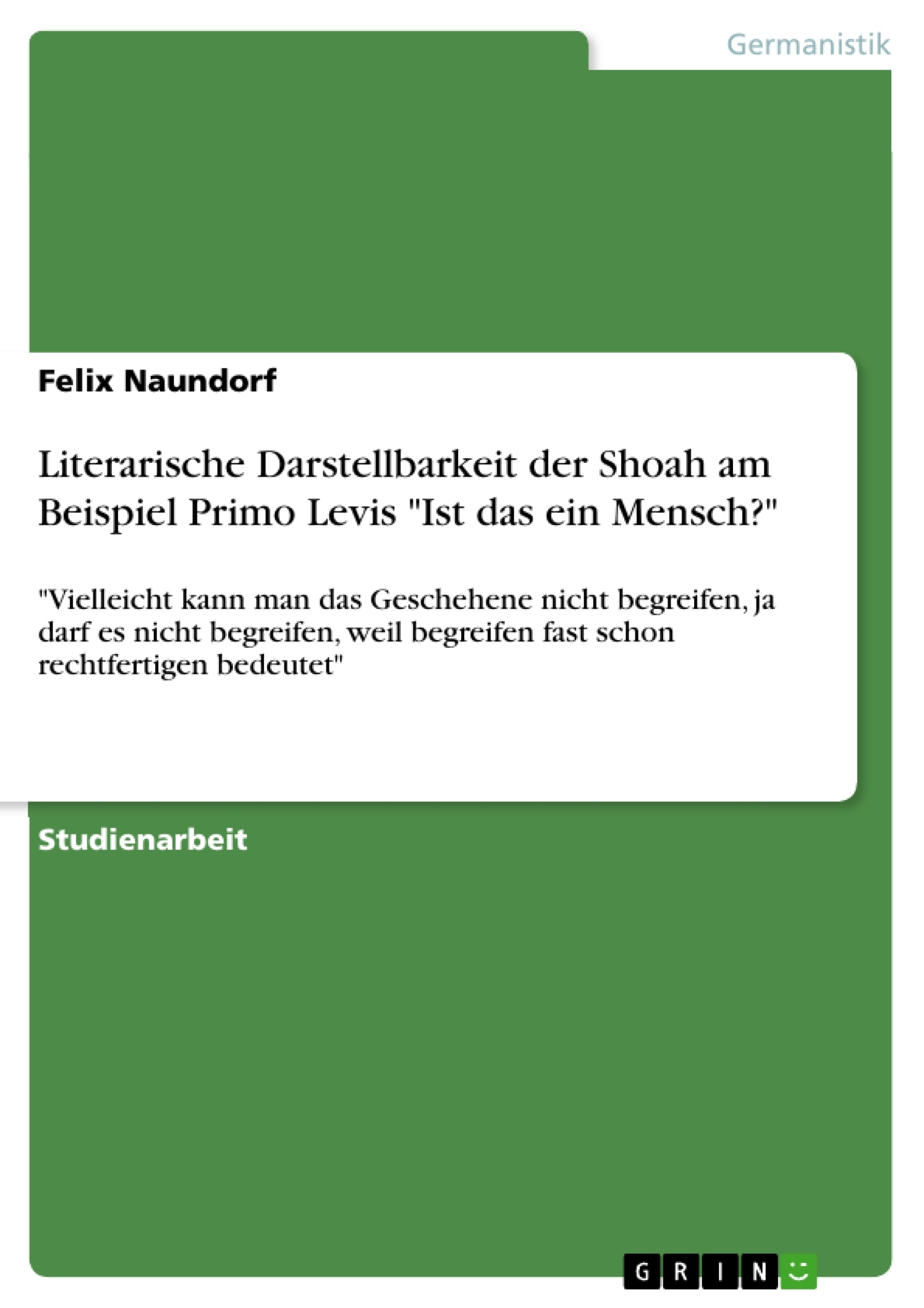In der Arbeit soll untersucht werden, inwiefern eine literarische Darstellung der Shoah möglich sein kann und wodurch es Primo Levi (1919 – 1987) in "Ist das ein Mensch?" ("Se questo è un uomo?") gelingt, das Un(be)greifbare aufzulösen und greifbar(er) zu machen. Dazu sollen im ersten Teil einige Schwierigkeiten dargelegt werden, vor die Autor*innen und Zeitzeug*innen, aber auch Shoah-Forschende bei der Erschließung dieses weiten Feldes aus Unsagbarkeit und Unvergleichbarkeit gestellt wurden und werden. Um sich dem Zivilisationsbruch mental und analytisch annähern zu können, bedarf es begrifflicher Werkzeuge und Formen der Darstellbarkeit. Eben jene können jedoch nur ausformuliert werden, wenn ein grundlegendes Verständnis dieses singulären Ereignisses vorherrscht. Hier setzt das Dilemma an: wie kann etwas Unvorstellbares, nie Dagewesenes greifbar gemacht werden, ohne es zu banalisieren?
An Greifbarkeit gewinnt die Beschäftigung mit der Shoah über Literarisierung – Zeitzeug*innenberiche liefern eine Form des Umgangs mit Unsagbarkeit und Sinnverschiebung. Durch die Behandlung eines kontingenzauflösenden Ereignisses ist es kaum verwunderlich, dass sie sich durch eine gewisse Hybridität auszeichnen, dass Faktum und Fiktion verschwimmen. Hierzu soll Aristoteles Analyse des Verhältnisses von Dichtung und Geschichtsschreibung, besonders hinsichtlich seiner Binnendifferenzierungen konsultiert werden, um anschließend die neuere Shoah-Forschung und mit ihr James E. Young zur adäquaten Ausdeutung von histoire und discours zu befragen.
Eine Ästhetisierung ergibt sich naturgemäß aus der literarischen Verarbeitung des Erlebten – um Unbegreifliches begreifen zu können, muss auf bestehende Wissensformen zurückgegriffen werden. Über Hannah Arendts Beobachtungen zur Rezeption der Zeitzeug*innenberichte – dem Medium der Erschließung dieses Zivilisationsbruchs – soll sich den Möglichkeiten der angemessenen Verarbeitung angenähert werden. Um den sinnlosen Genozid an mindestens sechs Millionen Jüd*innen nicht mit Sinn aufzuladen, mussten adäquate Formen der Darstellbarkeit gefunden werden. Besonders Levis Zeitdokument ist vom würdevollen, angemessenen Andenken an die stimmlosen Toten gekennzeichnet. Giorgio Agamben greift in seiner Analyse zur Zeug*innenschaft von Auschwitz Levis Begriff der "Lücke" des Zeugnisses auf – das Verständnis der Lücke wird zentral für die Erschließung von Mensch sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schwierigkeiten literarischer Darstellung
- Ästhetisierung ohne Sinngebung?
- Lückenhaftigkeit des Zeugnisses
- Artikulationsformen Levis
- Die dante'sche Hölle von Auschwitz
- Tagträume, Albträume, Kollektivträume
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der literarischen Darstellung der Shoah am Beispiel von Primo Levis "Ist das ein Mensch?". Der Schwerpunkt liegt auf der Frage, inwiefern es möglich ist, das Unvorstellbare und Unvergleichbare der Shoah literarisch zu verarbeiten. Dabei werden die Schwierigkeiten beleuchtet, denen Autor*innen und Zeitzeug*innen bei der Erschließung dieser Thematik begegnen, sowie die besonderen Artikulationsformen Levis analysiert.
- Schwierigkeiten der literarischen Darstellung der Shoah
- Ästhetisierung und Sinngebung im Kontext der Shoah
- Die Bedeutung der Lückenhaftigkeit von Zeitzeugnissen
- Levis Artikulationsformen: Dante-Bezug und Traumsequenzen
- Vermittlung von Unsagbarkeit durch literarische Mittel
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Fragestellung der Arbeit ein und erläutert die Schwierigkeiten, denen die literarische Darstellung der Shoah begegnet. Im ersten Teil wird die Problematik der Ästhetisierung und Sinngebung sowie die Lückenhaftigkeit von Zeitzeugnissen diskutiert. Dabei wird Bezug genommen auf die Forschung von Hannah Arendt, James E. Young und Giorgio Agamben.
Der zweite Teil konzentriert sich auf Levis "Ist das ein Mensch?" als eines der ersten autobiographischen Zeugnisse eines Shoah-Überlebenden. Hier werden die literarischen Verfahren Levis analysiert, insbesondere die Nutzung der Intertextualität und der Traumsequenzen. Im Zentrum steht die Frage, wie Levi durch den Rückgriff auf Dante Alighieri ein bisher unbekanntes und unmögliches Phänomen erfahrbar macht.
Schlüsselwörter
Shoah, Literatur, Zeitzeugnis, Ästhetisierung, Sinngebung, Lückenhaftigkeit, Artikulationsformen, Primo Levi, "Ist das ein Mensch?", Dante Alighieri, Traumsequenzen, Intertextualität, Auschwitz.
- Quote paper
- Felix Naundorf (Author), 2022, Literarische Darstellbarkeit der Shoah am Beispiel Primo Levis "Ist das ein Mensch?", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1266411