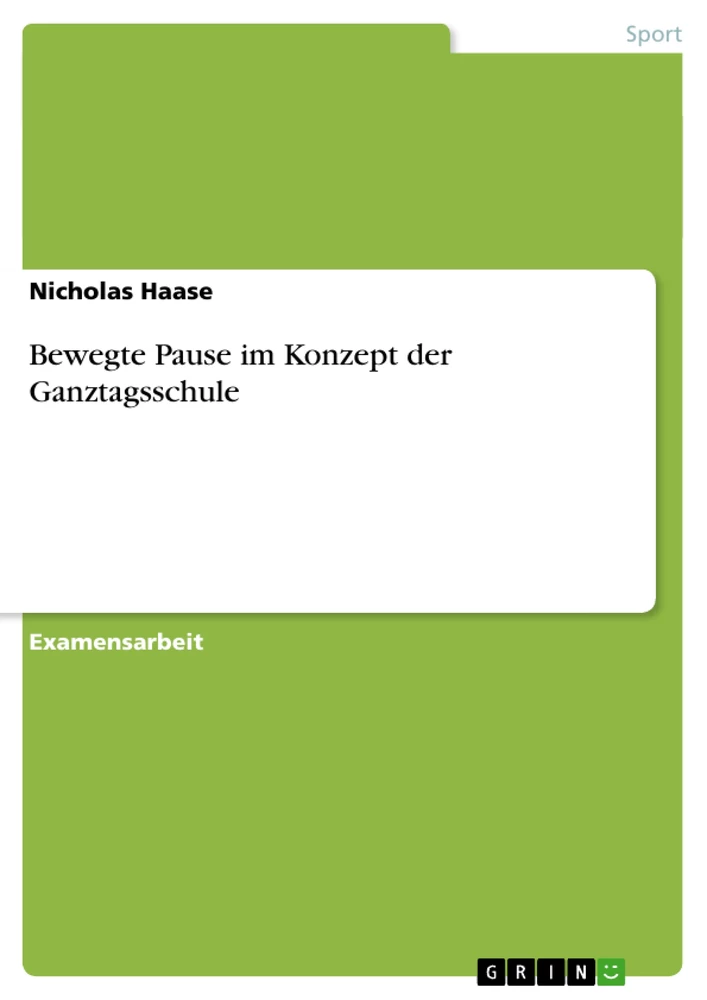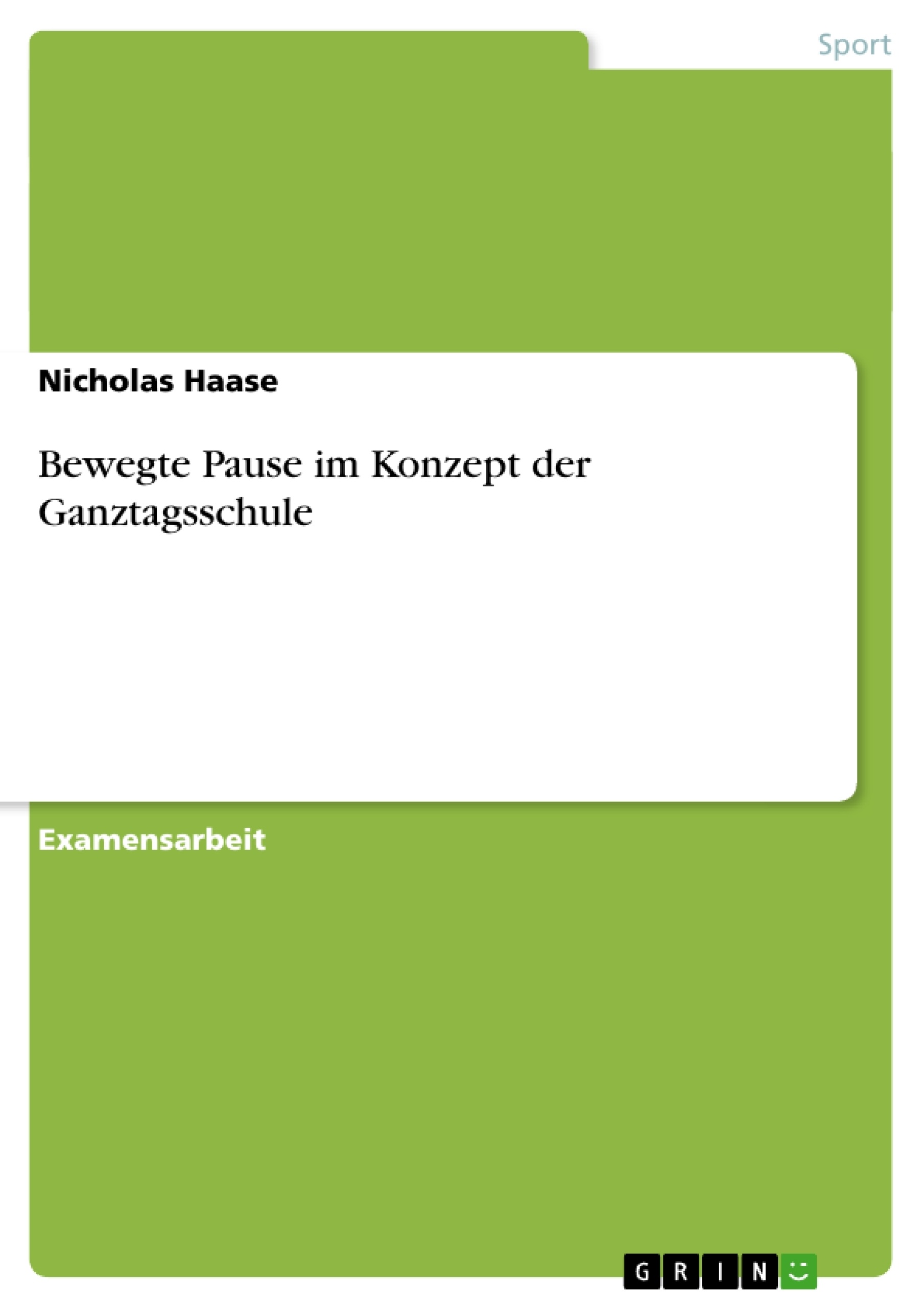Die deutsche Gesellschaft hat sich in den letzten 20 Jahren grundlegend verändert und damit auch das Freizeitverhalten von Jugendlichen und Kindern. Anstatt umfangreiche Bewegungserfahrungen zu sammeln, findet die Wahrnehmung der Umwelt heutzutage immer mehr durch Massenmedien statt. Durch diese Sekundärerfahrungen lernen die Heranwachsenden nur noch das passive Konsumieren und Nachempfinden zu Ungunsten der Eigeninitiative und Kreativität. Das selbständige Handeln und Erleben rückt zusehends in den Hintergrund und die Kinder sind immer weniger in der Lage, selber zu erforschen oder zu begreifen, da sie erhaltene Informationen stetig schlechter verarbeiten können (vgl. Zimmer, 2001, S. 2f ).
Empirische Untersuchungen haben in diesem Kontext bewiesen, dass die Bewegungszeit von Schülern nur noch eine Stunde täglich beträgt. Durch langes Sitzen in der Schule und die nachlassende tägliche Bewegungszeit sind bereits schwerwiegende Folgen in der kindlichen Entwicklung festzustellen. Dazu gehören vielfach psychosomatische Störungen, wie Kopf-, Rücken- oder Magenschmerzen sowie Konzentrationsschwierigkeiten, die sich bei 40-70% der Schüler nachweisen lassen. Des Weiteren stellen sich immer häufiger Koordinationsschwächen und Übergewicht ein (vgl. Dordel & Breithecker, 2003, S. 5).
Ein Lösungsansatz zur Beseitigung einiger der oben genannten Probleme kommt aus der Neurowissenschaft. Erkenntnisse aus diversen Forschungsprojekten, wie z.B. von Dordel & Breithecker (2003), geben Grund zu der Annahme, dass durch regelmäßige Bewegung die Konzentration und damit die kognitive Leistungsfähigkeit gesteigert werden kann.
Ein weiterer entscheidender Faktor gegen den Kampf von Bewegungsmangelerkrankungen war die Entwicklung des Konzepts der „Bewegten Schule“, initiiert Anfang der 80er Jahre durch den Schweizer Sportpädagogen Urs Illi. Dieses ganzheitliche Konzept versucht über den Schulsport hinaus Bewegung in allen Fächern zu integrieren. So soll mit einem zusätzlichen Angebot an kind- und entwicklungsgerechten Bewegungsräumen im Lebensraum Schule versucht werden, die Schüler zu selbstreguliertem und selbstinitiiertem Spielen und Bewegen anzuregen....folgende Forschungsfrage:
„Warum sollten Bewegte Pausen im Konzept der Ganztagsschule eingeführt werden?“
Daher setzt sich die vorliegende Arbeit mit der Problematik auseinander, inwiefern Bewegung als Qualitätsaspekt im ganztägigen Schulkonzept zu einer Verbesserung des Lebensraums Schule für alle Beteiligten beitragen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bewegung - Bewegte Schule
- Begriffsbestimmung „Bewegung“
- Zusammenhänge zwischen Entwicklung und Bewegung
- Die Bedeutung von Bewegung beim Lernen
- Bewegte Schule - Versuch einer Definition
- Sportpädagogische, gesundheitspädagogische und schulpädagogische Begründungen und Argumente für eine Bewegte Schule
- Entwicklungs- und lerntheoretische Begründungsmuster
- Anthropologisches Argument
- Entwicklungspsychologisches Argument
- Lernpsychologisches Argument
- Medizinisch-gesundheitswissenschaftliche Begründungsmuster
- Ergonomisches Argument
- Gesundheitspädagogisches Argument
- Argument der Unfallverhütung und Sicherheitserziehung
- Physiologisches Argument
- Schulprogrammatische Begründungsmuster
- Bildungstheoretisches Argument
- Lebensweltliches Argument
- Schulökologisches Argument
- Bewegte Schule im Konzept von Ganztagsschulen
- Einordnung und Definition von Ganztagsschulen
- Bedeutung und Möglichkeiten der Ganztagsschule
- Vorstellung von Konzepten dreier Ganztagsschulen
- Die KGS Bad Lauterberg
- Die Gesamtschule am Rosenberg in Hofheim
- Die Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Göttingen
- Bewegte Schule im Konzept von Ganztagsschulen
- Bewegte Pause im Konzept von Ganztagsschulen
- Schulhofaktivitäten
- Spiele im Schulgebäude oder im Klassenzimmer
- „Offene Turnhalle“
- Empirische Untersuchung zum Thema „Bewegte Pause im Konzept von Ganztagsschulen“
- Entscheidungs- und Planungsphase
- Konzeption und Durchführung der Untersuchung
- Auswertung der empirischen Untersuchung
- Geschlecht
- Beschäftigung während der Mittagspause
- Angebotswünsche für die Mittagspause
- Verbesserung der körperlichen Befindlichkeit durch Pausenbewegung
- Bevorzugte sportliche Pausenaktivitäten
- Pausensport und Pausenbewegung
- Interpretation der Ergebnisse
- Fazit der Befragung
- Überlegungen zu einem Modell der Bewegten Pause an der KGS Bad Lauterberg
- Definition meiner Tätigkeit und ein Blick zurück zu den Anfängen
- Planung und Durchführung einer Bewegten Pause am Praxisbeispiel
- Kritische Betrachtung von Bewegter Pause am Praxisbeispiel
- Weiterführende Gedanken zu der Bewegten Pause an der KGS Bad Lauterberg
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Einfluss von Bewegung auf das Lernen und die Lebensqualität in der Schule, insbesondere im Kontext von Ganztagsschulen. Sie untersucht die Bedeutung von Bewegung für die Entwicklung und das Wohlbefinden von Schülern und ergründet die Relevanz einer „Bewegten Schule“ im Bildungssystem.
- Bedeutung von Bewegung für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Steigerung der Konzentration und kognitiven Leistungsfähigkeit durch Bewegung
- Entwicklung und Umsetzung von Konzepten für eine „Bewegte Schule“
- Integration von Bewegung in den Schulalltag, insbesondere im Rahmen von Ganztagsschulen
- Empirische Untersuchung zur Wirksamkeit von „Bewegten Pausen“ in Ganztagsschulen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit sowie die persönliche Motivation des Autors erläutert. In Kapitel 2 wird der Begriff „Bewegung“ definiert, die Zusammenhänge zwischen Bewegung und Entwicklung sowie die Bedeutung von Bewegung beim Lernen aufgezeigt.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit den pädagogischen und wissenschaftlichen Begründungen für eine „Bewegte Schule“. Es werden verschiedene Argumentationsmuster aus den Bereichen der Sportpädagogik, Gesundheitspädagogik und Schulpädagogik vorgestellt. Kapitel 4 widmet sich der „Bewegten Schule“ im Konzept von Ganztagsschulen. Es werden Definitionen und Einordnungen von Ganztagsschulen gegeben und die Bedeutung und Möglichkeiten von ganztägigen Schulformen herausgearbeitet.
Weiterhin werden die Konzepte von drei verschiedenen Ganztagsschulen vorgestellt. Schließlich wird auf die „Bewegte Pause“ im Konzept von Ganztagsschulen eingegangen und es werden konkrete Beispiele für die Durchführung gegeben.
Kapitel 5 präsentiert eine empirische Untersuchung zum Thema „Bewegte Pause im Konzept von Ganztagsschulen“. Die Untersuchung wurde an der KGS Bad Lauterberg durchgeführt und wird in der Arbeit ausführlich vorgestellt und ausgewertet. Kapitel 6 beschäftigt sich mit Überlegungen zu einem Modell der „Bewegten Pause“ an der KGS Bad Lauterberg.
Es werden Ideen, praktische Erfahrungen sowie kritische Betrachtungen am Beispiel der KGS Bad Lauterberg erläutert sowie weiterführende Gedanken zu zukünftigen möglichen Maßnahmen genannt. Die Arbeit endet mit einer kritischen Würdigung der Ergebnisse und einer persönlichen Einschätzung des Autors.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Bewegung, „Bewegte Schule“, Ganztagsschule, „Bewegte Pause“, Entwicklung, Lernen, Gesundheit, Empirie, Praxis, Schulpädagogik, Sportpädagogik, Gesundheitspädagogik.
- Quote paper
- Nicholas Haase (Author), 2008, Bewegte Pause im Konzept der Ganztagsschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126640