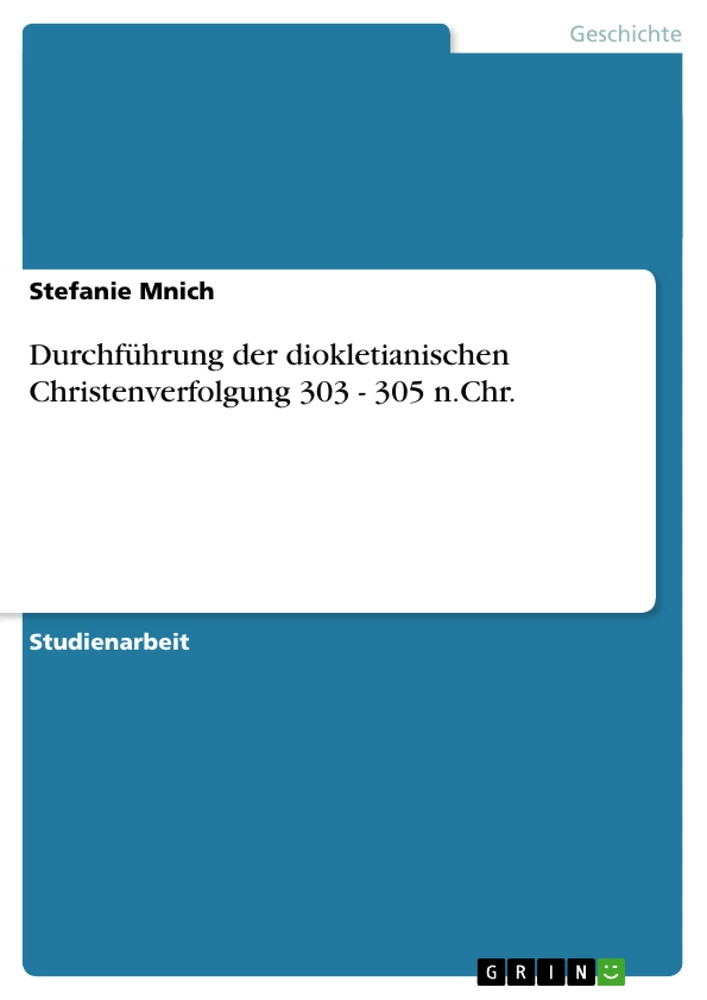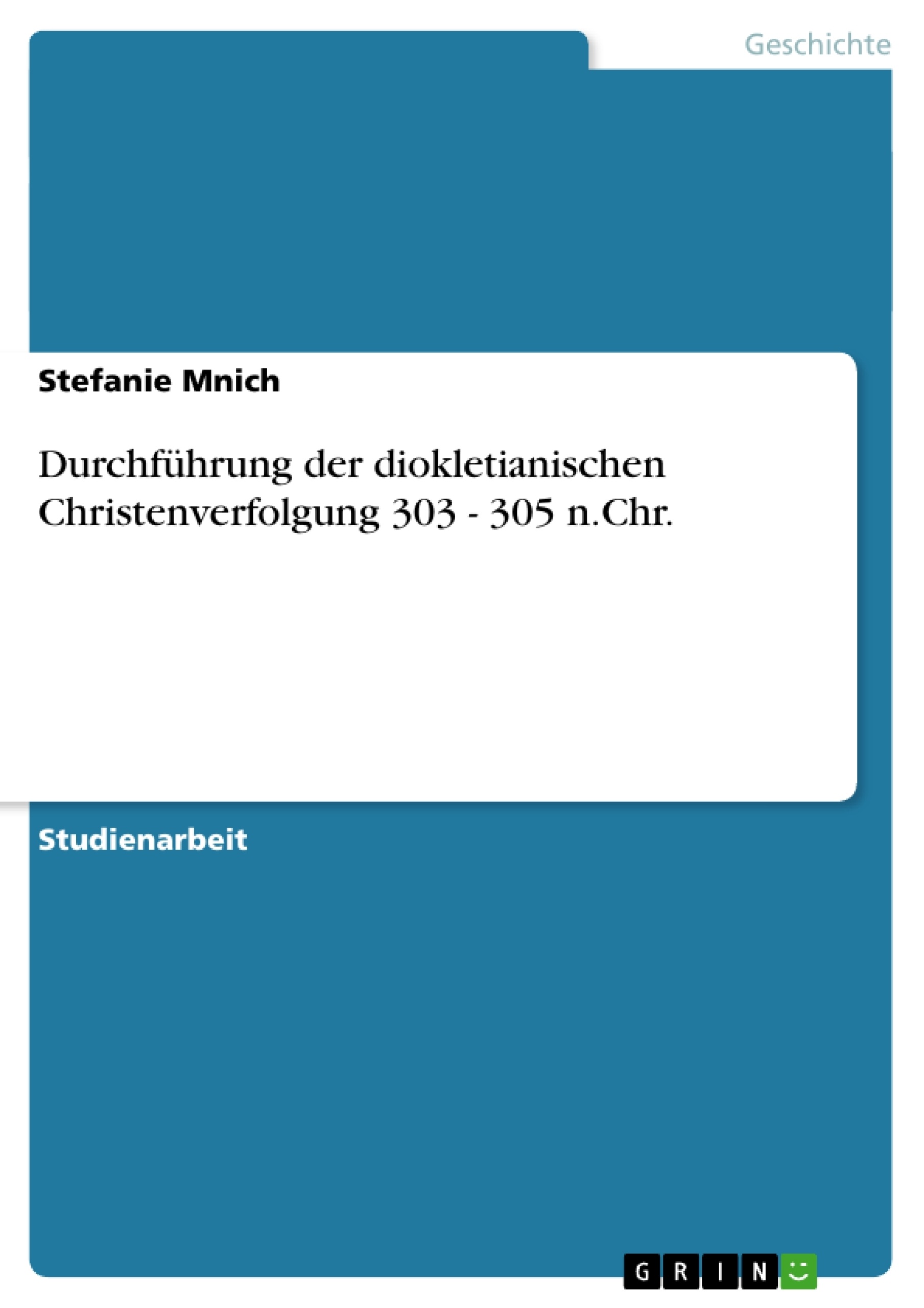Diokletian war der letzte antike Herrscher, der eine Christenverfolgung einleitete, sie wurde zu einer der schwersten im Römischen Reich. Er ging dabei geplant und zielgerichtet gegen die Christen vor. Seine Beweggründe für diese Verfolgung sind ungeklärt. Häufig wird eine Einreihung in die allgemeine Reformtätigkeit vermutet oder die eigene Religiosität Diokletians.
Überliefert wurde die Verfolgung vor allem durch die Werke der beiden christlichen Autoren Lactanz, der „Von den Todesarten der Verfolger“ schrieb, und Euseb, der eine der ersten Kirchengeschichten verfasste.
In meiner Arbeit werde ich mich mit der Durchführung der Verfolgung beschäftigen. Ich möchte einen Überblick über die eingeleiteten Maßnahmen geben, sowie über deren Gründe und Effektivität. Ganz kurz werde ich am Anfang versuchen den Anlass zu beschreiben.
Im Aufbau der Arbeit werde ich chronologisch vorgehen, in der Rheinfolge der Edikte, wobei die Schriften von Lactanz und Euseb die Grundlage für die weiteren Ausführungen bilden sollen. In den beiden letzten Punkten wende ich mich der Intensität und der Vorgehensweise bei der Verfolgung zu. Zeitlich werde ich mich im Rahmen der Amtszeit Diokletians und Maximians bewegen, meine Arbeit wird also nur den Zeitraum vom Beginn der Verfolgung im Februar 303 bis zum Rücktritt der beiden Kaiser im Jahr 305 behandeln, obwohl die Verfolgung auch nach 305 in geringerem Umfang fortgesetzt wurde und erst 311 mit dem Toleranzedikt von Galerius endete.
Ich werde versuchen zu klären, ob von Anfang an beabsichtigt war, vier Edikte zu erlassen und die Maßnahmen schon in der Reihenfolge geplant waren oder ob die weiterführenden Edikte
vielmehr Reaktionen auf das erste und aufeinander waren, weil sie sich nicht als wirkungsvoll genug erwiesen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Anhaltspunkte für die Durchführung der diokletianischen Christenverfolgung in den Zeitgenössischen Quellen
- I.I. Laktanz - Von den Todesarten der Verfolger
- I.II. Euseb
- II. Beginn der Verfolgung
- III. Erstes Edikt
- IV. Zweites und drittes Edikt
- V. Viertes Edikt
- VI. Intensität der Verfolgung
- VII. Vorgehensweise bei der Verfolgung
- VIII. Fazit
- IX. Literaturverzeichnis und Quellenangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Durchführung der diokletianischen Christenverfolgung im Römischen Reich von 303 bis 305 n. Chr. Ziel ist es, einen Überblick über die eingeleiteten Maßnahmen, deren Gründe und Effektivität zu geben. Die Arbeit analysiert die Quellen von Laktanz und Euseb, um die Chronologie der Verfolgung, die Inhalte der Edikte und die Vorgehensweise der Behörden zu rekonstruieren.
- Die Rolle der Edikte in der Verfolgung
- Die Intensität der Verfolgung in verschiedenen Regionen
- Die Vorgehensweise der Behörden bei der Verfolgung
- Die Motive Diokletians für die Verfolgung
- Die Auswirkungen der Verfolgung auf die christliche Gemeinde
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die diokletianische Christenverfolgung als eine der schwersten im Römischen Reich vor und skizziert die Forschungsfrage nach der Durchführung der Verfolgung. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Quellen von Laktanz und Euseb, um die Chronologie der Verfolgung, die Inhalte der Edikte und die Vorgehensweise der Behörden zu rekonstruieren.
Kapitel I.I. analysiert Laktanz' Werk „Von den Todesarten der Verfolger“ und untersucht seine Darstellung der Verfolgung. Laktanz beschreibt die Verfolgung als eine Folge von misslungenen Opferschauen, Galerius' Einfluss und Diokletians Entscheidung, die Christen zu verfolgen. Er schildert die Zerstörung der Kirche in Nikomedia, die Veröffentlichung des ersten Edikts und die anschließenden Maßnahmen der Behörden. Laktanz' Darstellung ist stark von christlicher Sichtweise geprägt und zeichnet ein negatives Bild der Verfolger.
Kapitel I.II. untersucht Eusebs Kirchengeschichte und seine Darstellung der Verfolgung. Euseb sieht den Anlass der Verfolgung in Streitigkeiten unter den Bischöfen und beschreibt die Verfolgung als eine Reaktion auf die Weigerung der Christen, den römischen Göttern zu opfern. Er schildert die Zerstörung der Kirchen, die Verfolgung der christlichen Würdenträger und die Märtyrer. Eusebs Darstellung ist ebenfalls von christlicher Sichtweise geprägt, aber weniger anklagend als Laktanz' Werk.
Kapitel II. beschreibt den Beginn der Verfolgung im Jahr 303 und die Rolle des ersten Edikts. Die Arbeit analysiert die Inhalte des Edikts und die Reaktion der Christen darauf. Kapitel III. untersucht die weiteren Edikte, die während der Verfolgung erlassen wurden, und analysiert deren Inhalte und Auswirkungen. Kapitel IV. und V. befassen sich mit der Intensität der Verfolgung in verschiedenen Regionen und der Vorgehensweise der Behörden bei der Verfolgung. Die Arbeit untersucht die Methoden der Verfolgung, die Rolle der lokalen Behörden und die Auswirkungen der Verfolgung auf die christliche Gemeinde.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die diokletianische Christenverfolgung, die Edikte, die Quellen von Laktanz und Euseb, die Intensität der Verfolgung, die Vorgehensweise der Behörden, die Motive Diokletians und die Auswirkungen der Verfolgung auf die christliche Gemeinde. Die Arbeit analysiert die Durchführung der Verfolgung im Römischen Reich von 303 bis 305 n. Chr. und untersucht die Rolle der Edikte, die Reaktion der Christen und die Auswirkungen der Verfolgung auf die Gesellschaft.
- Quote paper
- Stefanie Mnich (Author), 2007, Durchführung der diokletianischen Christenverfolgung 303 - 305 n.Chr., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126630