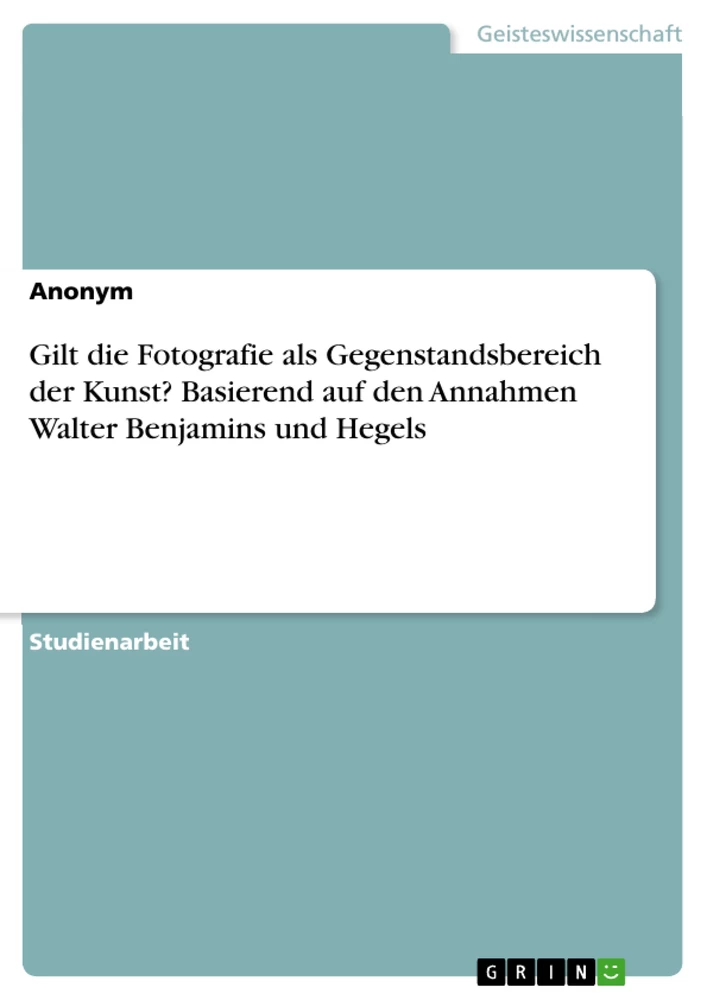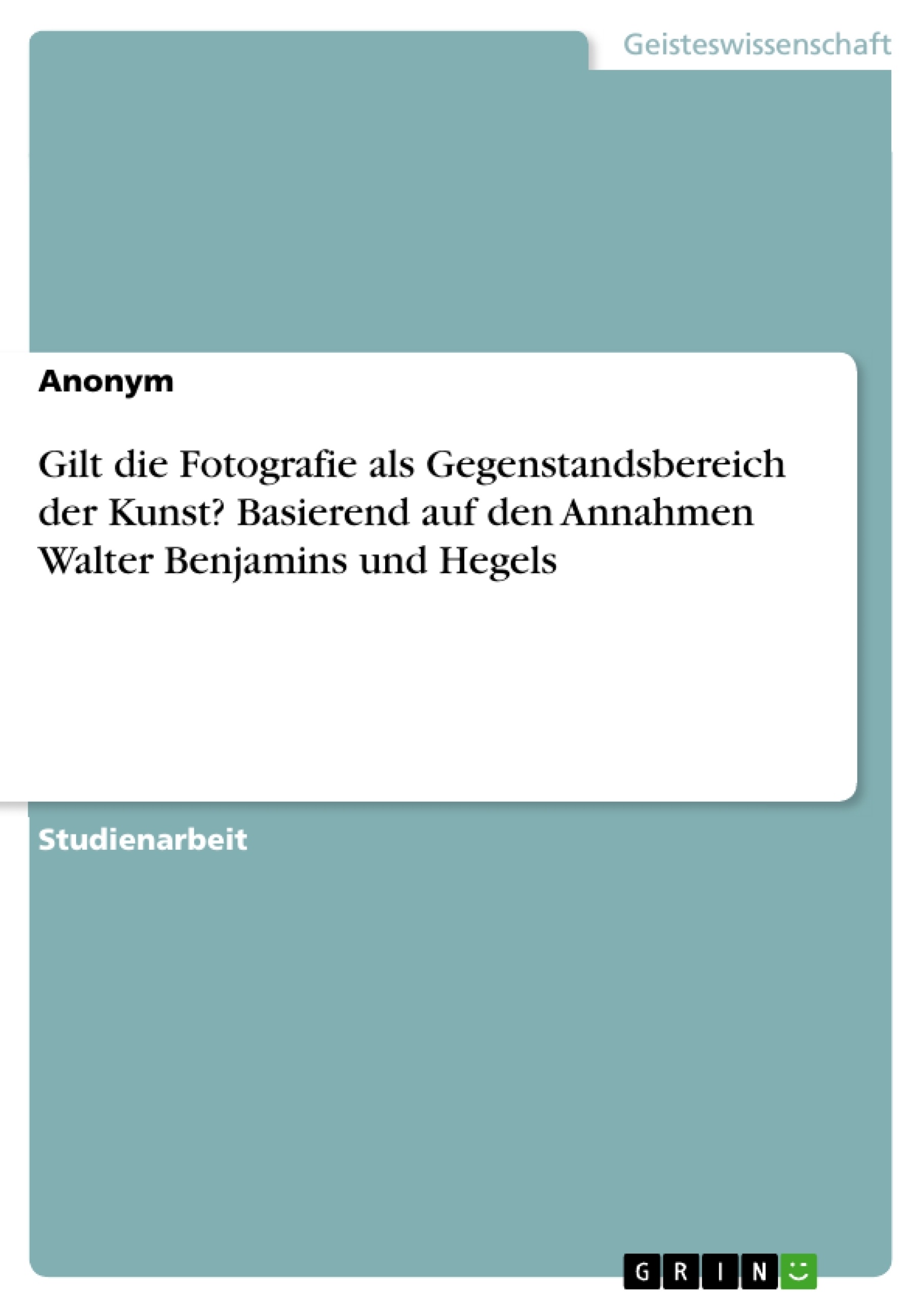Fotografieren gehört im 21sten Jahrhundert zu den selbstverständlichen Dingen des Alltags. Wir fotografieren uns selbst, Gebäude, unser Essen, unsere Familie und unsere Freunde und noch viele andere Dinge. Oft tun wir dies, um uns an bestimmte Zeiten, Ereignisse und Orte erinnern zu können. Manchmal auch, um schöne Momente und schöne Dinge festzuhalten und zu teilen. Heutzutage kann man damit sogar sein Geld verdienen und es gibt einige Fotografen, welche durch ihre Werke sowohl berühmt geworden sind, als auch die Blickwinkel auf bestimmte Ereignisse verändert haben.
Doch nicht immer war das Phänomen der Fotografie und des Fotografierens selbstverständlich.
Erst im 19ten Jahrhundert wurde die erste Form einer Kamera erfunden und langsam in das gesellschaftliche Leben eingegliedert. In seinem Aufsatz „Kleine Geschichte zur Fotografie“, befasste sich der Philosoph Walter Benjamin mit dem eigen typischen besonderen Moment der Fotografie und dessen Entstehung, sowie deren Beziehung zur Kunst.
Die vorliegende Arbeit, beschäftigt sich deshalb, basierend auf Walter Benjamins literarischen und ästhetischen Essay "Kleine Geschichte zur Fotografie" und Hegels Grundannahmen zur Kunst, mit der Frage, ob die Fotografie zum Gegenstandbereich der Kunst gehört. Dies stellt eine Gegenüberstellung der Annahmen zweier Philosophen, von denen einer das Zeitalter der Fotografie erlebte und einem, welchem die Fotografie unbekannt war, dar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Hinführung zur Fragestellung
- Textrekonstruktion „Kleine Geschichte der Photographie“
- Hegels Verständnis von Kunst
- Vergleich Hegel und Benjamin
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die Photographie zum Gegenstandsbereich der Kunst gehört. Der Essay "Kleine Geschichte der Photographie" von Walter Benjamin sowie Hegels Grundannahmen zur Kunst dienen als Grundlage für diese Untersuchung. Die Arbeit analysiert die jeweiligen Positionen dieser beiden Philosophen, wobei der Fokus auf die Frage liegt, wie die Fotografie in den Kontext der Kunst einzuordnen ist.
- Die Entstehung und Entwicklung der Photographie
- Das Verhältnis von Photographie und Kunst
- Benjamins Konzept des "magischen Werts" der Photographie
- Hegels Kunstverständnis im Vergleich zu Benjamins Analyse
- Die Frage nach der Autonomie und Objektivität der Photographie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung und Hinführung zur Fragestellung: Dieses Kapitel stellt die Fragestellung der Arbeit vor und führt in die Thematik der Photographie und ihrer Beziehung zur Kunst ein. Es werden die Ausgangspunkte der Untersuchung, die Werke von Walter Benjamin und Georg Wilhelm Friedrich Hegel, sowie die Besonderheiten der Photographie im 21. Jahrhundert beleuchtet.
- Textrekonstruktion „Kleine Geschichte der Photographie“: Das zweite Kapitel analysiert Benjamins Essay "Kleine Geschichte der Photographie" und erläutert seine zentralen Argumentationslinien. Dabei werden Themen wie die technologische Entwicklung der Fotografie, das Konzept des "magischen Werts" und das Verhältnis von Photographie und Wirklichkeit behandelt.
- Hegels Verständnis von Kunst: Dieses Kapitel präsentiert Hegels Kunstverständnis und beleuchtet seine zentralen Gedanken zur Definition und Funktion von Kunst.
- Vergleich Hegel und Benjamin: Im vierten Kapitel werden die Ansichten von Hegel und Benjamin hinsichtlich der Photographie verglichen. Die Analyse konzentriert sich auf die unterschiedlichen Perspektiven, die diese Philosophen auf die Fotografie einnehmen, und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der Kunstphilosophie und der Medienwissenschaft, insbesondere mit der Frage nach der Stellung der Fotografie im Kontext der Kunst. Schlüsselbegriffe sind "magischer Wert", "Aura", "technische Reproduzierbarkeit", "Kunstverständnis", "Hegel", "Benjamin", "Photographie", "Kunst", "Ästhetik" und "Gesellschaft".
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Gilt die Fotografie als Gegenstandsbereich der Kunst? Basierend auf den Annahmen Walter Benjamins und Hegels, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1266241