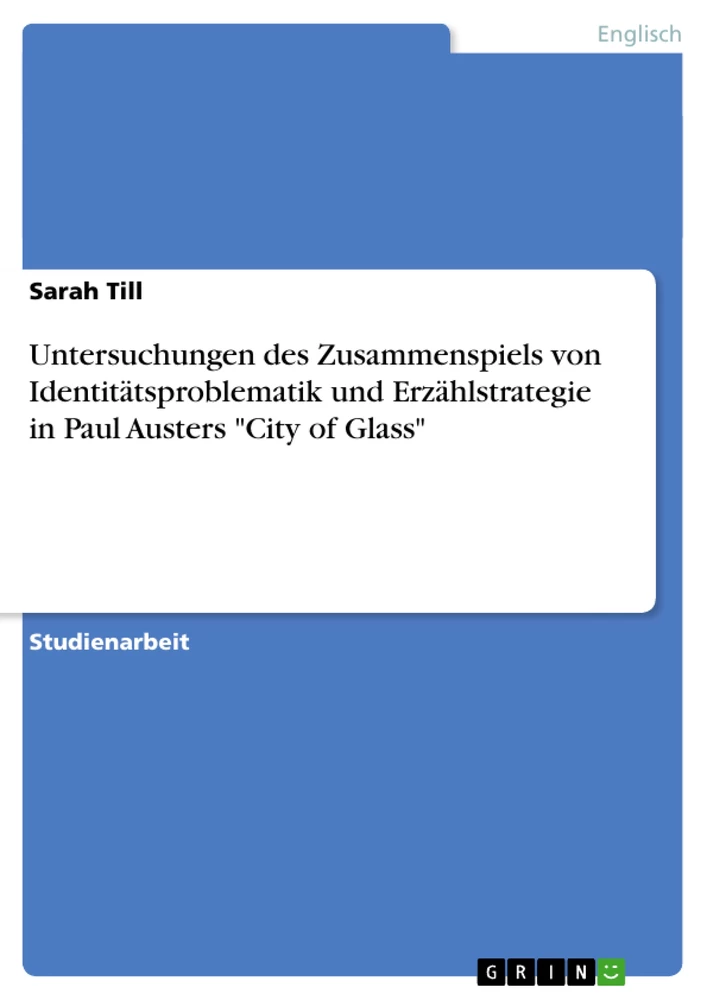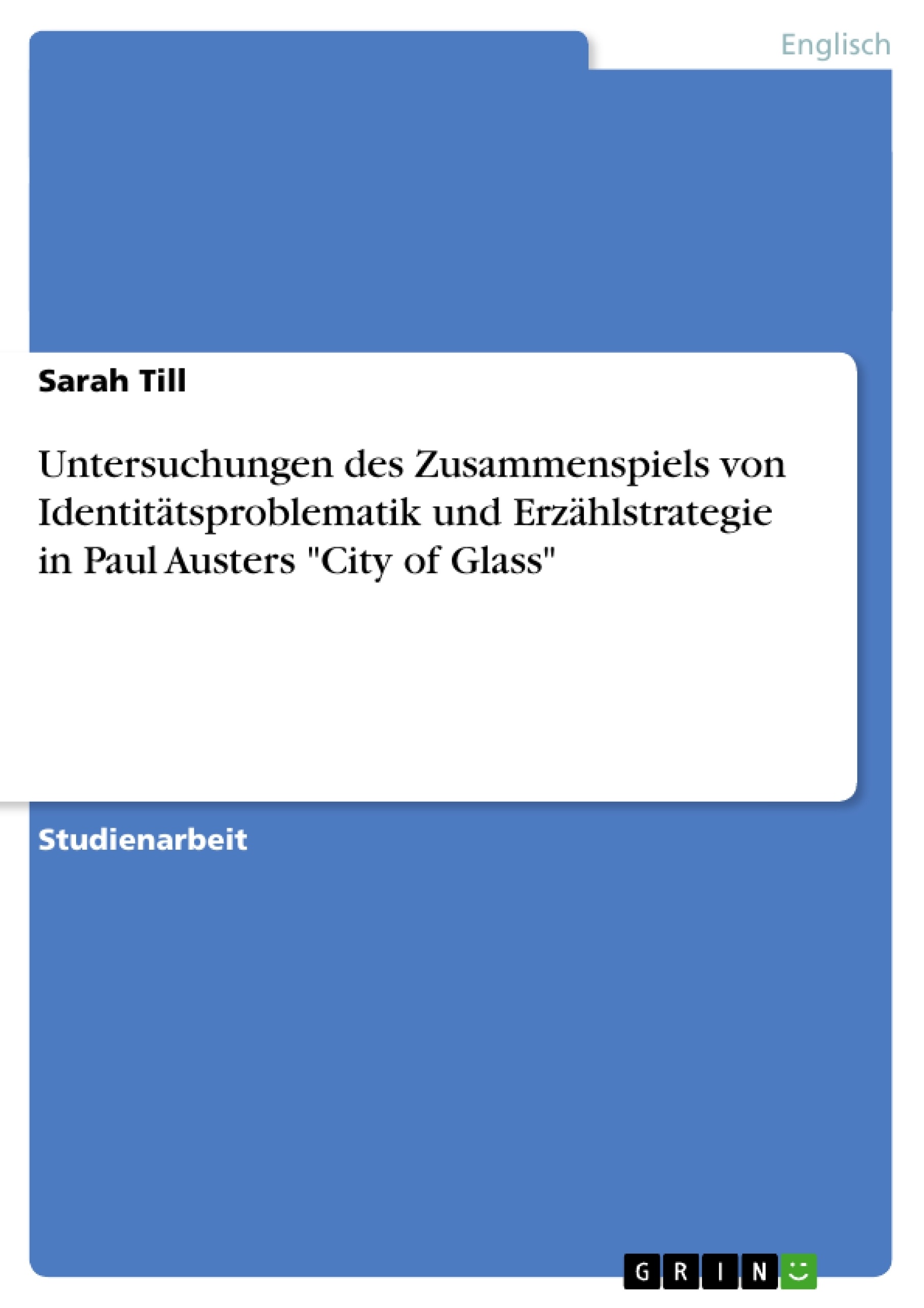Eine wesentliche Fragestellung, die sich wie ein roter Faden durch das Oeuvre Paul Austers zieht, ist jene nach Identität. Beharrlich suchen seine Protagonisten nach ihr, nicht selten geht ihnen das Gefundene aber auch wieder verloren und eine Rückkehr in ihren Isolationszustand wird für sie unausweichlich. In „City of Glass“, dem ersten der in den Jahren 1981-83 als „New York Trilogy“ verfassten Romane, ist dieses Thema geradezu omnipräsent. Die Frage nach Identität gewinnt in dieser, dem Zeitalter der Postmoderne zugeordneten, Erzählung eine neue fundamentale Bedeutung. Die der postmodernen Ära eigene allgegenwärtige Unbestimmtheit aufgrund neuer Methoden von Interaktion und sozialer Organisation resultiert in einer pluralistisch angelegten Wahrheit. Unter anderem darin gründet die Annahme, dass das Selbst nicht länger als stabile und geschlossene Einheit betrachtet werden kann, sondern dass Identität etwas Unsicheres geworden ist (Springer S. 14-17). Paul Austers Anspruch, das Thema ‚Identität’ in diesem Sinne mit „City of Glass“ neu zu beleuchten, tritt deutlich hervor. Schließlich verbirgt sich hinter dem vielfach auf Austers Erzählungen angewendeten Begriff „postmodern quest“ nicht etwa eine Identitätssuche im herkömmlichen Sinne, die die Entwicklung einer vereinheitlichenden Identität zum Ziel hat. Darauf weist Ilana Shiloh hin, wenn sie schreibt, dass die gesamte „New York Trilogy” „[is] structured around their protagonists’ quests for the loss of identity” (Shiloh, S. 41). Auch wenn Auster dieses Thema nicht ganz nach dem Vorbild postmoderner Identitätsmodelle angeht, bedient sich der Autor in „City of Glass“ ganz klar postmoderner Ästhetik. Besonders im erzählstrategischen Sinne, beispielsweise durch die Charakterisierung der Figuren und die Einspielung von metafiktionalen Elementen in den Roman, erscheint Auster als ein typischer postmoderner Autor, dem es darum geht, Kategorien wie Subjekt, Objekt, Identität, Plausibilität, Handlung, Charaktere, Erzähler und Autor zu zerstören oder sie zumindest in Frage zu stellen und seine Texte, wie Klepper es nennt, Gewissheiten zerspielen zu lassen (Klepper, S. 52). Damit wird deutlich, dass die oben angedeutete komplexe Identitätsproblematik nicht nur auf der Handlungsebene den Roman zu einem interessanten Untersuchungsgegenstand macht, sondern dass diese Problematik darüber hinaus auch als die Erzählebenen unterminierend behandelt wird und somit die Frage nach der dem Roman immanenten Poetik aufwirft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Spektren der Identitätsproblematik auf der Handlungsebene
- Daniel Quinn
- Die Stillmans
- Die Romanstruktur und ihr Beitrag zur Identitätsproblematik
- Metafiktion
- Erzählstrategie
- Intertextualität
- Die Spirale
- Metafiktion
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Analyse befasst sich mit der Identitätsproblematik in Paul Austers Roman „City of Glass“, dem ersten Teil der „New York Trilogy“. Ziel ist es, die komplexe Darstellung der Identitätsfindung und -verlustes in der postmodernen Welt zu untersuchen und die Rolle der Romanstruktur und der metafiktionalen Elemente in diesem Prozess zu beleuchten.
- Identitätsfindung und -verlust in der postmodernen Welt
- Die Rolle der Sprache und der Kommunikation in der Konstruktion von Identität
- Metafiktion und die Auflösung von Grenzen zwischen Realität und Fiktion
- Die Bedeutung der Erzählstrategie und der Intertextualität für die Darstellung der Identitätsproblematik
- Die Auswirkungen der Identitätskrise auf die Figuren und ihre Beziehungen zueinander
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Identitätsproblematik in Paul Austers Werk ein und stellt „City of Glass“ als einen zentralen Text für die Untersuchung dieses Themas vor. Der Roman wird im Kontext der postmodernen Ära und ihrer Auswirkungen auf die Konstruktion von Identität betrachtet.
Das Kapitel „Spektren der Identitätsproblematik auf der Handlungsebene“ analysiert die Identitätskrisen der Hauptfiguren Daniel Quinn und der Stillmans. Quinns Identitätsverlust wird durch den Verlust seiner Familie und die daraus resultierende Isolation ausgelöst. Er sucht nach einer neuen Identität, indem er sich in verschiedene Rollen und Figuren hineinversetzt, ohne jedoch eine dauerhafte Lösung zu finden.
Die Stillmans, Vater und Sohn, stehen ebenfalls vor der Herausforderung, ihre Identität in einer fragmentierten Welt zu finden. Stillman senior sucht nach der Ursprache der Menschheit, um die Ursachen des menschlichen Übels zu verstehen. Stillman junior hingegen leidet unter einer tiefgreifenden Identitätsstörung, die ihn zu einem „Kaspar Hauser“-artigen Charakter macht.
Das Kapitel „Die Romanstruktur und ihr Beitrag zur Identitätsproblematik“ untersucht die Rolle der Metafiktion, der Erzählstrategie und der Intertextualität in der Konstruktion der Identitätsproblematik. Die Metafiktion wird als Mittel eingesetzt, um die Grenzen zwischen Realität und Fiktion zu verwischen und die Identitätsfindung der Figuren zu untergraben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Identitätsproblematik, die Postmoderne, Metafiktion, Erzählstrategie, Intertextualität, Sprache, Kommunikation, Daniel Quinn, die Stillmans, „City of Glass“ und Paul Auster. Der Text analysiert die komplexe Darstellung der Identitätsfindung und -verlustes in der postmodernen Welt und beleuchtet die Rolle der Romanstruktur und der metafiktionalen Elemente in diesem Prozess.
- Citar trabajo
- Sarah Till (Autor), 2006, Untersuchungen des Zusammenspiels von Identitätsproblematik und Erzählstrategie in Paul Austers "City of Glass", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126587