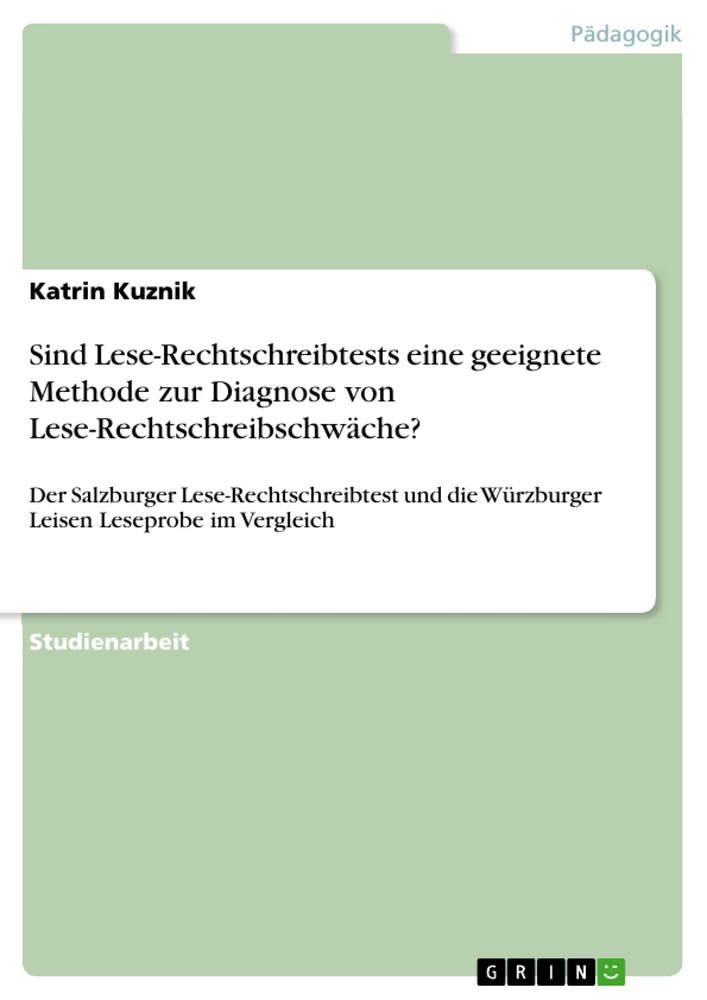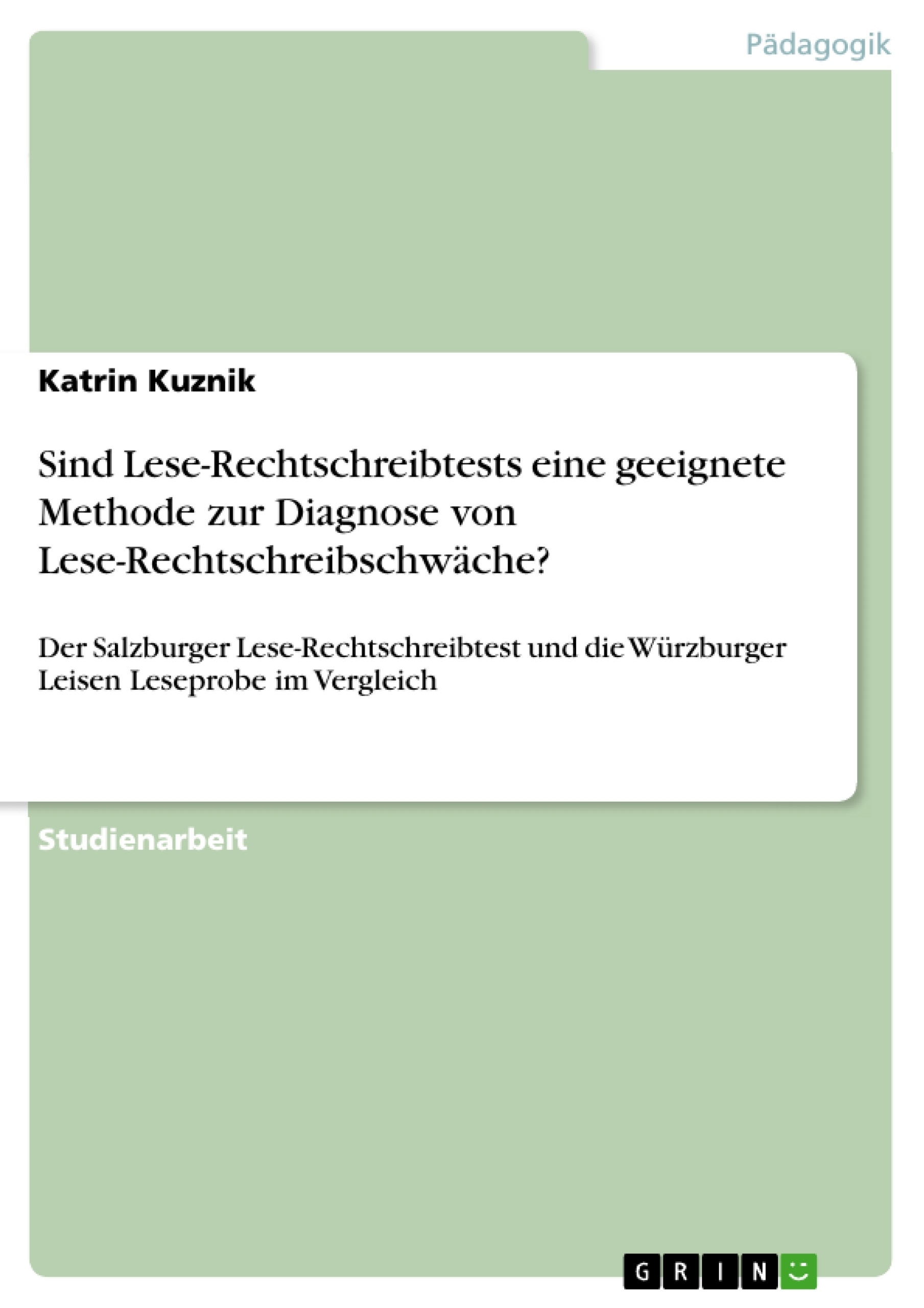Normalerweise sollten Grundschulkinder nach Beendigung des zweiten Schuljahres lesen können. Jedoch ist es in der Realität häufig so, dass ca. jeder dritte Schüler nach dem Abschluss der Grundschulzeit immer noch nicht richtig lesen kann. Nach Dr. Michael Imhof, der seit 2005 im Staatlichen Schulamt Fulda tätig ist, gelten ca. 27% eines Grundschuljahrgangs als Problemkinder bezüglich des Lese- sowie Rechtschreiberwerbs.
(vgl.http://www.lernfoerderung.de/loader/schule/lernen/lernseiten/legasthenie/lrs1.html) Wenn die Lese- Rechtschreibschwäche nicht frühzeitig erkannt wird, kann es zu Folgen wie beispielsweise Schulangst, Motivationslosigkeit oder psychosomatischen Beschwerden kommen. Um diese sowie andere Folgen, die mit der Lese- Rechtschreibschwäche auftreten können beheben zu können, muss die Lese- Rechtschreibschwierigkeit so früh, wie möglich diagnostiziert werden. Die dafür möglichen Rechtschreibtests sind auf die bestimmten Altersklassen abgestimmt und bestehen meist aus Lückentexten oder Diktaten. Die orthographische Leistung eines Schülers wird in Beziehung zur Norm gesetzt, die über eine repräsentative Eichstichprobe von einer Vielzahl von Schülern ermittelt wurde. (vgl. Hemminger, Plume, Warnke 2004, S.115)
Bezüglich der Lesetests gibt es ein eher geringes Angebot. Mittlerweile ist der Grundschulbereich zwar bestens abgedeckt, jedoch für die älteren Schüler muss immer noch auf frühere Testverfahren zurückgegriffen werden. Hierbei stellt sich die Frage, welche Diagnoseverfahren es gibt und welche von ihnen Objektivität versprechen. Hierzu gibt es verschiedene standardisierte Testverfahren, die entweder die Lese- oder die Rechtschreibdefizite eines Kindes erfassen. Es gibt aber auch Tests, die sich aus einem Lese- sowie einem Rechschreibtest zusammensetzen, um beide Leistungsbereiche überprüfen zu können. (vgl. Hemminger, Plume, Warnke 2004, S.119)
Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit zwei dieser standardisierten Testverfahren, nämlich dem Salzburger Lese- Rechtschreibtest und der Würzburger Leisen Leseprobe. Beide Verfahren sind zur Erfassung der Leseschwäche eines Kindes im Grundschulalter entwickelt worden, wobei der Salzburger Lese- Rechtschreibtest ein Beispiel für eine Methode ist, die zusätzlich die orthographische Kompetenz eines Kindes testet. Ein Vergleich dieser Verfahren soll darstellen, inwiefern die Methoden miteinander übereinstimmen bzw. sich voneinander abgrenzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition
- Leseschwäche
- Rechtschreibschwäche
- Vorraussetzungen für den Erwerb von Lesen und Schreiben
- Diagnostik
- Der Salzburger Lese- Rechtschreibtest
- Lesetest
- Rechtschreibtest
- Zuverlässigkeit
- Lesetest
- Rechtschreibtest
- Gültigkeit
- Die Würzburger Leise Leseprobe
- Gültigkeit
- Vergleich des Salzburger Lese- Rechtschreibtests mit der Würzburger Leisen Leseprobe
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Diagnostik von Lese- Rechtschreibschwächen im Grundschulalter. Sie analysiert zwei standardisierte Testverfahren, den Salzburger Lese- Rechtschreibtest und die Würzburger Leise Leseprobe, um deren Zuverlässigkeit und Gültigkeit zu untersuchen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Verfahren aufzuzeigen und einen Vergleich ihrer Eignung zur Erfassung von Leseschwächen zu ermöglichen.
- Definition und Abgrenzung von Leseschwäche und Rechtschreibschwäche
- Analyse der Vorraussetzungen für den Erwerb von Lesen und Schreiben
- Beschreibung und Bewertung des Salzburger Lese- Rechtschreibtests
- Beschreibung und Bewertung der Würzburger Leisen Leseprobe
- Vergleich der beiden Testverfahren hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit und Gültigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Lese- Rechtschreibschwäche ein und beleuchtet die Relevanz einer frühzeitigen Diagnose. Sie stellt die Problematik von Leseschwierigkeiten im Grundschulalter dar und unterstreicht die Notwendigkeit geeigneter Diagnoseverfahren.
Das zweite Kapitel definiert den Begriff der Lese- Rechtschreibstörung und differenziert zwischen Leseschwäche und Rechtschreibschwäche. Es werden die Ursachen und Merkmale dieser Störungen erläutert und die Bedeutung einer differenzierten Diagnostik hervorgehoben.
Kapitel drei befasst sich mit den Vorraussetzungen für den Erwerb von Lesen und Schreiben. Es werden die verschiedenen Teilfähigkeiten, die für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb notwendig sind, detailliert beschrieben. Die Bedeutung dieser Fähigkeiten für die Diagnose von Lese- Rechtschreibschwächen wird deutlich gemacht.
Kapitel vier gibt einen Überblick über die Diagnostik von Lese- Rechtschreibschwächen. Es werden die Kriterien der ICD-10 für die Diagnose einer Leserechtschreibschwäche erläutert und die Rolle standardisierter Tests hervorgehoben.
Kapitel fünf widmet sich dem Salzburger Lese- Rechtschreibtest. Es werden die einzelnen Komponenten des Tests, der Lesetest und der Rechtschreibtest, detailliert beschrieben. Die Zuverlässigkeit des Tests wird anhand von Daten zur Reliabilität und Validität untersucht.
Kapitel sechs beschreibt die Würzburger Leise Leseprobe. Es werden die Merkmale des Tests und seine Eignung zur Erfassung von Leseschwächen erläutert. Die Zuverlässigkeit und Gültigkeit des Tests werden ebenfalls beleuchtet.
Kapitel sieben vergleicht den Salzburger Lese- Rechtschreibtest mit der Würzburger Leisen Leseprobe. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Verfahren hinsichtlich ihrer Struktur, ihrer Durchführung und ihrer Eignung zur Diagnose von Leseschwächen herausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Lese- Rechtschreibschwäche, die Diagnostik von Leseschwierigkeiten, den Salzburger Lese- Rechtschreibtest, die Würzburger Leise Leseprobe, die Zuverlässigkeit und Gültigkeit von Testverfahren sowie die Vorraussetzungen für den Erwerb von Lesen und Schreiben. Die Arbeit analysiert die Eignung der beiden Testverfahren zur Erfassung von Leseschwächen im Grundschulalter und bietet einen Vergleich ihrer Stärken und Schwächen.
- Quote paper
- Katrin Kuznik (Author), 2006, Sind Lese-Rechtschreibtests eine geeignete Methode zur Diagnose von Lese-Rechtschreibschwäche?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126521