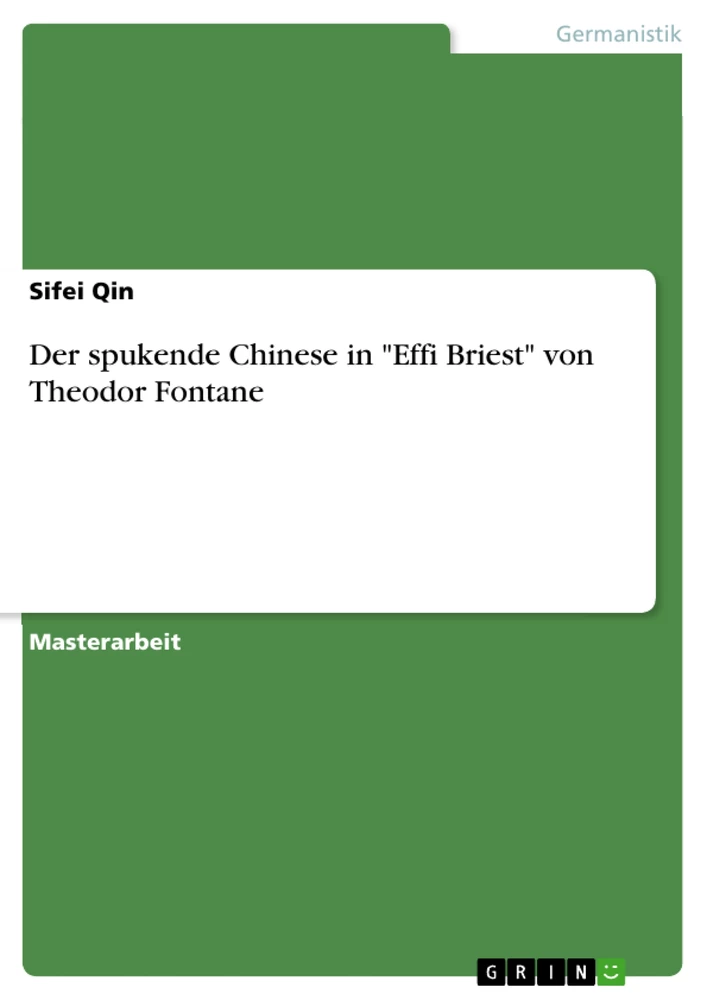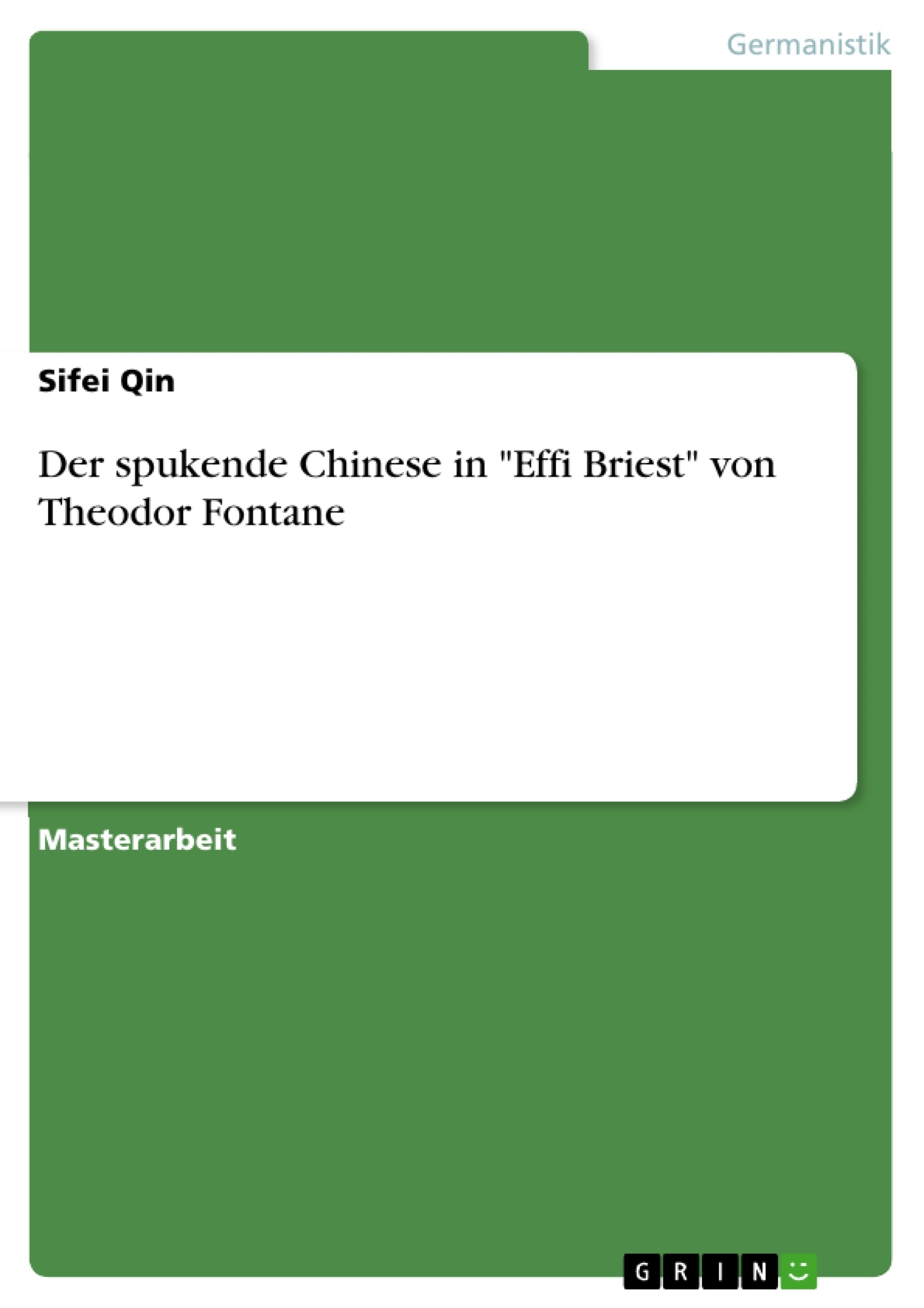Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Roman "Effi Briest" von Theodor Fontane, der im Jahre 1896 erschien. Das Werk gilt als "der absolute Höhepunkt von Fontanes realistischem Erzählwerk".
Im Roman gibt es die Gestalt eines spukenden Chinesen, der aber kein einziges Mal richtig auftaucht. Der Chinese lebte früher in Effis Haus in Kessin. Damals verschwand die Nichte eines Kapitäns, die mögliche Geliebte des Chinesen, am Tag ihrer Hochzeit. Kurz danach starb auch der Chinese. Der spukende Chinese bewegt sich seitdem auf dem Dachboden des Hauses. Effi denkt immer an ihn, wenn sie Angst hat oder sich einsam fühlt.
Der spukende Chinese ist leicht zu vernachlässigen, weil er nicht so viel Platz im Roman einnimmt. Aber Fontane legte großen Wert auf diese Figur. Er hatte einmal in einem Brief an einen Freund geklagt, dass wenige Leute auf den Chinesen achten, und er nennt den Chinesen „Drehpunkt für die ganze Geschichte". Wenn wir dies beachten, bemerken wir, dass jede Erwähnung des Chinesen im Roman zur Veränderung der Emotion und des Gefühls der Protagonistin Effi Briest führt, obwohl er nur gelegentlich auftaucht. Was bemerkenswert ist, der spukende Chinese befindet sich tatsächlich in einem Zustand von Sprachlosigkeit. Er schweigt von Anfang bis zum Ende. Eben wegen seines Schweigens besteht die Möglichkeit alle Aspekte dieser Gestalt zu interpretieren. Angesichts der Wichtigkeit des Romans in der Epoche des poetischen Realismus wurden schon viele Literaturkritiken darüber geschrieben. Aber es gibt wenige, umfassende und systematische Analysen über den spukenden Chinesen.
Es stellen sich die Fragen: was für Einflüsse hatte der Chinese auf Effis psychischen Zustand und ihr Verhalten? Welche Rolle hat der Spuk zwischen dem Ehepaar gespielt? Prophezeit der spukende Chinese eigentlich das Ende Effis? Ziel dieser Arbeit ist, diese Fragen zu antworten und die Beziehungen zwischen den spukenden Chinesen und der Protagonistin Effi Briest zu untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ziel der Arbeit
- Inhaltverzeichnis
- Forschungsstand
- Forschungsstand zum Roman Effi Briest
- Der Chinese in der deutschen Literatur bzw. in Effi Briest
- Schwerpunkt, Methodik und Aufbau der Arbeit
- DER SPUKENDE CHINESE ALS ANLASS DER ANGST
- Spukangst
- Spukangst und Einsamkeit
- Spukangst und Erotik
- Spukangst und Entfremdung
- Angst unter pathologischen Blickwinkel
- Die Hysterie
- Totentanz, Todesangst und Todestrieb
- Schuldgefühl und Gewissensangst
- Quelle der Angst: die Gesellschaft
- DER SPUKENDE CHINESE ALS ,,DAS ZWEITE GESICHT“ EFFIS
- Effis innere Ambivalenz
- Die „gesellschaftliche“ Effi
- Die unterdrückte Natur
- Die ambivalente Effi
- Die Anwesenheit und die Abwesenheit des Spuks: Effis Verhalten ihrer Natur gegenüber
- Menschennatur und Chinabild
- DER SPUKENDE CHINESE ALS INNERE ENTFREMDUNG ZWISCHEN DEM EHEPAAR
- Die Beziehung zwischen Effi und Innstetten
- Die von dem spukenden Chinesen verursachte Entfremdung
- Differenz bezüglich des Spukproblems
- Spuk als Erziehungsmittel
- DER SPUKENDE CHINESE ALS AUBENSEITER-METAPHER
- Zum Begriff des Außenseiters
- Die Gruppe bzw. die „Innenseiter\" in Effi Briest
- Zum Begriff des „Innenseiters“
- Der Vertreter: Innstetten
- Die Außenseiterin Effi und ihre Beziehung zur Gruppe
- Die aktive Außenseiterin
- Die passive Außenseiterin
- Beziehung zwischen Effi und der Gesellschaft
- Der spukende Chinese
- Der Chinese als Außenseiter
- Dachbodenmotiv
- Effi und Chinese: das gemeinsame Schicksal (Zusammenfassung)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit analysiert die Rolle des „spukenden Chinesen“ im Roman „Effi Briest“ von Theodor Fontane. Die Arbeit untersucht, wie diese Figur, obwohl sie nur selten im Text erscheint, als Motor für die Entwicklung von Effis Emotionen, inneren Konflikten und Beziehungen dient. Dabei wird der „spukende Chinese“ als Symbol für Angst, Entfremdung und die gesellschaftliche Außenseiterrolle betrachtet.
- Die Bedeutung des „spukenden Chinesen“ im Kontext von Effis Angst und innerer Zerrissenheit
- Die Verbindung des „spukenden Chinesen“ mit Effis Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung
- Die Rolle des „spukenden Chinesen“ als Metapher für die gesellschaftliche Ausgrenzung und die Ambivalenz zwischen Anpassung und Individualität
- Die Analyse des „spukenden Chinesen“ als Symbol für die Entfremdung zwischen Effi und ihrem Ehemann Innstetten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Fokus der Arbeit, den Forschungsstand und die Methodik festlegt. Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit dem „spukenden Chinesen“ als Auslöser für Effis Angst. Es wird gezeigt, wie der Chinese mit Effis Einsamkeit, Erotik und Entfremdung verbunden ist. Der zweite Teil untersucht die Rolle des „spukenden Chinesen“ in Bezug auf Effis innere Zerrissenheit. Hier wird Effi als Figur mit einer „gesellschaftlichen“ und einer unterdrückten Seite analysiert. Der dritte Teil befasst sich mit dem „spukenden Chinesen“ als Symbol für die Entfremdung zwischen Effi und Innstetten. Es wird gezeigt, wie der Chinese die unterschiedlichen Perspektiven des Paares auf die Gesellschaft und die Ehe spiegelt. Der vierte Teil betrachtet den „spukenden Chinesen“ als Außenseiter-Metapher. Es wird die Verbindung zwischen dem „spukenden Chinesen“, Effis gesellschaftlicher Position und dem Thema der Anpassung vs. Individualität analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie Angst, Entfremdung, Außenseiterrolle, Gender, Identität, und Romananalyse. Zu den wichtigen Begriffen zählen „spukender Chinese“, „Effi Briest“, „Theodor Fontane“, „Hysterie“, „Todestrieb“ und „Dachbodenmotiv“.
- Quote paper
- Sifei Qin (Author), 2012, Der spukende Chinese in "Effi Briest" von Theodor Fontane, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1264446