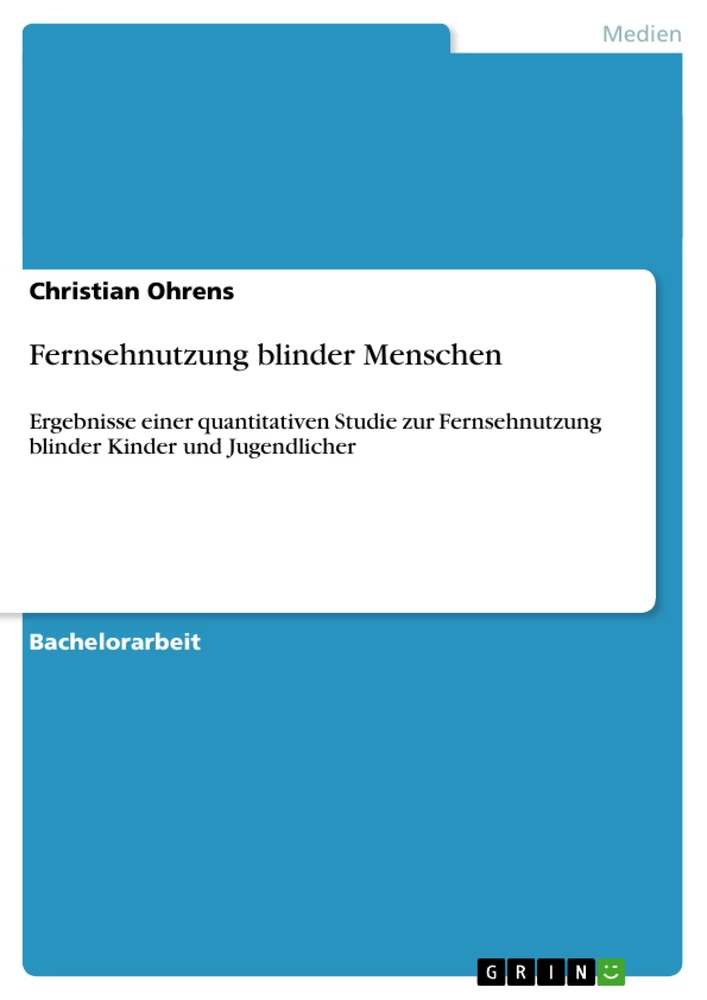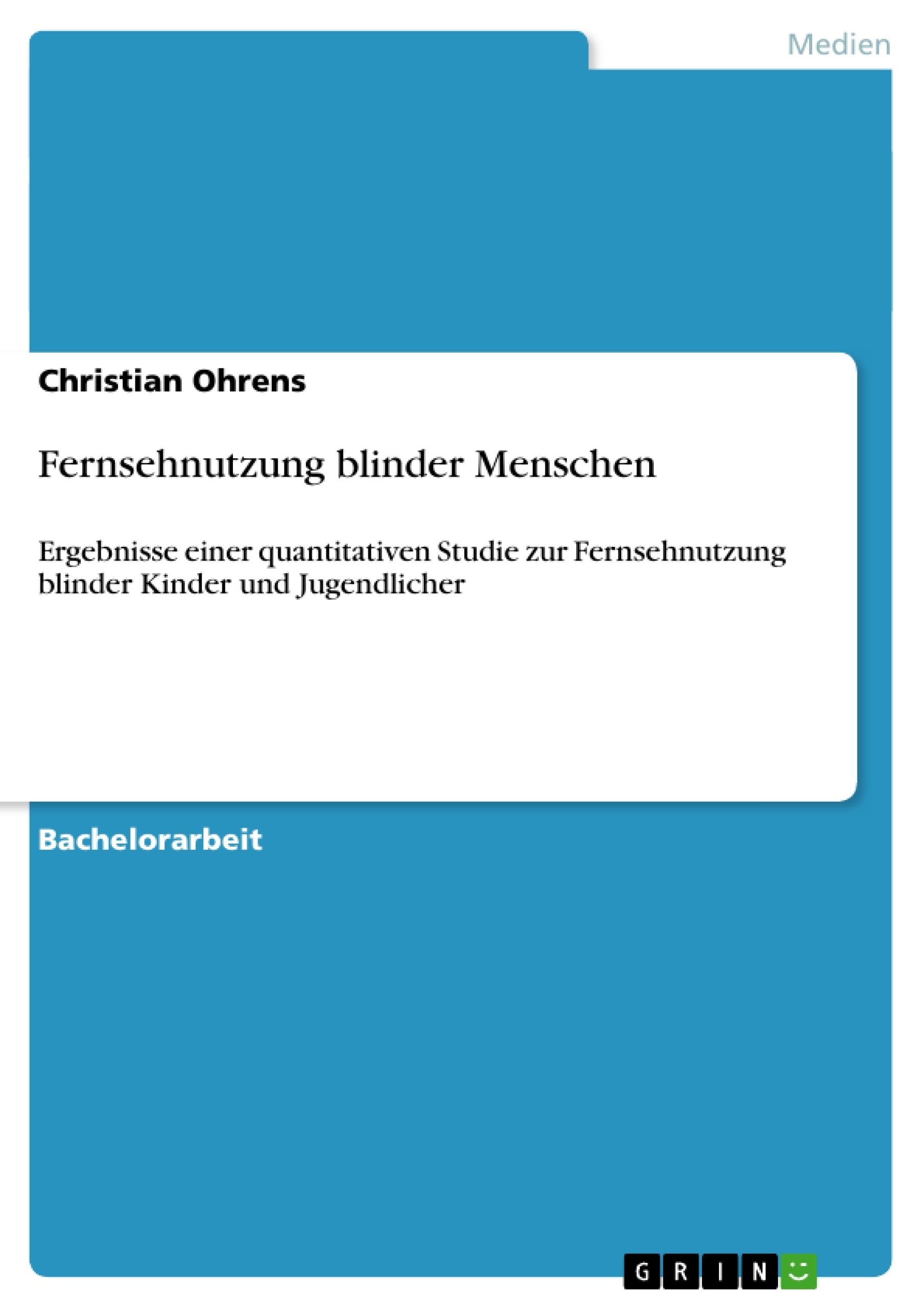Dass Menschen mit einer hochgradigen Sehbehinderung in manchen Situationen ihres Alltags eingeschränkt sind, manche Dinge dadurch ohne Hilfe Sehender vielleicht überhaupt nicht bewältigen können, ist unbestritten. Jedoch wird Seitens sehender Menschen die Situation der Alltagsgestaltung und –Bewältigung von Blinden mit all ihren Facetten und Möglichkeiten oft auch unterschätzt. Gründe hierfür sind zum einen schlichtweg die fehlenden Erfahrungen mit Menschen aus diesem Personenkreis und das mangelnde Wissen, wobei Wissen eigentlich etwas ist, das ohne weiteres vermittelt werden könnte. Hieraus resultieren Ansichten und Meinungen über Tatsachen, wie Blinde ihren Alltag meistern und ihre Freizeit gestalten, die vielleicht etwas abseits der Realität sein könnten, aber wie sollen Sehende auch ohne jegliche Erfahrung ein stimmiges Bild der Realität bekommen?
Wenn ich als selbst Betroffener mich mit Sehenden unterhalte, ihnen erzähle, dass ich (als Blinder) einen Fernseher besitze und den Tatort am vergangenen Sonntag auch „gesehen“ habe, so stößt dies meist auf verwunderte und erstaunte Blicke. Wieso nutze ich das visuell ausgelegte Medium Fernsehen, wo es doch sicherlich Medienangebote gäbe, die ich besser (blind) nutzen könnte? Meine Antwort zu dieser Frage fällt meist kurz aus: „Wieso sollte ich nicht auch den Fernseher einschalten?“.
Denn auch blinde Menschen nutzen das Medium Fernsehen und sie tun dies sogar in einem größeren Umfang, als der Sehende es sich vielleicht vorstellen würde. Allerdings wurde der Frage, in wieweit blinde Menschen das Fernsehen nutzen, in der Medien- und Kommunikationswissenschaft in Deutschland nur unzureichend nachgegangen. Ein Grund mag die kleine Gruppe der Betroffenen sein, für die die Ergebnisse relevant und interessant wären. Aber gerade für Filmproduzenten, Fernsehmachern und Filmbeschreibern sowie für Eltern oder Lehrer könnte so eine Studie Aufschluss über die Präferenzen blinder Fernsehrezipienten geben.
In dieser Arbeit wird versucht, dieser Frage, wie blinde Menschen das Fernsehen nutzen und ob es Unterschiede bei der Fernsehnutzung und den Programmpräferenzen zwischen Blinden und Sehenden gibt, anhand einer quantitativen Studie auf den Grund zu gehen.
Zu diesem Zweck wurde im Zeitraum vom 20.12.2008 bis zum 10.02.2009 eine Online-Befragung bei 12 bis 19-jährigen blinden Kindern und Jugendlichen durchgeführt, deren Ergebnisse in dieser Arbeit vorgestellt und diskutiert werden sollen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition und Zahlen
- 2.1 Definition Blindheit
- 2.2 Die Qualen der Zahlen
- 2.3 Festlegung der Zielgruppe
- 3. Forschungsstand
- 3.1 Jähriger. Ergebnisse der Fernsehnutzung 12 bis 19- JIM-Studie 2007
- 3.1.1 Fernsehbesitz
- 3.1.2 Medienbeschäftigung und Medienbindung
- 3.1.3 Fernsehnutzung nach Sendern und Genres
- 3.1.4 Medienfunktionen
- 3.2 Erhebung von Fernseh-Nutzungsdaten bei blinden und sehbehinderten Fernsehrezipienten (Dosch 1999/2004)
- 3.3 Medien-Nutzungs-Studie von Nathalie Huber (2004)
- 3.1 Jähriger. Ergebnisse der Fernsehnutzung 12 bis 19- JIM-Studie 2007
- 4. Motive und Gründe der Fernsehnutzung
- 4.1 Der Uses-And-Gratifications-Approach
- 4.1.1 Aussagen über das Publikum
- 4.1.2 Motive der Mediennutzung
- 4.1.3 Kritik
- 4.2 Mediennutzung als soziales Handeln
- 4.2.1 Aussagen über das Publikum
- 4.2.2 Kritik
- 4.1 Der Uses-And-Gratifications-Approach
- 5. Methode und Durchführung
- 5.1 Festlegung der Grundgesamtheit und der Stichprobe
- 5.2 Auswahl des Untersuchungsinstruments
- 5.3 Konzeption des Fragebogens
- 5.4 Verbreitung des Fragebogens
- 6. Ergebnisse der Befragung
- 6.1 Altersstruktur, Schul- bzw. Berufsausbildung und Geschlecht der Befragten
- 6.2 Fernsehzugang
- 6.3 Fernsehdauer
- 6.4 Bevorzugte Sendungen, Sender und Inhalte
- 6.4.1 Sendungen
- 6.4.2 Genres und Formate
- 6.4.3 Bevorzugte Sender
- 6.5 Einschaltverhalten und Nutzungsmotive
- 6.6 Umgang und Bewertung
- 6.6.1 Verhalten bei Werbeunterbrechungen
- 6.6.2 Fernsehsendungen als Gesprächsthema
- 6.6.3 Fernsehrezeption in Gruppen
- 6.6.4 Fernsehverzicht?
- 6.7 Vergleich
- 6.8 Nutzung anderer Medien
- 7. Schlussbetrachtungen und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Fernsehnutzung blinder Jugendlicher im Alter von 12 bis 19 Jahren. Ziel ist es, ein genaueres Bild von den Sehgewohnheiten, den Präferenzen und den Motiven dieser Zielgruppe zu erhalten. Die Studie soll dazu beitragen, das Verständnis für die Mediennutzung blinder Menschen zu verbessern und Hinweise für Filmproduzenten, Fernsehmacher und Pädagogen liefern.
- Fernsehnutzung blinder Jugendlicher im Vergleich zu sehenden Jugendlichen
- Motive und Gründe für die Fernsehnutzung bei blinden Jugendlichen
- Präferenzen bezüglich Sendungen, Genres und Sender
- Der Einfluss von Audiodeskription auf die Fernsehnutzung
- Die Rolle des Fernsehens im sozialen Kontext blinder Jugendlicher
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und hebt die oft unterschätzte Alltagsgestaltung und Freizeitgestaltung blinder Menschen hervor. Sie stellt die Forschungslücke bezüglich der Fernsehnutzung blinder Menschen in der Medienwissenschaft heraus und begründet die Relevanz der Studie für verschiedene Zielgruppen, wie Filmproduzenten und Pädagogen.
2. Definition und Zahlen: Dieses Kapitel liefert zunächst eine Definition von Blindheit und beleuchtet die Herausforderungen, die mit der Erhebung von Daten zu blinden Menschen verbunden sind. Es wird die Zielgruppe der Studie, blinde Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren, präzise definiert und abgegrenzt.
3. Forschungsstand: Dieses Kapitel präsentiert den aktuellen Forschungsstand zur Fernsehnutzung, insbesondere bei Jugendlichen. Es werden relevante Studien, wie die JIM-Studie und Arbeiten von Dosch und Huber, vorgestellt und deren Ergebnisse im Hinblick auf die Fragestellung der Arbeit diskutiert. Dies dient als Grundlage für die eigene Untersuchung.
4. Motive und Gründe der Fernsehnutzung: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen, die die Motive der Mediennutzung erklären. Es werden der Uses-and-Gratifications-Ansatz und die Perspektive der Mediennutzung als soziales Handeln vorgestellt und kritisch diskutiert. Diese Theorien bilden den Rahmen für die Analyse der Befragungsergebnisse.
5. Methode und Durchführung: In diesem Kapitel wird die Methodik der Studie detailliert beschrieben. Es werden die Festlegung der Grundgesamtheit und der Stichprobe, die Auswahl des Untersuchungsinstruments und die Konzeption des Fragebogens erläutert. Der Ablauf der Datenerhebung wird ebenfalls dargestellt.
6. Ergebnisse der Befragung: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es werden Daten zur Altersstruktur, zum Fernsehzugang, zur Fernsehdauer, zu den bevorzugten Sendungen, Sendern und Inhalten, zum Einschaltverhalten und zu den Nutzungsmotiven der befragten blinden Jugendlichen dargestellt und analysiert. Der Umgang mit Werbeunterbrechungen und die Rolle des Fernsehens im sozialen Kontext werden ebenfalls beleuchtet. Ein Vergleich mit der Nutzung anderer Medien wird durchgeführt.
Schlüsselwörter
Fernsehnutzung, blinde Jugendliche, Mediennutzung, Audiodeskription, JIM-Studie, qualitative Studie, Medienrezeption, Motive, Präferenzen, soziale Interaktion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Fernsehnutzung blinder Jugendlicher
Was ist der Gegenstand der Studie?
Die Studie untersucht die Fernsehnutzung blinder Jugendlicher im Alter von 12 bis 19 Jahren. Sie beleuchtet Sehgewohnheiten, Präferenzen und Motive dieser Zielgruppe und soll das Verständnis für die Mediennutzung blinder Menschen verbessern. Die Ergebnisse sollen Filmproduzenten, Fernsehmacher und Pädagogen Hinweise liefern.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Studie fokussiert auf den Vergleich der Fernsehnutzung blinder und sehender Jugendlicher, die Motive und Gründe für die Fernsehnutzung bei blinden Jugendlichen, ihre Präferenzen bezüglich Sendungen, Genres und Sender, den Einfluss von Audiodeskription und die Rolle des Fernsehens im sozialen Kontext blinder Jugendlicher.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie verwendet eine empirische Methode, basierend auf einer Befragung. Das Kapitel "Methode und Durchführung" beschreibt detailliert die Festlegung der Grundgesamtheit und Stichprobe, die Auswahl des Untersuchungsinstruments (Fragebogen), dessen Konzeption und die Verbreitung. Die Datenanalyse erfolgt im Kapitel "Ergebnisse der Befragung".
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse umfassen Daten zur Altersstruktur, zum Fernsehzugang, zur Fernsehdauer, zu den bevorzugten Sendungen, Sendern und Inhalten der befragten blinden Jugendlichen. Analysiert werden das Einschaltverhalten, Nutzungsmotive, der Umgang mit Werbeunterbrechungen und die Rolle des Fernsehens im sozialen Kontext. Ein Vergleich mit der Nutzung anderer Medien wird ebenfalls durchgeführt.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Studie stützt sich auf den Uses-and-Gratifications-Ansatz und die Perspektive der Mediennutzung als soziales Handeln. Diese Ansätze werden im Kapitel "Motive und Gründe der Fernsehnutzung" vorgestellt und kritisch diskutiert, um die Befragungsergebnisse zu analysieren.
Wie ist der Forschungsstand berücksichtigt?
Das Kapitel "Forschungsstand" präsentiert den aktuellen Forschungsstand zur Fernsehnutzung, insbesondere bei Jugendlichen. Relevante Studien wie die JIM-Studie und Arbeiten von Dosch und Huber werden vorgestellt und deren Ergebnisse im Hinblick auf die Fragestellung der Arbeit diskutiert. Dies dient als Grundlage für die eigene Untersuchung.
Welche Zielgruppen sollen von den Ergebnissen profitieren?
Die Ergebnisse der Studie sollen Filmproduzenten, Fernsehmacher und Pädagogen wertvolle Informationen liefern, um ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse und Gewohnheiten blinder Jugendlicher im Umgang mit dem Fernsehen zu entwickeln.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Schlüsselwörter sind: Fernsehnutzung, blinde Jugendliche, Mediennutzung, Audiodeskription, JIM-Studie, qualitative Studie, Medienrezeption, Motive, Präferenzen, soziale Interaktion.
Wie ist die Studie strukturiert?
Die Studie ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Definition und Zahlen, Forschungsstand, Motive und Gründe der Fernsehnutzung, Methode und Durchführung, Ergebnisse der Befragung und Schlussbetrachtungen und Fazit. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ist im HTML-Dokument enthalten.
Wo finde ich die vollständigen Ergebnisse?
Die vollständigen Ergebnisse der Studie, inklusive detaillierter Datenanalysen und Interpretationen, sind im Hauptdokument enthalten, dessen Inhaltsverzeichnis im obigen HTML-Code angezeigt wird.
- Quote paper
- Christian Ohrens (Author), 2009, Fernsehnutzung blinder Menschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126378