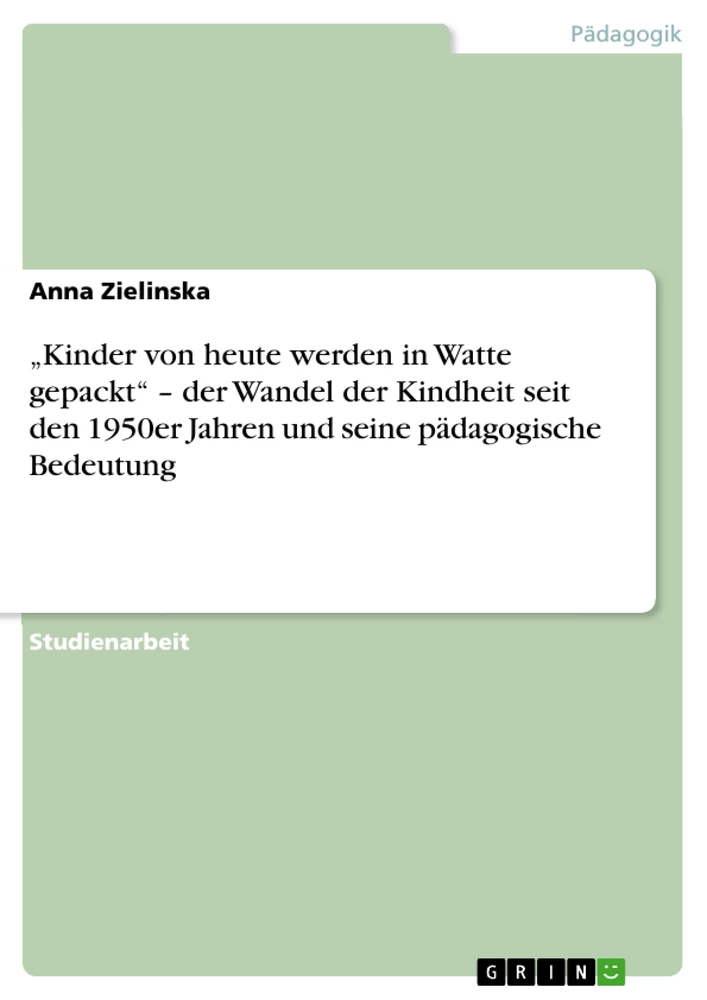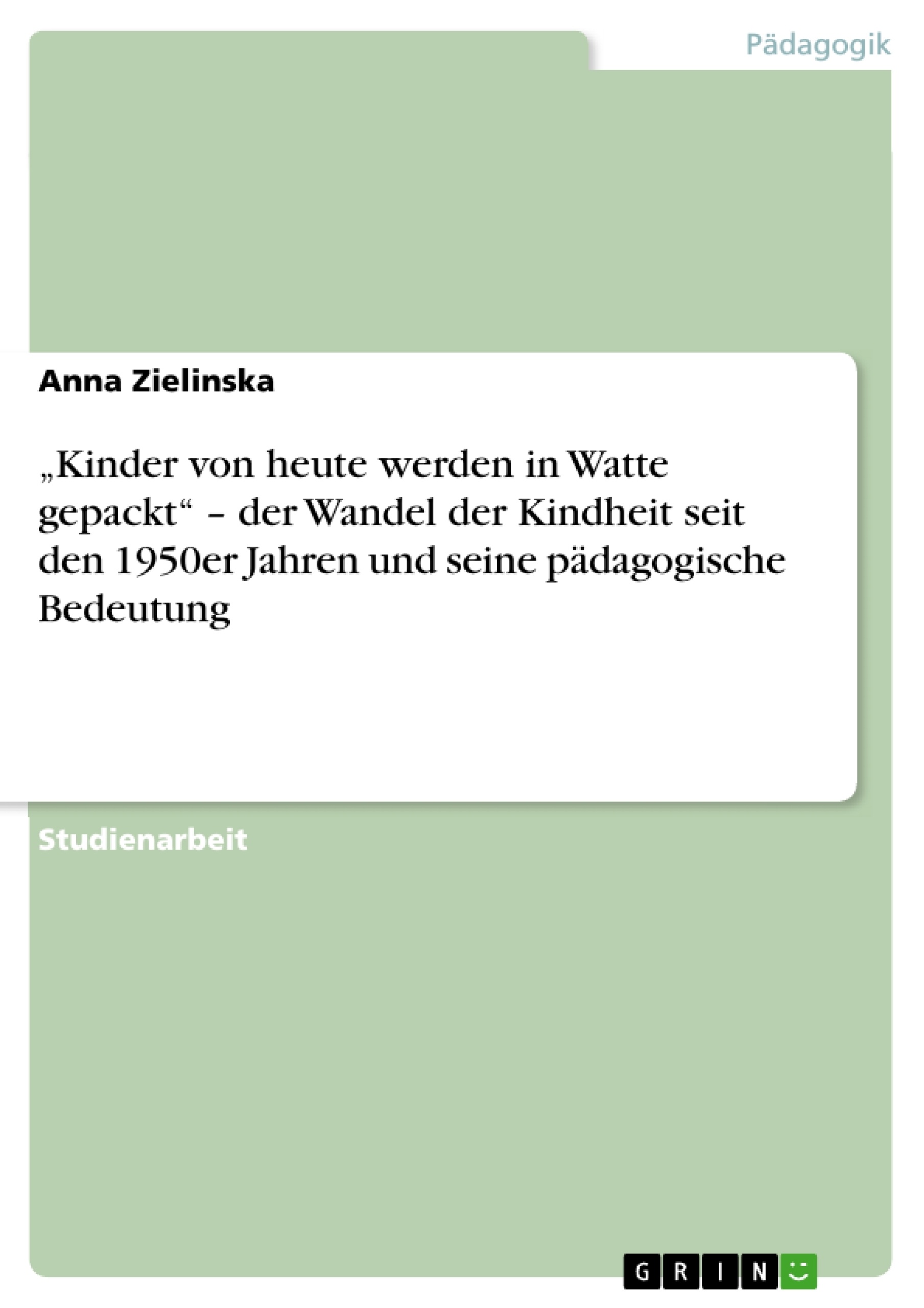Viele Menschen neigen dazu, ihre eigene Generation als die herausragende Generation anzusehen. Die eigene Kindheit wird häufig glorifiziert und die nachfolgenden Generationen von Kindern und Jugendlichen werden bestenfalls belächelt oder gar bemitleidet („Die Jugend von heute!“) wobei oftmals ein herabwürdigender Unterton mitschwingt. Ein gutes Beispiel für eine solche Perspektive ist der Text eines unbekannten Autors, der seit einigen Jahren im Internet kursiert und im Jahre 2004 vom „Stern“ unter dem Titel „Eine Generationengeschichte“ abgedruckt worden ist. Der Autor beschreibt in diesem Text seine eigene Kindheit und die der Kinder der 50er, 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie sich die Kindheit seit den 1950er Jahren bis heute gewandelt hat und inwiefern sich dieser Wandel auf die Kinder und ihre Entwicklung und auch Bildung auswirkt. Es wird die Kindheit „damals“ mit der Kindheit „heute“ verglichen um herauszufinden, wie die Bedingungen des Aufwachsens von Kindern sowie ihre Lebensweise auf ihre Entwicklung Einfluss nehmen.
Dafür wird zunächst der Versuch einer Definition von Kindheit unternommen. Nach einem historischen Überblick sollen zwei Ansichten über Kindheit als a) natürliche (psycho- und physiologische) Entwicklungsphase und b) soziales und kulturelles Konstrukt erläutert und diskutiert werden.
Der zweite Teil der Arbeit gibt einen Einblick in die kindlichen Lebenswelten der letzten 50-60 Jahre. Die Bereiche „Familie und Erziehung“, „Schule“, „Freizeit“ und „räumliche Lebensbedingungen“ sollen dabei näher untersucht werden. Dafür werden diese Lebenswelten zunächst im Verlauf der 50er, 60er und 70er Jahre dargestellt, insbesondere unter dem Aspekt des Phänomens der „Straßenkindheit“, welches der unbekannte Autor so lobend beschreibt. Danach wendet sich die Arbeit der Kindheiten der 80er, 90er und 00er Jahre zu, hierbei soll ein besonderes Augenmerk auf den Sachverhalt der Verinselung kindlicher Lebensräume gerichtet werden.
Es soll die Frage beantwortet werden, wie sich jeweilige historisch wandelbare Lebensumstände auf Kinder und auf Kindheiten auswirken. Nicht zuletzt soll auch untersucht werden, ob dem unbekannten Verfasser von „Eine Generationengeschichte“ widersprochen oder möglicherweise sogar Recht gegeben werden kann bei seiner Behauptung: „Kinder von heute werden in Watte gepackt“.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kindheit - ein mehrdimensionaler Begriff
- 2.1. Historischer Überblick
- 2.2. Kindheit als natürliche Entwicklungsphase
- 2.3. Kindheit als Konstrukt
- 2.4 Zusammenfassung
- 3. Kindheit „früher“ und Kindheit „heute“
- 3.1. „Früher“: die 50er, 60er und 70er Jahre
- 3.2 Lebenswelten der Kinder
- 3.2.1 Familie
- 3.2.2 Schule
- 3.2.3 räumliche Lebensbedingungen
- 3.2.4 Freizeit
- 3.3 „Heute“: die 80er, 90er und 00er Jahre
- 3.4 Lebenswelten der Kinder
- 3.4.1 Familie und Erziehung
- 3.4.2 Schule
- 3.4.3 Räumliche Lebensbedingungen
- 3.4.4 Freizeit
- 4. „Eine Generationengeschichte“ – nostalgische Illusion oder Tatsache?
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel der Kindheit seit den 1950er Jahren und dessen pädagogische Bedeutung. Sie vergleicht die Kindheit „damals“ mit der Kindheit „heute“, um den Einfluss der jeweiligen Lebensbedingungen auf die Entwicklung von Kindern zu analysieren. Die Arbeit hinterfragt dabei die nostalgische Sichtweise, die die eigene Kindheit idealisiert und nachfolgende Generationen abwertet.
- Definition und historische Entwicklung des Begriffs „Kindheit“
- Vergleich der Lebenswelten von Kindern in den 1950er-70er und 1980er-2000er Jahren
- Analyse des Wandels in den Bereichen Familie, Schule, Freizeit und räumliche Lebensbedingungen
- Bewertung der These, dass Kinder von heute „in Watte gepackt“ werden
- Auswirkungen des Wandels auf die Entwicklung und Bildung von Kindern
Zusammenfassung der Kapitel
2. Kindheit - ein mehrdimensionaler Begriff: Dieses Kapitel erörtert den komplexen Begriff der Kindheit. Ein historischer Überblick zeigt, wie die Anerkennung der Kindheit als eigenständige Lebensphase erst in der Aufklärung entstand. Es werden zwei zentrale Ansätze der Kindheitsforschung diskutiert: Kindheit als natürliche Entwicklungsphase und als soziales Konstrukt. Die Zusammenfassung beleuchtet die Bedeutung dieser Perspektiven für das Verständnis von Kindheit und legt die Grundlage für den Vergleich von Kindheiten verschiedener Epochen.
3. Kindheit „früher“ und Kindheit „heute“: Dieses Kapitel vergleicht die Lebenswelten von Kindern in den 1950er-70er und 1980er-2000er Jahren. Im ersten Teil wird die „Straßenkindheit“ der früheren Generationen beschrieben, charakterisiert durch mehr Freiheiten und selbstorganisiertes Spielen im öffentlichen Raum. Der zweite Teil beleuchtet die Veränderungen in den Lebenswelten der jüngeren Generationen, mit einem Fokus auf die zunehmende Verinselung kindlicher Lebensräume und die verstärkte elterliche Kontrolle. Der Vergleich soll die Unterschiede in den Entwicklungsbedingungen hervorheben.
Schlüsselwörter
Kindheit, Wandel der Kindheit, Generationenvergleich, Lebenswelten von Kindern, Familie, Schule, Freizeit, räumliche Lebensbedingungen, Entwicklungsparadigma, soziales Konstrukt, „Straßenkindheit“, Verinselung, pädagogische Bedeutung.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Wandel der Kindheit
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text untersucht den Wandel der Kindheit seit den 1950er Jahren und dessen pädagogische Bedeutung. Er vergleicht die Kindheit "damals" mit der Kindheit "heute" und analysiert den Einfluss der jeweiligen Lebensbedingungen auf die kindliche Entwicklung. Ein besonderer Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit einer nostalgischen Sichtweise, die die eigene Kindheit idealisiert und nachfolgende Generationen abwertet.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Definition und historische Entwicklung des Begriffs "Kindheit", vergleicht die Lebenswelten von Kindern in den 1950er-70er und 1980er-2000er Jahren, analysiert den Wandel in den Bereichen Familie, Schule, Freizeit und räumliche Lebensbedingungen, bewertet die These, dass Kinder von heute "in Watte gepackt" werden und untersucht die Auswirkungen des Wandels auf die Entwicklung und Bildung von Kindern.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Kindheit - ein mehrdimensionaler Begriff (mit Unterkapiteln zu historischem Überblick, Kindheit als natürliche Entwicklungsphase und als Konstrukt, sowie einer Zusammenfassung), Kindheit „früher“ und Kindheit „heute“ (mit detaillierten Vergleichen der Lebenswelten in den jeweiligen Epochen), „Eine Generationengeschichte“ – nostalgische Illusion oder Tatsache? und Fazit.
Wie werden die Lebenswelten von Kindern früher und heute verglichen?
Der Text vergleicht die Lebenswelten der Kinder der 1950er-70er Jahre (mit mehr Freiheiten und selbstorganisiertem Spielen im öffentlichen Raum, der sogenannten "Straßenkindheit") mit denen der Kinder der 1980er-2000er Jahre (mit zunehmender Verinselung kindlicher Lebensräume und verstärkter elterlicher Kontrolle). Die Unterschiede in den Bereichen Familie, Schule, Freizeit und räumliche Lebensbedingungen werden detailliert analysiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Kindheit, Wandel der Kindheit, Generationenvergleich, Lebenswelten von Kindern, Familie, Schule, Freizeit, räumliche Lebensbedingungen, Entwicklungsparadigma, soziales Konstrukt, „Straßenkindheit“, Verinselung, pädagogische Bedeutung.
Welche zentrale These wird im Text untersucht?
Eine zentrale These des Textes ist die kritische Auseinandersetzung mit der nostalgischen Verklärung der eigenen Kindheit und der damit verbundenen Abwertung nachfolgender Generationen. Der Text hinterfragt die Annahme, dass Kinder von heute "in Watte gepackt" werden und analysiert die tatsächlichen Unterschiede in den Lebensbedingungen und deren Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung.
- Quote paper
- Anna Zielinska (Author), 2008, „Kinder von heute werden in Watte gepackt“ – der Wandel der Kindheit seit den 1950er Jahren und seine pädagogische Bedeutung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126376