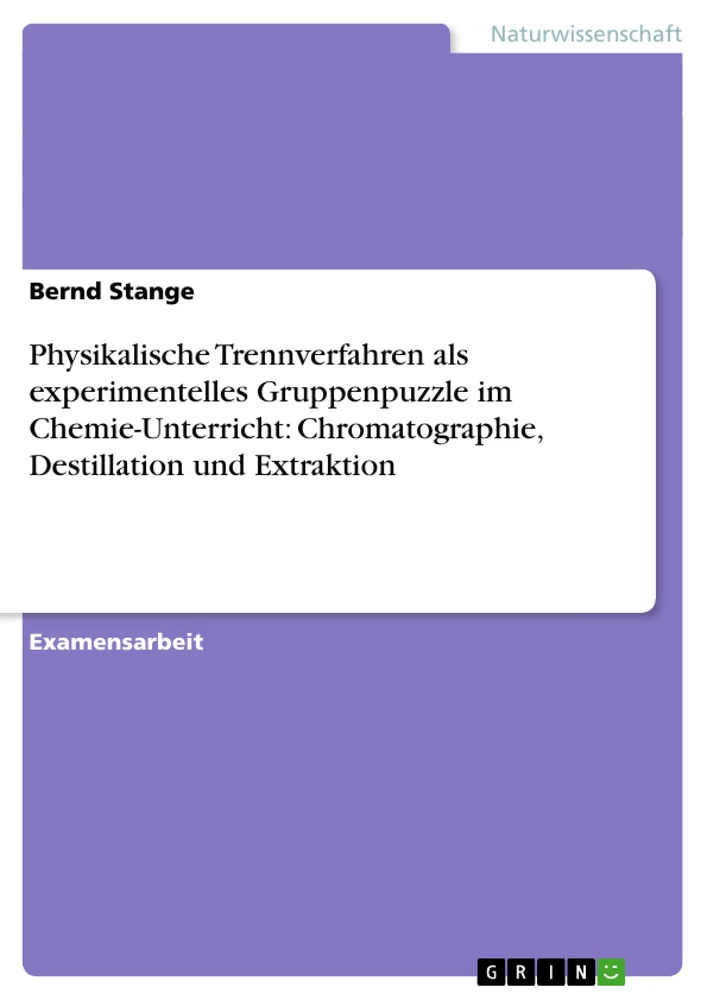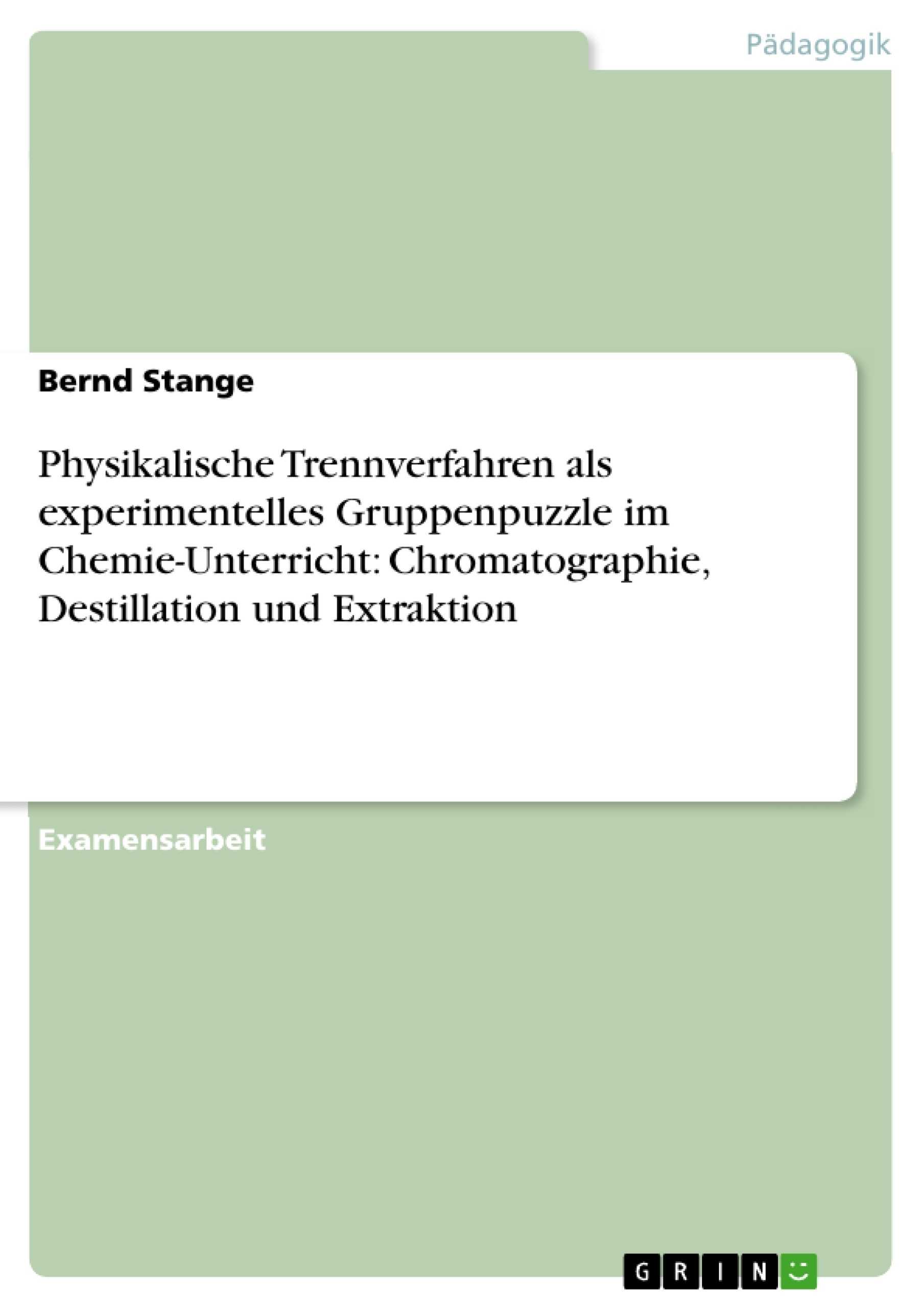Das Gruppenpuzzle (engl. jigsaw ) wurde von einer Forschergruppe um den amerika-nischen Sozialpsychologen ELLIOT ARONSON als Unterrichtsmethode für die Schule entwickelt. Mit dieser kooperativen Lernmethode sollte prosoziales Verhalten in multi-ethnischen Klassen gefördert und der Selbstwert der Schüler gesteigert sowie ihre Leistungen verbessert werden. Aus dem Gruppenpuzzle wurde eine Vielzahl weiterer kooperativer Methoden entwickelt.
Das Gruppenpuzzle wird in dieser Arbeit benutzt, um mit Schülerinnen und Schülern der Eingangsklasse eines Technischen Gymnasiums auf experimentellem Wege drei physikalische Trennverfahren (Chromatographie, Destillation und Extraktion) in einem zeitlichen Umfang von acht Unterrichtsstunden zu vertiefen. Eine schriftliche Wiederholungsarbeit rundet das Projekt als Kontrolle ab. Eine intensive Internetrecherche ergibt, dass zu Projekten dieser Art („experimentelles Gruppenpuzzle“) bislang keine Publikationen und Verweise existieren.
Das Projekt zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler konzentriert über einen längeren Zeitraum an einem Thema erfolgreich arbeiten können. Nach überwiegender Einschätzung der Lernenden ist die Auseinandersetzung mit physikalischen Trennverfahren in Form eines Gruppenpuzzles ein Erfolg.
Die statistische Analyse der Testergebnisse unter Berücksichtigung der zuvor besuchten Schulform zeigt, dass ein erheblicher Leistungsgradient zwischen ehemaligen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten und Schülerinnen und Schülern der Werkrealschule besteht: Absolventinnen und Absolventen der Werkrealschule schneiden in allen Bereichen bedeutend schlechter ab. Schülerinnen und Schüler, die von der Werkrealschule auf das Technische Gymnasium wechseln, müssen daher speziell in der Eingangsklasse besonders gefördert werden, um die Chancengleichheit zu wahren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels im Unterrichtsverständnis
- 1.2. Kooperatives Lernen als Konsequenz
- 1.3. Kooperatives Lernen versus Gruppenarbeit
- 1.4. Gruppenpuzzle nach ARONSON
- 1.5. Wirksamkeit des Gruppenpuzzles
- 2. Durchführung des Projektes
- 2.1. Hintergrund und Rahmenbedingungen
- 2.1.1. Begründung der Themenwahl
- 2.1.2. Kurze fachwissenschaftliche Darstellung
- 2.1.2.1. Chromatographie
- 2.1.2.2. Destillation
- 2.1.2.3. Extraktion
- 2.1.3. Anthropogene und soziokulturelle Rahmenbedingungen der Lerngruppe
- 2.1.4. Organisatorische Rahmenbedingungen des Unterrichts
- 2.1.5. Didaktische Analyse
- 2.1.5.1. Einbettung des Projektes in die Lehrplaneinheit
- 2.1.5.2. Stoffauswahl und didaktische Reduktion
- 2.1.5.3. Lernziele
- 2.1.6. Methodisch-mediale Analyse
- 2.1.6.1. Begründung der Methode
- 2.1.6.2. Unterrichtsmedien
- 2.2. Unterrichtspraktische Umsetzung
- 2.2.1. Hinleitung zum Projektthema
- 2.2.2. Organisation des experimentellen Gruppenpuzzles
- 2.2.3. Gruppenbildung
- 2.2.4. Die Arbeit in den Gruppen
- 2.2.4.1. Die Arbeit in den Expertengruppen
- 2.2.4.2. Die Arbeit in den Stammgruppen
- 2.2.4.3. Die Atmosphäre während des Projektes
- 2.3. Bewertung, Evaluation und Feedback
- 2.3.1. Teamwork und Engagement in den Gruppen
- 2.3.2. Versuchsprotokoll
- 2.3.3. Schriftliche Wiederholungsarbeit („Kurztest“)
- 2.3.4. Gesamtbewertung
- 2.3.5. Feedback durch die SchülerInnen
- 2.3.6. Reflexion der Rolle und Aufgaben als Lehrer
- 3. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Seminararbeit ist die experimentelle Vertiefung physikalischer Trennverfahren (Chromatographie, Destillation und Extraktion) im Chemieunterricht der Eingangsklasse eines Technischen Gymnasiums mittels der kooperativen Lernmethode "Gruppenpuzzle". Es soll untersucht werden, ob diese Methode den Lernfortschritt der SchülerInnen fördert und die heterogenen Vorbildungen der SchülerInnen berücksichtigt.
- Kooperatives Lernen und seine Effektivität
- Experimenteller Unterricht und seine Bedeutung
- Anwendung des Gruppenpuzzles im Chemieunterricht
- Analyse der Schülerleistungen unter Berücksichtigung der Vorbildung
- Reflexion der Lehrerrolle im kooperativen Lernsetting
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und begründet die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels im Unterrichtsverständnis hin zu kooperativen Lernformen. Es werden die Vorteile des kooperativen Lernens gegenüber der traditionellen Gruppenarbeit und die Methode des Gruppenpuzzles nach Aronson detailliert erläutert, inklusive der fünf Basiselemente des kooperativen Lernens. Die Wirksamkeit des Gruppenpuzzles wird anhand bestehender Forschungsergebnisse belegt, um den theoretischen Rahmen für das anschließende Projekt zu schaffen.
2. Durchführung des Projektes: Dieses Kapitel beschreibt die praktische Umsetzung des Projekts im Detail. Es beginnt mit der Begründung der Themenwahl, die auf der Kombination aus der Anwendbarkeit des Gruppenpuzzles und der Durchführung von Schülerexperimenten basiert. Eine kurze fachwissenschaftliche Darstellung der drei ausgewählten physikalischen Trennverfahren (Chromatographie, Destillation und Extraktion) folgt, bevor die anthropogenen und soziokulturellen Rahmenbedingungen der Lerngruppe, die organisatorischen Rahmenbedingungen des Unterrichts und eine didaktische Analyse des Projekts erläutert werden. Der methodische Ansatz, die eingesetzten Medien und die praktische Umsetzung des Gruppenpuzzles in Experten- und Stammgruppen werden ausführlich dokumentiert. Abschließend werden die Bewertungskriterien, die Evaluation und das Feedback der SchülerInnen dargestellt, inklusive einer Reflexion der Lehrerrolle im kooperativen Lernprozess.
Schlüsselwörter
Gruppenpuzzle, Kooperatives Lernen, Physikalische Trennverfahren, Chromatographie, Destillation, Extraktion, Chemieunterricht, Technisches Gymnasium, Schüleraktivierung, Handlungskompetenz, Leistungsbewertung, Heterogenität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Kooperatives Lernen mit Gruppenpuzzle im Chemieunterricht
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die experimentelle Vertiefung physikalischer Trennverfahren (Chromatographie, Destillation und Extraktion) im Chemieunterricht eines Technischen Gymnasiums mittels der kooperativen Lernmethode „Gruppenpuzzle“. Im Fokus steht die Frage, ob diese Methode den Lernfortschritt der Schüler fördert und die heterogenen Vorbildungen der Schüler berücksichtigt.
Welche Methode des kooperativen Lernens wird angewendet?
Die Seminararbeit verwendet das „Gruppenpuzzle“ nach Aronson als Methode des kooperativen Lernens. Das Gruppenpuzzle wird detailliert beschrieben und seine Wirksamkeit anhand bestehender Forschungsergebnisse belegt.
Welche physikalischen Trennverfahren werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die physikalischen Trennverfahren Chromatographie, Destillation und Extraktion. Diese Verfahren werden sowohl fachwissenschaftlich erläutert als auch im Rahmen der Schülerexperimente eingesetzt.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Einleitung, Durchführung des Projekts und Zusammenfassung/Fazit. Die Einleitung begründet die Notwendigkeit kooperativen Lernens und erläutert die Methode des Gruppenpuzzles. Das Kapitel „Durchführung des Projekts“ beschreibt detailliert die praktische Umsetzung, inklusive der didaktischen Planung, der methodischen Durchführung und der Evaluation. Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und zieht ein Fazit.
Welche Aspekte der Durchführung werden im Detail beschrieben?
Die detaillierte Beschreibung der Durchführung umfasst die Begründung der Themenwahl, die fachwissenschaftliche Darstellung der Trennverfahren, die anthropogenen und soziokulturellen Rahmenbedingungen der Lerngruppe, die organisatorischen Rahmenbedingungen des Unterrichts, eine didaktische Analyse, die methodisch-mediale Analyse, die praktische Umsetzung des Gruppenpuzzles (Arbeit in Experten- und Stammgruppen), die Bewertungskriterien, die Evaluation, das Feedback der Schüler und eine Reflexion der Lehrerrolle.
Wie werden die Schülerleistungen bewertet?
Die Schülerleistungen werden anhand von Teamwork und Engagement in den Gruppen, dem Versuchsprotokoll, einer schriftlichen Wiederholungsarbeit („Kurztest“) und dem Feedback der Schüler bewertet. Die Gesamtbewertung berücksichtigt alle Aspekte.
Welche Ziele verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, die Effektivität des Gruppenpuzzles im Chemieunterricht zu untersuchen, den experimentellen Unterricht zu fördern und die heterogenen Vorbildungen der Schüler zu berücksichtigen. Weiterhin wird die Rolle des Lehrers im kooperativen Lernsetting reflektiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Gruppenpuzzle, Kooperatives Lernen, Physikalische Trennverfahren, Chromatographie, Destillation, Extraktion, Chemieunterricht, Technisches Gymnasium, Schüleraktivierung, Handlungskompetenz, Leistungsbewertung, Heterogenität.
Welche Lernergebnisse werden angestrebt?
Die angestrebten Lernergebnisse umfassen das vertiefte Verständnis physikalischer Trennverfahren, die Entwicklung von Handlungskompetenzen durch experimentelle Arbeit und die Förderung des kooperativen Lernens. Die Schüler sollen ihr Wissen durch die Gruppenarbeit und den Kurztest festigen.
Für wen ist diese Seminararbeit relevant?
Diese Seminararbeit ist relevant für Lehramtsstudierende, Chemielehrer und alle Interessierten, die sich mit kooperativen Lernmethoden und dem experimentellen Chemieunterricht beschäftigen.
- Arbeit zitieren
- Dr. Bernd Stange (Autor:in), 2007, Physikalische Trennverfahren als experimentelles Gruppenpuzzle im Chemie-Unterricht: Chromatographie, Destillation und Extraktion, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126215