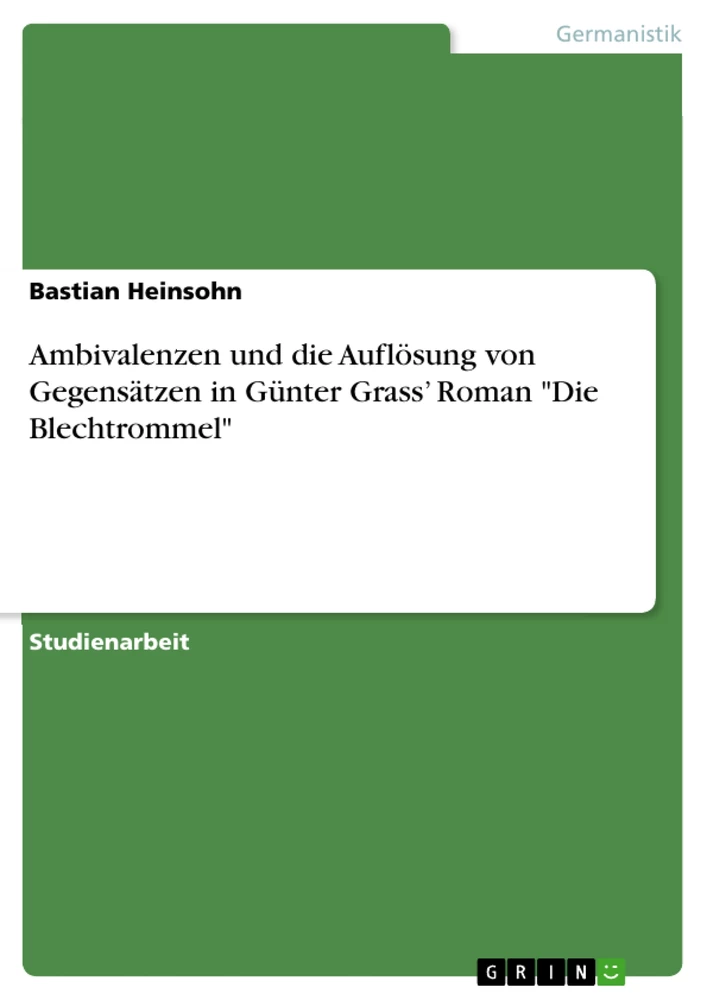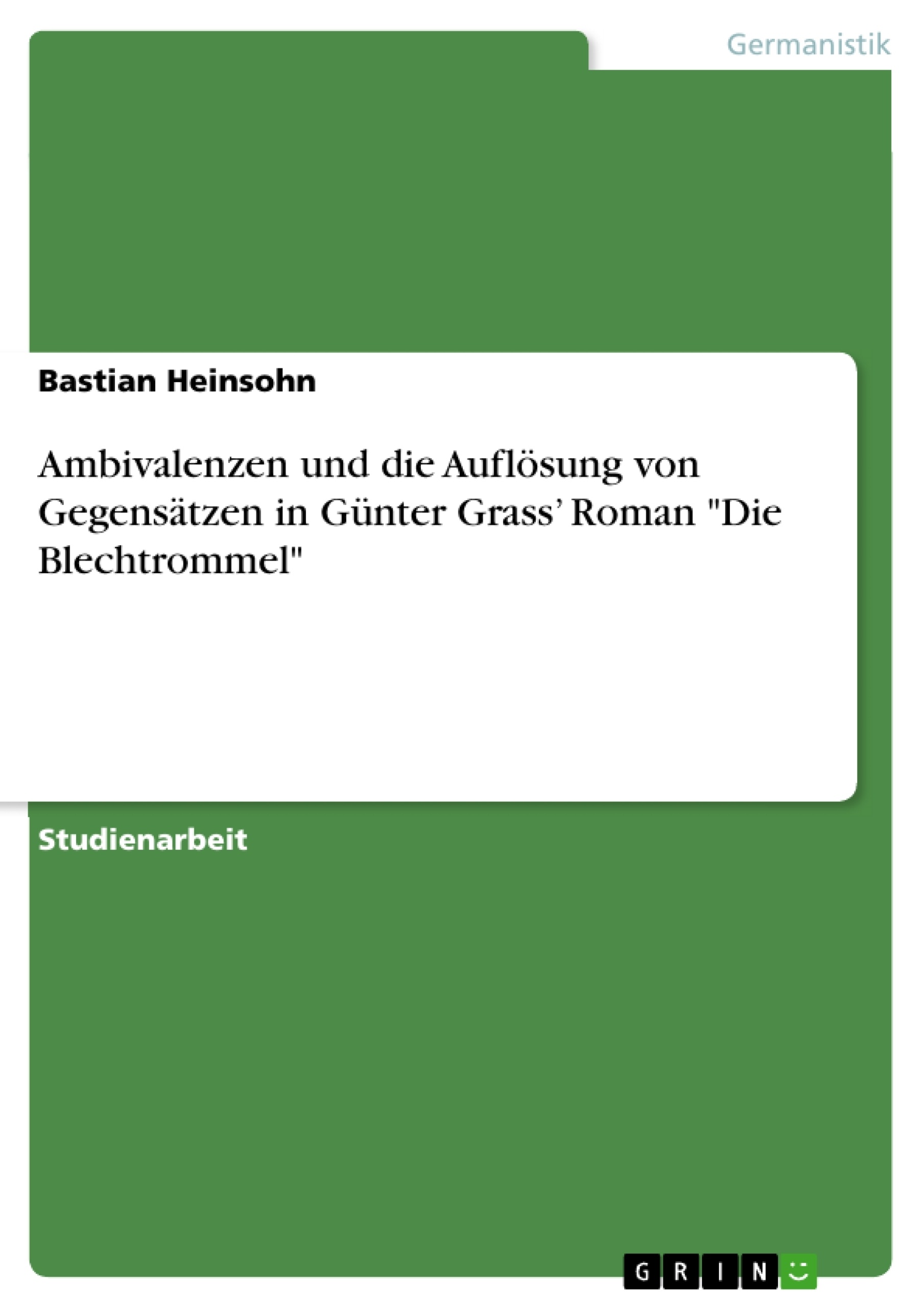Der 1959 veröffentlichte Roman Die Blechtrommel von Günter Grass
handelt von den Deutschen vor und während der zwölfjährigen Naziherrschaft
sowie in der Nachkriegszeit. Der Roman thematisiert jedoch weder Krieg,
Soldatenschicksale, Ideologien noch historische Großereignisse, sondern
beschreibt eine durch Passivität geprägte deutsche Gesellschaft in ihrer
Konfrontation mit dem Dritten Reich und mit ihrer anschließenden
Vergangenheitsbewältigung.
Aus der Sicht des Protagonisten Oskar Matzerath beschreibt Grass das
Verhalten der Deutschen in dieser Zeit, das sich neben Passivität auch
insbesondere durch ein hohes Maß an Widersprüchlichkeit und Ambivalenzen
auszeichnet. Trennlinien werden verwischt, Gegensätze aufgehoben und Dinge
und Aussagen verlieren ihre Eindeutigkeit. Ambivalenzen ziehen sich wie ein roter
Faden durch den Roman und sind Auslöser des schizophrenen Zustands, in dem
sich die Deutschen nach den Kriegserlebnissen unweigerlich wiederfinden. Die
Blechtrommel bringt das Dilemma der Deutschen zur Sprache: Ihre Unfähigkeit,
aktiv Stellung zu ihrer Vergangenheit zu beziehen, ihre Rolle im Krieg eindeutig zu
definieren, Verantwortung zu übernehmen und individuelle Schuld zu bekennen. In
der Unfähigkeit der Deutschen zu einer eigenen eindeutigen Positionierung
insbesondere im Umgang mit ihrer eigenen Geschichte und in der Täter/Opfer Frage bezüglich des Zweiten Weltkrieges sieht Grass eine Charaktereigenschaft,
die er in seinem Roman durch Ambivalenzen unterschiedlichster Art darstellt.
Grass sieht in der Passivität der Romanfiguren den Ursprung ihrer ambivalenten
Situation: Ihre Passivität hat fatale Folgen, die sie von Opfern zunächst zu Zeugen
und schließlich zu aktiven Tätern werden lassen. In der erzählten Geschichte des
Romans reichen sie bis zurück in die Zeit vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Ambivalenzen und die Auflösung von Gegensätzen
- Passivität und ihre fatalen Folgen
- Zirkulärer Geschichtsverlauf und die Wiederkehr des Gleichen
- Kreativität und Destruktivität in der Figur Oskars
- Die Karfreitagsepisode: Tod und Leben, Weiblichkeit und Männlichkeit
- Verwischung der Trennlinien zwischen Kategorien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es, die Ambivalenzen und die Auflösung von Gegensätzen in Günter Grass' Roman "Die Blechtrommel" zu analysieren. Der Fokus liegt auf der Darstellung der deutschen Gesellschaft vor, während und nach dem Dritten Reich, insbesondere auf deren Passivität und Widersprüchlichkeit im Umgang mit der Vergangenheit.
- Darstellung der deutschen Gesellschaft im Umgang mit dem Nationalsozialismus
- Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten als Charaktereigenschaften der Figuren
- Auflösung von Gegensätzen wie Kreativität und Destruktivität, Ordnung und Chaos
- Zirkulärer Geschichtsverlauf und die Unfähigkeit zur Vergangenheitsbewältigung
- Verwischung von Geschlechterrollen und Identitäten
Zusammenfassung der Kapitel
Ambivalenzen und die Auflösung von Gegensätzen: Dieses Kapitel analysiert die zentrale Rolle von Ambivalenzen in Grass' Roman. Es zeigt, wie die Vermischung von Gegensätzen die deutsche Gesellschaft in einem Zustand der Schizophrenie festhält und ihre Unfähigkeit zur klaren Positionierung im Umgang mit der Vergangenheit offenbart. Die Ambivalenz wird als Auslöser für Passivität und die Verweigerung der Verantwortungsübernahme dargestellt. Die fehlende Eindeutigkeit in Aussagen und Handlungen der Figuren spiegelt die moralische Verwirrung der Nachkriegszeit wider.
Passivität und ihre fatalen Folgen: Dieses Kapitel beleuchtet die Passivität als ursächlichen Faktor der ambivalenten Situation der Romanfiguren. Es wird gezeigt, wie diese anfängliche Passivität zu fatalen Konsequenzen führt, die die Figuren von Opfern zu Zeugen und schließlich zu aktiven Tätern werden lässt. Die Geschichte reicht bis in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zurück und verdeutlicht die kontinuierliche Entwicklung dieser Dynamik.
Zirkulärer Geschichtsverlauf und die Wiederkehr des Gleichen: Hier wird der nicht-lineare, zirkuläre Geschichtsverlauf des Romans untersucht. Symbole wie Oskars Weigerung zu wachsen und die wiederkehrenden Röcke der Anna Bronski verdeutlichen die Wiederkehr des Gleichen und die Unmöglichkeit, der Vergangenheit zu entkommen. Die Verknüpfung von Zeugung und Tod unterstreicht die zyklische Natur der Geschichte und die immer wiederkehrende Konfrontation mit der Vergangenheit.
Kreativität und Destruktivität in der Figur Oskars: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Oskar Matzerath, dessen Trommel sowohl kreatives als auch destruktives Potenzial verkörpert. Oskars Handlungen zeigen die Unfähigkeit zur Unterscheidung zwischen Kreativität und Destruktivität, Ordnung und Chaos. Sein Handeln überschreitet moralische Grenzen und verdeutlicht die Vermischung von Kunst und Zerstörung, die eng mit der deutschen Geschichte verknüpft ist.
Die Karfreitagsepisode: Tod und Leben, Weiblichkeit und Männlichkeit: Die Analyse der Karfreitagsepisode zeigt die Verschmelzung von Tod und Leben, die symbolisch für den gesamten Roman steht. Der Pferdekopf als zentrales Symbol wird als sowohl weiblich als auch männlich interpretiert, was die Auflösung von Geschlechtergrenzen verdeutlicht. Die Verknüpfung mit dem Aal als Phallussymbol und die Episode der unfruchtbaren Frau unterstreichen diese Verschmelzung weiter.
Verwischung der Trennlinien zwischen Kategorien: In diesem Kapitel werden die verschiedenen Beispiele für die Auflösung von Kategorien wie Geschlecht und Alter analysiert. Die Figuren Jan Bronski, Oskar Matzerath und Greff veranschaulichen die Verwischung von Geschlechterrollen und die Unmöglichkeit, klare Identitäten zuzuordnen. Oskars physisches und psychisches Alter wird als Beispiel für die Aufhebung der Trennlinie zwischen Kindsein und Erwachsensein verwendet.
Schlüsselwörter
Die Blechtrommel, Günter Grass, Ambivalenz, Passivität, Zweiter Weltkrieg, Vergangenheitsbewältigung, Zirkularität, Kreativität, Destruktivität, Geschlechterrollen, Identität, Deutschland, Nachkriegszeit.
Häufig gestellte Fragen zu Günter Grass' "Die Blechtrommel"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Ambivalenzen und die Auflösung von Gegensätzen in Günter Grass' Roman "Die Blechtrommel". Der Fokus liegt auf der Darstellung der deutschen Gesellschaft vor, während und nach dem Dritten Reich, insbesondere auf deren Passivität und Widersprüchlichkeit im Umgang mit der Vergangenheit.
Welche Themen werden im Roman behandelt und wie werden sie analysiert?
Die Analyse umfasst zentrale Themen wie die Passivität der deutschen Gesellschaft im Umgang mit dem Nationalsozialismus, die Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten der Figuren, die Auflösung von Gegensätzen (Kreativität/Destruktivität, Ordnung/Chaos), den zirkulären Geschichtsverlauf und die Unfähigkeit zur Vergangenheitsbewältigung, sowie die Verwischung von Geschlechterrollen und Identitäten. Jedes Kapitel der Arbeit widmet sich einem dieser Aspekte.
Welche Kapitel umfasst die Analyse und worum geht es in jedem einzelnen?
Die Analyse gliedert sich in Kapitel zu: Ambivalenzen und die Auflösung von Gegensätzen (Analyse der zentralen Rolle von Ambivalenzen und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft), Passivität und ihre fatalen Folgen (Untersuchung der Passivität als Ursache für fatale Konsequenzen), Zirkulärer Geschichtsverlauf und die Wiederkehr des Gleichen (Analyse des nicht-linearen Geschichtsverlaufs und der Wiederholung von Mustern), Kreativität und Destruktivität in der Figur Oskars (Analyse von Oskars ambivalentem Handeln), Die Karfreitagsepisode: Tod und Leben, Weiblichkeit und Männlichkeit (Interpretation der Karfreitagsepisode und der Verschmelzung von Gegensätzen), und Verwischung der Trennlinien zwischen Kategorien (Analyse der Auflösung von Kategorien wie Geschlecht und Alter).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Roman und die Analyse?
Schlüsselwörter sind: Die Blechtrommel, Günter Grass, Ambivalenz, Passivität, Zweiter Weltkrieg, Vergangenheitsbewältigung, Zirkularität, Kreativität, Destruktivität, Geschlechterrollen, Identität, Deutschland, Nachkriegszeit.
Wie wird die Ambivalenz im Roman dargestellt?
Die Ambivalenz wird als zentrales Merkmal der deutschen Gesellschaft dargestellt, die durch die Vermischung von Gegensätzen in einem Zustand der Schizophrenie gefangen ist und eine klare Positionierung im Umgang mit der Vergangenheit vermeidet. Diese Ambivalenz wird als Auslöser für Passivität und die Verweigerung der Verantwortungsübernahme gesehen.
Welche Rolle spielt die Passivität im Roman?
Die anfängliche Passivität der Figuren führt zu fatalen Konsequenzen, die sie von Opfern zu Zeugen und schließlich zu aktiven Tätern werden lässt. Die Analyse zeigt die kontinuierliche Entwicklung dieser Dynamik über einen längeren Zeitraum.
Wie wird der Geschichtsverlauf im Roman beschrieben?
Der Geschichtsverlauf wird als nicht-linear und zirkulär beschrieben. Symbole wie Oskars Weigerung zu wachsen und wiederkehrende Motive verdeutlichen die Wiederkehr des Gleichen und die Unmöglichkeit, der Vergangenheit zu entkommen.
Welche Rolle spielt Oskar Matzerath in der Analyse?
Oskar Matzerath verkörpert mit seiner Trommel sowohl kreatives als auch destruktives Potenzial. Sein Handeln zeigt die Unfähigkeit zur Unterscheidung zwischen Kreativität und Destruktivität, Ordnung und Chaos, und überschreitet moralische Grenzen.
Welche Bedeutung hat die Karfreitagsepisode?
Die Karfreitagsepisode symbolisiert die Verschmelzung von Tod und Leben und die Auflösung von Geschlechtergrenzen. Symbole wie der Pferdekopf und der Aal unterstreichen diese Verschmelzung.
Wie werden Kategorien im Roman aufgehoben?
Der Roman zeigt die Auflösung von Kategorien wie Geschlecht und Alter. Die Figuren veranschaulichen die Verwischung von Geschlechterrollen und die Unmöglichkeit, klare Identitäten zuzuordnen. Oskars Alter wird als Beispiel für die Aufhebung der Trennlinie zwischen Kindsein und Erwachsensein verwendet.
- Quote paper
- M.A. Bastian Heinsohn (Author), 2004, Ambivalenzen und die Auflösung von Gegensätzen in Günter Grass’ Roman "Die Blechtrommel", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126183