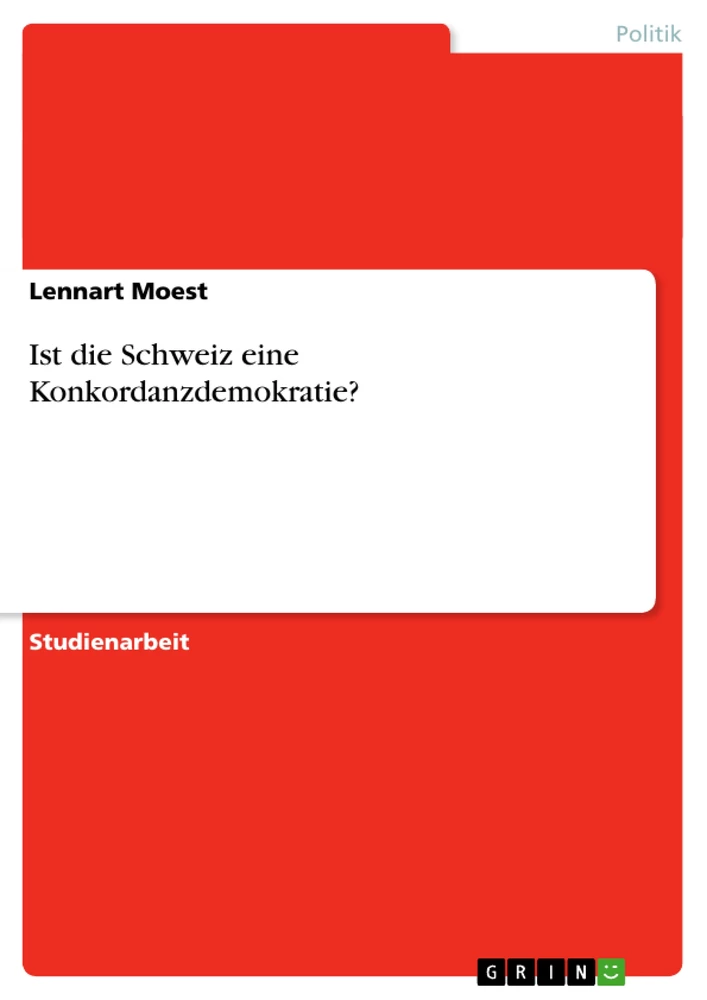Das Konzept der Konkordanzdemokratie wurde erstmals 1604 vom deutschen Politikphilosoph Althusius beschrieben. Erst 1967 wurde es durch Lehmbruch, unter dem Namen „Proporzdemokratie“ (vgl. Lehmbruch 1991 S. 13), wieder aufgegriffen und ein Jahr später durch Lijphart in der Politikwissenschaft bekannt (vgl. Andeweg 2000 S. 510). Bezeichnend für die Konkordanzdemokratie ist vor allem die Regelung von „Konflikten weder nach dem Mehrheitsprinzip noch durch Befehl“ (Schmidt 2000 S. 328) sondern durch „amicable agreements“ (Andeweg 2000 S. 511).
Für viele Autoren und Wissenschaftler, darunter auch Lijphart und Lehmbruch, gilt die Schweiz als Paradebeispiel einer Konkordanzdemokratie. Es gibt aber auch Gegenstimmen, die die Schweiz aufgrund unterschiedlicher Einwände, nicht als Konkordanzdemokratie einstufen (vgl. Sciarini/Hug 1999 S. 135). Selbst Lijphart ordnet die Schweiz zusätzlich zur Konkordanztheorie auch der Konsenstheorie zu (vgl. Lijphart 1999 S. 34-41). Dies ist dadurch zu erklären dass beide Theorien sehr eng beieinander liegen und andere „core consociational countries“ (Andeweg 2000 S. 513) wie Österreich in Lijpharts neuerer Typologie sogar stark in Richtung Mehrheitswahlsystemen eingeschätzt werden (Andeweg 2000 S. 513). Gerade nachdem sich die „Magische Formel“, die als Symbol für die Schweizer Konkordanzdemokratie bekannt wurde (vgl. Sciarini/Hug S. 139), seit den Wahlen 2003 verändert hat, bleibt die Frage, ob die Schweiz eine Konkordanzdemokratie ist, aktuell und umstritten. Diese Arbeit möchte die unterschiedlichen Meinungen vorstellen und gegeneinander abwägen, um festzustellen, ob die Schweiz eine Konkordanzdemokratie ist oder nicht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Theorie der Konkordanzdemokratie
- 3. Die Theorie der Konkordanzdemokratie im Bezug auf die Schweiz
- 3.1. Die Besonderheiten des Schweizer Politiksystems
- 3.1.1. Der Föderalismus
- 3.1.2. Direkte Demokratie
- 3.2. Erfüllt die Schweiz die Bedingungen der Konkordanztheorie?
- 3.2.1. Tief zerklüftete Gesellschaft
- 3.2.2. Entscheidungsfindung entgegen der Mehrheitsregel
- 3.2.3. Vetorechte aller relevanten Bevölkerungsgruppen und deren Einbezug in die Regierung
- 3.2.4. Proportionalität bei der Besetzung von Politischen Ämtern
- 3.2.5. Einflusssphären jeder Bevölkerungsgruppe in bestimmten Bereichen
- 3.1. Die Besonderheiten des Schweizer Politiksystems
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob die Schweiz den Kriterien einer Konkordanzdemokratie entspricht. Sie beleuchtet die Theorie der Konkordanzdemokratie und analysiert, inwieweit die spezifischen Merkmale des Schweizer Politiksystems – insbesondere Föderalismus und direkte Demokratie – mit dieser Theorie übereinstimmen.
- Definition und Charakteristika der Konkordanzdemokratie
- Analyse des Schweizer Politiksystems im Hinblick auf die Kriterien der Konkordanztheorie
- Bewertung der Übereinstimmung zwischen Theorie und Praxis im Schweizer Kontext
- Die Rolle des Föderalismus und der direkten Demokratie im Schweizer Konkordanzmodell
- Diskussion der Kontroversen um die Einstufung der Schweiz als Konkordanzdemokratie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach der Einstufung der Schweiz als Konkordanzdemokratie. Sie skizziert den historischen Kontext des Konkordanzdemokratie-Konzepts und hebt die bestehenden kontroversen Meinungen zu seiner Anwendung auf die Schweiz hervor. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz, der die Analyse der fünf zentralen Bedingungen der Konkordanztheorie und die Berücksichtigung der spezifischen Schweizer Besonderheiten wie Föderalismus und direkte Demokratie umfasst. Die Einleitung legt den Grundstein für die nachfolgende detaillierte Untersuchung.
2. Die Theorie der Konkordanzdemokratie: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Konkordanzdemokratie. Es erklärt, wie Konkordanzdemokratien in tief zerklüfteten Gesellschaften entstehen, in denen sich Konfliktlinien nicht überschneiden. Das Kapitel erläutert die Bedeutung von „cross-pressured“ Individuen und das „vote maximization“ Spiel. Die Bedeutung von Konsensfindung anstelle von Mehrheitsentscheidungen, die Gewährung von Vetorechten an relevante Bevölkerungsgruppen und die Notwendigkeit von Proportionalität bei der Besetzung politischer Ämter werden ausführlich diskutiert. Das Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die spätere Anwendung auf den Schweizer Fall dar und betont die Bedeutung von Kompromissen und „package deals“ zur Aufrechterhaltung der politischen Stabilität.
3. Die Theorie der Konkordanzdemokratie im Bezug auf die Schweiz: Dieses Kapitel analysiert die Anwendbarkeit der Konkordanztheorie auf die Schweiz. Es untersucht die Besonderheiten des Schweizer Politiksystems, insbesondere den Föderalismus und die direkte Demokratie, im Kontext der Konkordanztheorie. Es wird detailliert geprüft, ob die Schweiz die fünf Bedingungen der Konkordanztheorie erfüllt: tief zerklüftete Gesellschaft, Entscheidungsfindung jenseits des Mehrheitsprinzips, Vetorechte für relevante Gruppen, proportionale Besetzung politischer Ämter und Einflusssphären für verschiedene Gruppen. Der Wandel der „Magischen Formel“ seit 2003 und deren Auswirkungen auf die Einordnung der Schweiz werden diskutiert. Das Kapitel bietet eine umfassende Analyse der Übereinstimmung und der Abweichungen zwischen dem Schweizer System und dem Modell der Konkordanzdemokratie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Konkordanzdemokratie in der Schweiz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht, ob die Schweiz den Kriterien einer Konkordanzdemokratie entspricht. Sie analysiert die Theorie der Konkordanzdemokratie und deren Anwendbarkeit auf das Schweizer politische System, unter Berücksichtigung von Föderalismus und direkter Demokratie.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Charakteristika der Konkordanzdemokratie, die Analyse des Schweizer Politiksystems im Hinblick auf die Kriterien der Konkordanztheorie, die Bewertung der Übereinstimmung zwischen Theorie und Praxis im Schweizer Kontext, die Rolle des Föderalismus und der direkten Demokratie im Schweizer Konkordanzmodell und die Diskussion der Kontroversen um die Einstufung der Schweiz als Konkordanzdemokratie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Einleitung, 2. Die Theorie der Konkordanzdemokratie, 3. Die Theorie der Konkordanzdemokratie im Bezug auf die Schweiz und 4. Fazit (letzteres ist im vorliegenden Auszug nicht enthalten).
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Einstufung der Schweiz als Konkordanzdemokratie, skizziert den historischen Kontext, die kontroversen Meinungen und den methodischen Ansatz der Arbeit. Sie legt den Grundstein für die detaillierte Untersuchung.
Was wird im Kapitel zur Konkordanzdemokratie-Theorie erläutert?
Dieses Kapitel definiert den Begriff der Konkordanzdemokratie, erklärt ihre Entstehung in tief zerklüfteten Gesellschaften, die Bedeutung von „cross-pressured“ Individuen und „vote maximization“, die Bedeutung von Konsensfindung, Vetorechten und proportionaler Besetzung politischer Ämter. Es legt die theoretischen Grundlagen für die spätere Anwendung auf die Schweiz dar.
Wie wird die Konkordanztheorie auf die Schweiz angewendet?
Das Kapitel zur Anwendung der Theorie auf die Schweiz analysiert die Besonderheiten des Schweizer Systems (Föderalismus und direkte Demokratie) im Kontext der Konkordanztheorie. Es prüft detailliert, ob die Schweiz die fünf zentralen Bedingungen der Konkordanztheorie erfüllt (tief zerklüftete Gesellschaft, Entscheidungsfindung jenseits des Mehrheitsprinzips, Vetorechte, proportionale Besetzung politischer Ämter und Einflusssphären für verschiedene Gruppen). Der Wandel der „Magischen Formel“ seit 2003 und dessen Auswirkungen werden diskutiert.
Welche konkreten Aspekte des Schweizer Politiksystems werden untersucht?
Die Arbeit untersucht insbesondere den Föderalismus und die direkte Demokratie in der Schweiz und deren Einfluss auf die Einstufung als Konkordanzdemokratie. Sie analysiert auch die "Magische Formel" und deren Entwicklung.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen (basierend auf dem Auszug)?
Der vorliegende Auszug enthält kein Fazit. Die Schlussfolgerungen sind somit nicht ersichtlich.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht und dient der Analyse von Themen im Bereich der Politikwissenschaft.
- Quote paper
- Lennart Moest (Author), 2008, Ist die Schweiz eine Konkordanzdemokratie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126128