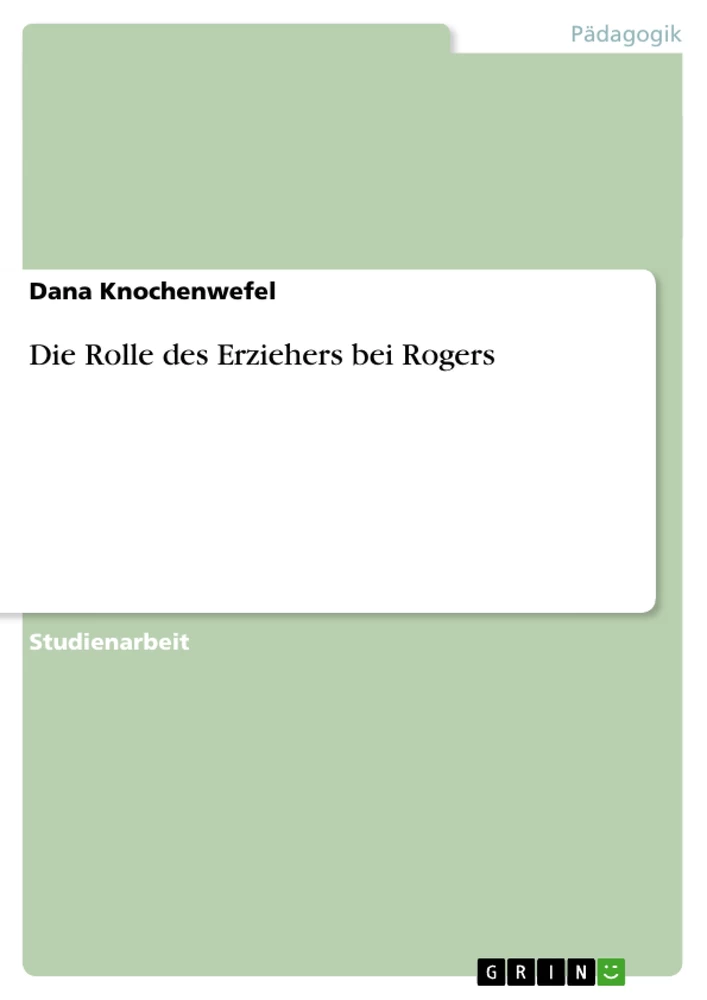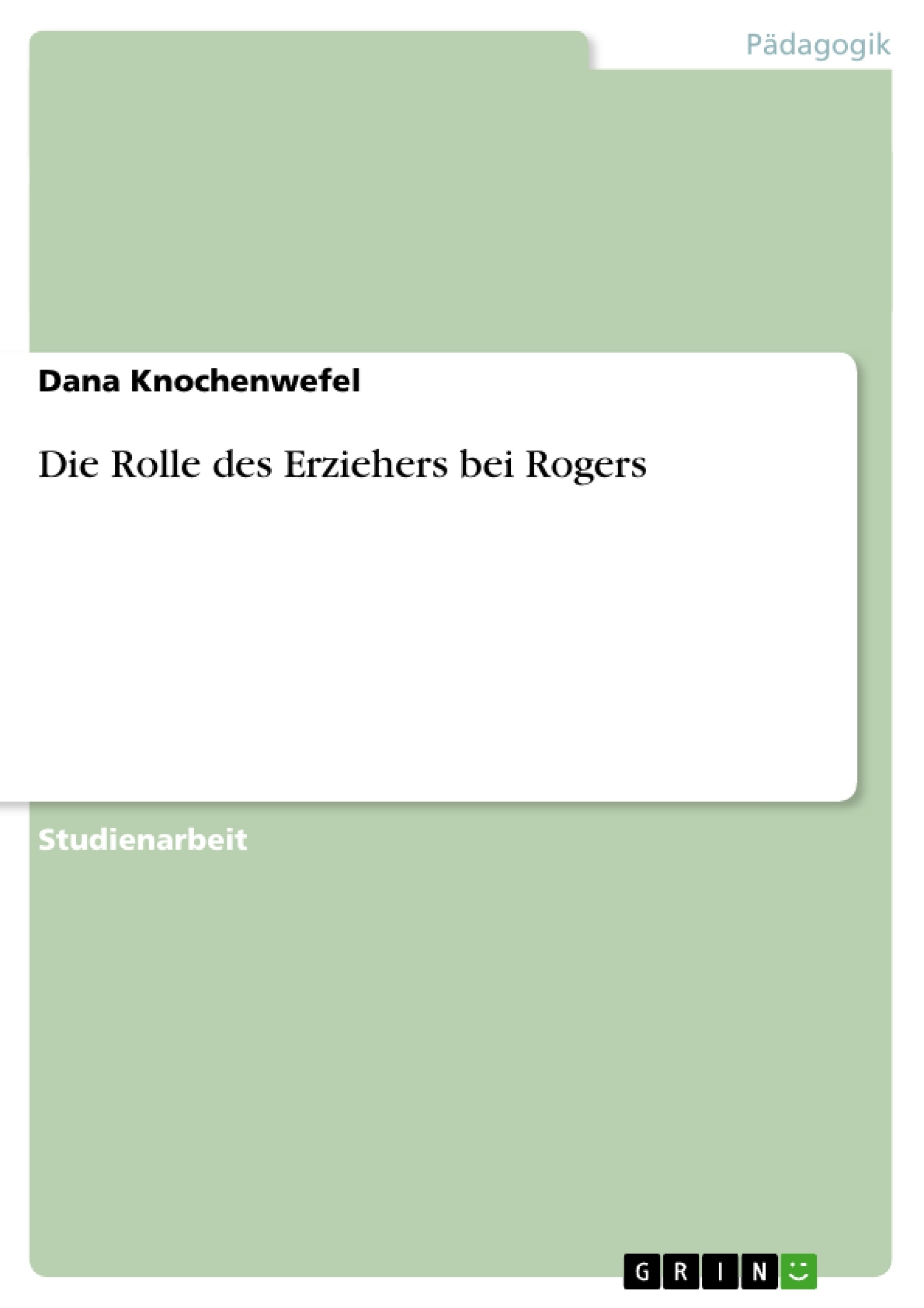Um zu einer angemessenen Beurteilung und Einordnung von Carl Rogers‘ Idee eines
erfolgreichen Lehrens und Lernens zu kommen, bedarf es einiger Klärungen und näherer
Erläuterungen. Insbesondere Rogers' Auffassung vom Menschen an sich, sein Menschenbild,
spielen für das Verstehen seines Bildungsansatzes eine entscheidende Rolle. In dieser Arbeit
soll also zunächst ein kurzer Abriss über die Anthropologie des Carl Rogers als Grundlage für
die darauffolgende Darstellung des Bildungsverständnisses Carl Rogers‘ dienen. Die
Illustration des Ansatzes einer erfolgreichen Lernerförderung nach Rogers wird hier die
größte Beachtung finden. Abschließend soll eine kritische Untersuchung und Beurteilung
versuchen eine neutrale und zeitgemäße Einordnung zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Rogers' Grundhaltung zur Lehre und der Rolle des Lehrenden
- Das Menschenbild in der Persönlichkeitstheorie Carl Rogers‘
- Das Selbst und das Selbstkonzept
- Tendenz zur Selbstaktualisierung
- Kongruenz und Inkongruenz
- Die Grundhaltung des Lehrenden
- Der traditionell Lehrende
- Der personenzentriert Lehrende
- Die drei lernfördernden Qualitäten des Lehrenden
- Bedingungslose positive Zuwendung
- Einfühlendes Verstehen - Empathie
- Echt-sein, Real-sein, Kongruenz
- Die drei lernfördernden Qualitäten des Lehrenden
- Die Aufgaben des Lehrenden
- Ein politisches Problem
- Rogers' Theorie in der schulischen Praxis – ein Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Carl Rogers' pädagogischen Ansatz und seine zugrundeliegende Anthropologie. Ziel ist es, Rogers' Bildungsverständnis darzustellen und kritisch zu bewerten, um eine zeitgemäße Einordnung zu ermöglichen. Der Fokus liegt auf der Illustration von Rogers' Ansatz zur Lernerförderung.
- Rogers' humanistisches Menschenbild und seine Abgrenzung von anderen psychologischen Ansätzen
- Das Konzept des Selbst und des Selbstkonzepts nach Rogers
- Die Bedeutung der Selbstaktualisierungstendenz für Lernen und Entwicklung
- Die drei zentralen Haltungen des personenzentrierten Lehrenden: bedingungslose positive Zuwendung, Empathie und Kongruenz
- Die Anwendung von Rogers' Theorie in der schulischen Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Rogers' Grundhaltung zur Lehre und der Rolle des Lehrenden: Dieser einleitende Abschnitt erläutert die Notwendigkeit, Rogers' Menschenbild zu verstehen, um seinen pädagogischen Ansatz zu erfassen. Er kündigt eine Darstellung des Bildungsverständnisses und eine kritische Beurteilung an, wobei die Illustration der Lernerförderung im Mittelpunkt steht. Die Arbeit verspricht eine neutrale und zeitgemäße Einordnung von Rogers' Ideen.
Das Menschenbild in der Persönlichkeitstheorie Carl R. Rogers: Dieses Kapitel beschreibt Rogers' humanistisches Menschenbild, das von einem im Wesentlichen positiven Menschen ausgeht, der nach Wachstum und Selbstverwirklichung strebt. Es betont die Abgrenzung zu psychoanalytischen Ansätzen und hebt Rogers' Vertrauen in die positive Entwicklungsrichtung des Menschen hervor, selbst bei Individuen mit asozialem Verhalten. Der phänomenologische Ansatz mit seiner Betonung von subjektiven Wahrnehmungen und Erfahrungen steht im Gegensatz zu den psychoanalytischen Grundlagen.
Die Grundhaltung des Lehrenden: Aufbauend auf dem zuvor dargestellten Menschenbild, erläutert dieses Kapitel Rogers' Übertragung seiner therapeutischen Ansätze auf die Pädagogik. Der Fokus liegt auf der Grundhaltung des Lehrenden, die auf Vertrauen in den Lernenden und dessen Selbstaktualisierungstendenz basiert. Der Schüler steht im Mittelpunkt des Lernprozesses. Rogers' Aussage „Man kann dem Lernenden trauen“ wird als zentrales Element dieser Haltung hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Carl Rogers, Personzentrierte Pädagogik, Humanistisches Menschenbild, Selbstaktualisierung, Selbstkonzept, Kongruenz, Inkongruenz, Bedingungslose positive Zuwendung, Empathie, Kongruenz des Lehrenden, Lernerförderung, Pädagogischer Ansatz.
Häufig gestellte Fragen zu: Carl Rogers' Personzentrierte Pädagogik
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Carl Rogers' pädagogischen Ansatz und seine zugrundeliegende Anthropologie. Sie beschreibt Rogers' Bildungsverständnis, bewertet es kritisch und ordnet es zeitgemäß ein. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung von Rogers' Ansatz zur Lernerförderung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Rogers' humanistisches Menschenbild, das Selbst- und Selbstkonzept, die Bedeutung der Selbstaktualisierungstendenz für Lernen und Entwicklung, die drei zentralen Haltungen des personenzentrierten Lehrenden (bedingungslose positive Zuwendung, Empathie und Kongruenz) sowie die Anwendung von Rogers' Theorie in der schulischen Praxis. Es wird auch ein Vergleich zu anderen psychologischen Ansätzen, insbesondere zu psychoanalytischen Ansätzen, gezogen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Rogers' Grundhaltung zur Lehre und der Rolle des Lehrenden, seinem Menschenbild, der Grundhaltung des Lehrenden (inkl. der drei lernfördernden Qualitäten), den Aufgaben des Lehrenden, einem politischen Problem (nähere Details fehlen in der Zusammenfassung) und einem Fazit zur Anwendung von Rogers' Theorie in der schulischen Praxis. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Was ist Rogers' Menschenbild?
Rogers vertritt ein humanistisches Menschenbild, das von einem im Wesentlichen positiven Menschen ausgeht, der nach Wachstum und Selbstverwirklichung strebt. Es betont die Abgrenzung zu psychoanalytischen Ansätzen und hebt Rogers' Vertrauen in die positive Entwicklungsrichtung des Menschen hervor. Der phänomenologische Ansatz mit seiner Betonung von subjektiven Wahrnehmungen und Erfahrungen steht im Gegensatz zu den psychoanalytischen Grundlagen.
Welche drei zentralen Haltungen sollte ein personenzentrierter Lehrender haben?
Nach Rogers sollte ein personenzentrierter Lehrender bedingungslose positive Zuwendung, Empathie und Kongruenz zeigen. Diese drei Qualitäten fördern das Lernen und die Entwicklung des Schülers.
Welche Rolle spielt die Selbstaktualisierung in Rogers' Pädagogik?
Die Selbstaktualisierungstendenz ist ein zentrales Element in Rogers' Theorie. Er geht davon aus, dass jeder Mensch ein angeborenes Streben nach Wachstum und Selbstverwirklichung besitzt. Der Lehrende sollte diese Tendenz unterstützen und Vertrauen in die Fähigkeit des Lernenden haben, sich selbst zu entfalten.
Wie wird Rogers' Theorie in der schulischen Praxis angewendet?
Die Arbeit untersucht die Anwendung von Rogers' Theorie in der schulischen Praxis, liefert aber in dieser Zusammenfassung keine konkreten Details dazu.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Carl Rogers, Personzentrierte Pädagogik, Humanistisches Menschenbild, Selbstaktualisierung, Selbstkonzept, Kongruenz, Inkongruenz, Bedingungslose positive Zuwendung, Empathie, Kongruenz des Lehrenden, Lernerförderung, Pädagogischer Ansatz.
- Quote paper
- Dana Knochenwefel (Author), 2008, Die Rolle des Erziehers bei Rogers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126088