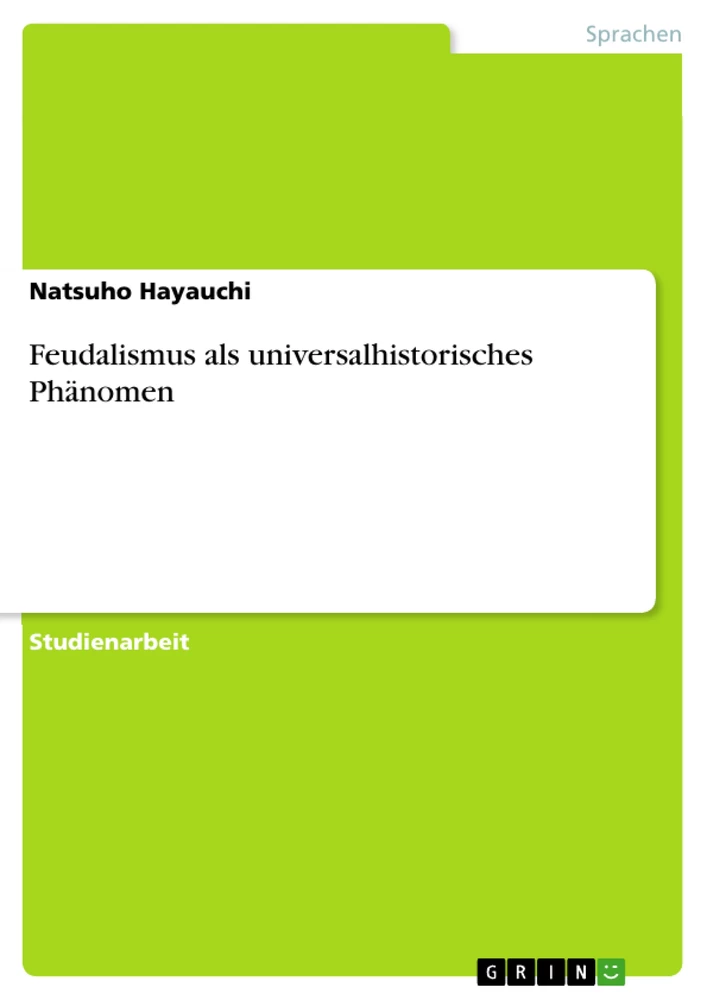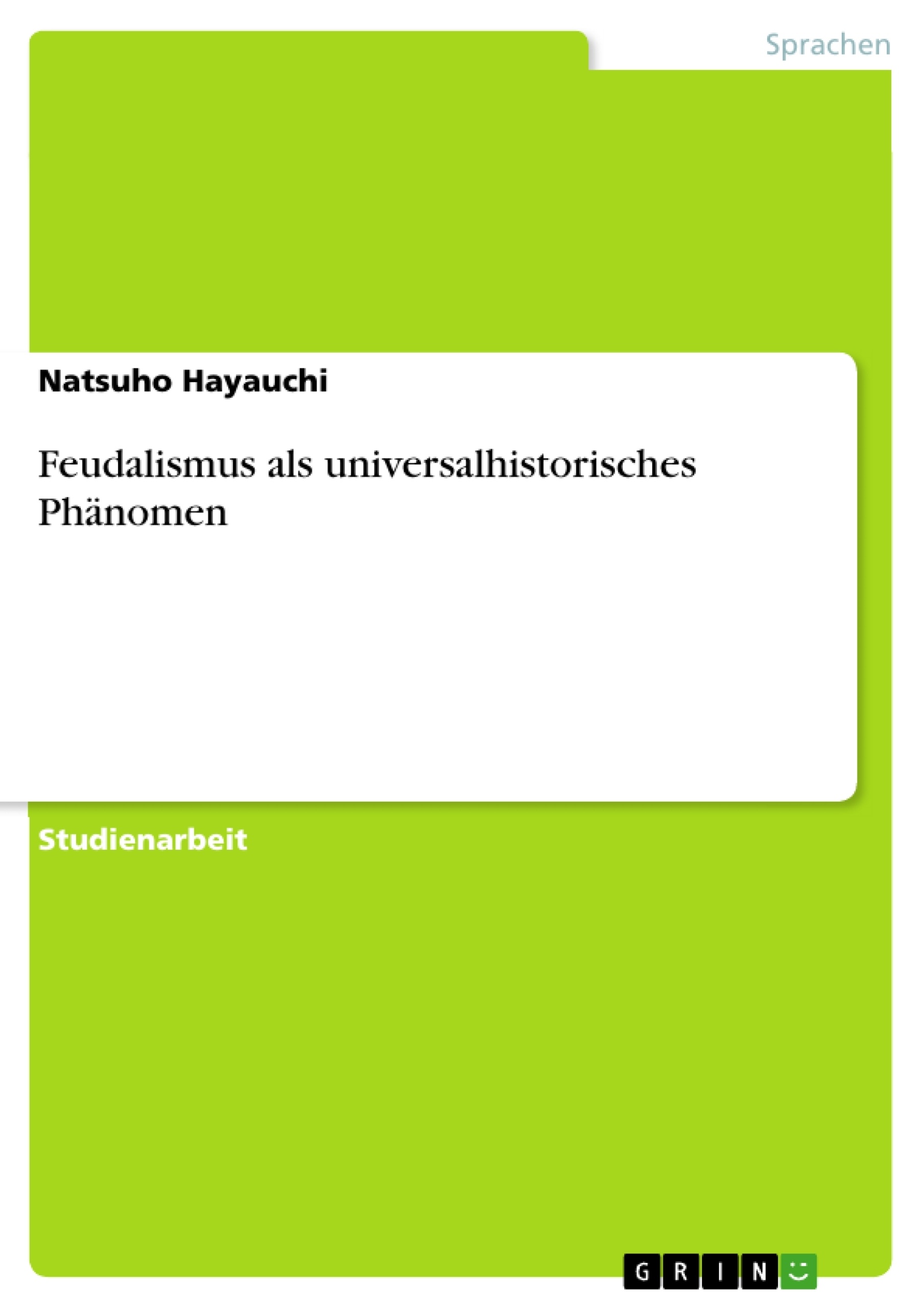Feudalismus ist ein Begriff, der in der geschichtlichen, wirtschaftlichen und soziologischen Forschung für kontroverse Meinungen sorgte. Daraus resultierte eine lang andauernde Diskussionsreihe. Das Hauptproblem bestand darin, dass es keine klare, eindeutige Definition des Begriffs und des Wesens des Feudalismus gab. Feudalismus wurde oftmals unter den engen Begriff des Lehnswesens gefasst. In der deutschen Mittelalterforschung befasste man sich mit dem „Lehnswesen“ als rechtliches und politisches Phänomen. Das Interesse entstand während der Erforschung der Teilung des deutschen Reiches. Man führte die Zersplitterung auf ein dezentralisiertes Gesellschafts- und Herrschaftssystem zurück, was zur Tiefenforschung des Mittelalters, unter besonderer Berücksichtigung der sozialen und politischen Situation führte.
Drei wesentliche Feudalismuskonzeptionen werden von Otto Hintze, Max Weber und den Marxisten-Leninisten vorgelegt. Die verschiedenen Auffassungen unterscheiden sich vor allem in der Betrachtungsweise des Feudalismus-Begriffs bzw. in der unterschiedlichen Vorgehensweise der jeweiligen Feudalismuskonzeptionen. Fundierte Analysen dieser Konzepte von Historikern, deren Arbeits- und Denkweise durch derzeitige Strömungen in der Wissenschaftswelt beeinflusst wurde, bildeten die vier wichtigsten Schulen der bürgerlichen Geschichtsschreibung. Sie geben die verschiedenen Rezeptionen von Feudalismus wieder. Die politisch-typologische, die sozialgeschichtliche, die formaljuristische und die west-deutsche „Gegenwartsschule“. In meiner Darstellung möchte ich weniger auf die einzelnen Schulen eingehen, viel mehr möchte ich die drei wesentlichen Feudalismuskonzeptionen vorstellen. Otto Hintze soll hier als Vertreter der politisch-typologischen Schule bzw. der sozio-historischen Rezeption fungieren. Max Weber repräsentiert eine konkrete Auffassung von Feudalismus als Herrschaftsform. Des weiteren werde ich kurz die Gedanken Karl Marx´ vorstellen, der die historisch-materialistische Betrachtungsweise vertritt. Schließlich werde ich zum Abschnitt: „Feudalismusdiskussion in der DDR“ überleiten. (Kuchenbuch: 199)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Feudalismuskonzeptionen und Rezeptionen
- Die Feudalismuskonzeption bei Otto Hintze – die sozio-historische Rezeption
- Die Feudalismuskonzeption von Max Weber – Feudalismus als Herrschaftsform
- Die Feudalismusrezeption von Karl Marx – Feudalismus aus historisch-materialistischer Sicht
- Feudalismus-Diskussion in der DDR
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Feudalismus als universalhistorisches Phänomen und analysiert unterschiedliche Konzeptionen und Rezeptionen dieses Begriffs in der Geschichtswissenschaft. Sie beleuchtet die Debatten um die Definition und das Wesen des Feudalismus und untersucht die verschiedenen Perspektiven bedeutender Denker.
- Definition und Wesen des Feudalismus
- Unterschiedliche Konzeptionen des Feudalismus bei Hintze, Weber und Marx
- Die Rolle des Lehnswesens
- Feudalismus als Herrschaftsform
- Die Feudalismusdebatte in der DDR
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Feudalismusbegriff als kontrovers diskutierten Begriff in der Geschichts-, Wirtschafts- und Soziologieforschung, der aufgrund fehlender eindeutiger Definitionen zu langwierigen Debatten führte. Sie hebt die Fokussierung auf das Lehnswesen in der deutschen Mittelalterforschung hervor und benennt drei zentrale Feudalismuskonzeptionen (Hintze, Weber, Marx-Leninismus), deren unterschiedliche Betrachtungsweisen den Schwerpunkt der Arbeit bilden. Die Einleitung legt den Grundstein für die Analyse der verschiedenen Schulen der bürgerlichen Geschichtsschreibung, wobei der Fokus auf den drei genannten Konzeptionen liegt.
Feudalismuskonzeptionen und Rezeptionen: Dieses Kapitel analysiert die Feudalismuskonzeptionen von Otto Hintze, Max Weber und Karl Marx. Hintze beschreibt Feudalismus als ein geschlossenes System von Einrichtungen und als eine Tendenz der Staats- und Ständebildung, wobei er den "Idealtypus" zur begrifflichen Klärung nutzt und die Anwendbarkeit des Begriffs auf verschiedene Kulturen hinterfragt. Weber fokussiert sich auf Feudalismus als Herrschaftsform. Marx liefert eine historisch-materialistische Perspektive. Das Kapitel vergleicht und kontrastiert diese drei Ansätze und zeigt ihre unterschiedlichen Schwerpunkte und methodischen Vorgehensweisen auf.
Feudalismus-Diskussion in der DDR: Dieses Kapitel (welches im vorliegenden Textfragment nicht vorhanden ist, und somit nicht zusammengefasst werden kann) würde sich voraussichtlich mit der spezifischen Rezeption und Interpretation des Feudalismusbegriffs in der DDR auseinandersetzen, unter Berücksichtigung des damaligen politischen und ideologischen Kontextes. Es würde wahrscheinlich die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zur westdeutschen Debatte hervorheben und die spezifischen Bedingungen der geschichtswissenschaftlichen Forschung in der DDR beleuchten.
Schlüsselwörter
Feudalismus, Lehnswesen, Herrschaftsform, Otto Hintze, Max Weber, Karl Marx, historisch-materialistische Sicht, sozio-historische Rezeption, politisch-typologische Schule, DDR, Geschichtswissenschaft, Idealtypus.
Häufig gestellte Fragen zu: Feudalismuskonzeptionen und Rezeptionen (Arbeitstitel)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Feudalismus als universalhistorisches Phänomen und analysiert verschiedene Konzeptionen und Rezeptionen dieses Begriffs in der Geschichtswissenschaft. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Perspektiven bedeutender Denker wie Otto Hintze, Max Weber und Karl Marx, sowie auf der Feudalismusdebatte in der DDR.
Welche Konzeptionen des Feudalismus werden behandelt?
Die Arbeit vergleicht und kontrastiert die Feudalismuskonzeptionen von Otto Hintze (sozio-historische Rezeption, "Idealtypus"), Max Weber (Feudalismus als Herrschaftsform) und Karl Marx (historisch-materialistische Sicht). Es werden deren unterschiedliche Schwerpunkte und methodischen Vorgehensweisen analysiert.
Welche Rolle spielt das Lehnswesen?
Das Lehnswesen wird als wichtiger Aspekt in der Diskussion um den Feudalismus behandelt, wobei die unterschiedliche Gewichtung dieses Elements in den verschiedenen Konzeptionen hervorgehoben wird. Die deutsche Mittelalterforschung mit ihrem Fokus auf das Lehnswesen wird ebenfalls berücksichtigt.
Wie wird der Feudalismus definiert?
Die Arbeit thematisiert den Feudalismusbegriff als kontrovers diskutierten Begriff, der aufgrund fehlender eindeutiger Definitionen zu langwierigen Debatten führte. Die verschiedenen Konzeptionen bieten jeweils eigene Definitionen und Betrachtungsweisen.
Welche Bedeutung hat die Feudalismusdebatte in der DDR?
Ein Kapitel (im vorliegenden Textfragment nicht enthalten) widmet sich der spezifischen Rezeption und Interpretation des Feudalismusbegriffs in der DDR unter Berücksichtigung des damaligen politischen und ideologischen Kontextes. Es werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zur westdeutschen Debatte beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu den Feudalismuskonzeptionen und -rezeptionen (Hintze, Weber, Marx), ein Kapitel zur Feudalismus-Diskussion in der DDR und ein Schlusswort.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Feudalismus, Lehnswesen, Herrschaftsform, Otto Hintze, Max Weber, Karl Marx, historisch-materialistische Sicht, sozio-historische Rezeption, politisch-typologische Schule, DDR, Geschichtswissenschaft, Idealtypus.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser, die sich wissenschaftlich mit dem Feudalismus auseinandersetzen möchten, insbesondere an Studierende und Wissenschaftler der Geschichtswissenschaft, Soziologie und Wirtschaftswissenschaften.
- Quote paper
- Natsuho Hayauchi (Author), 1998, Feudalismus als universalhistorisches Phänomen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12602