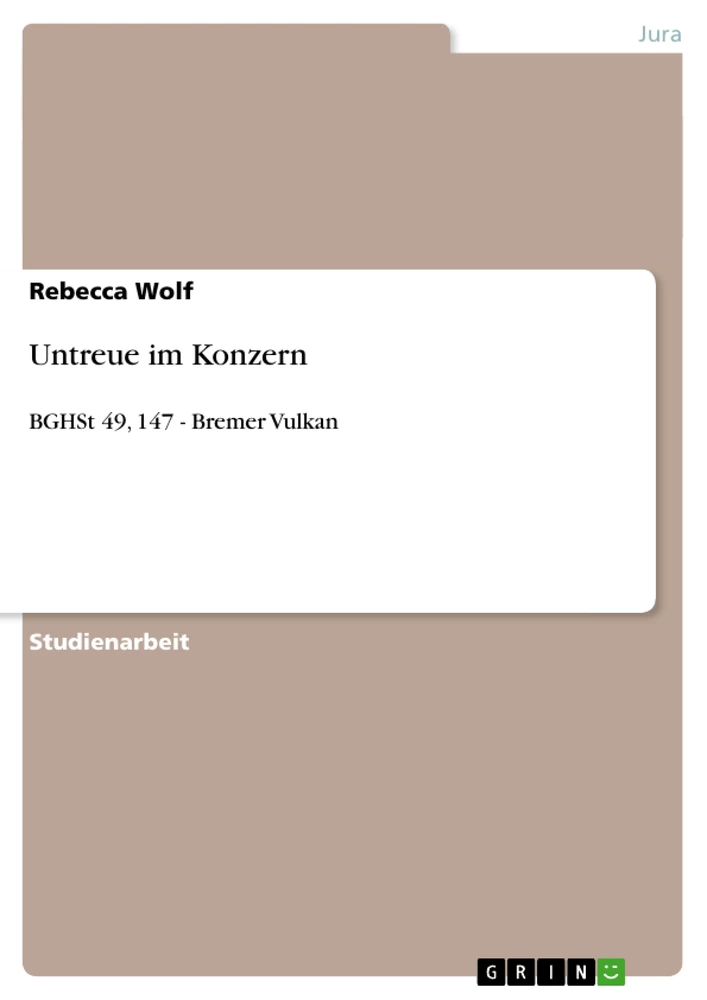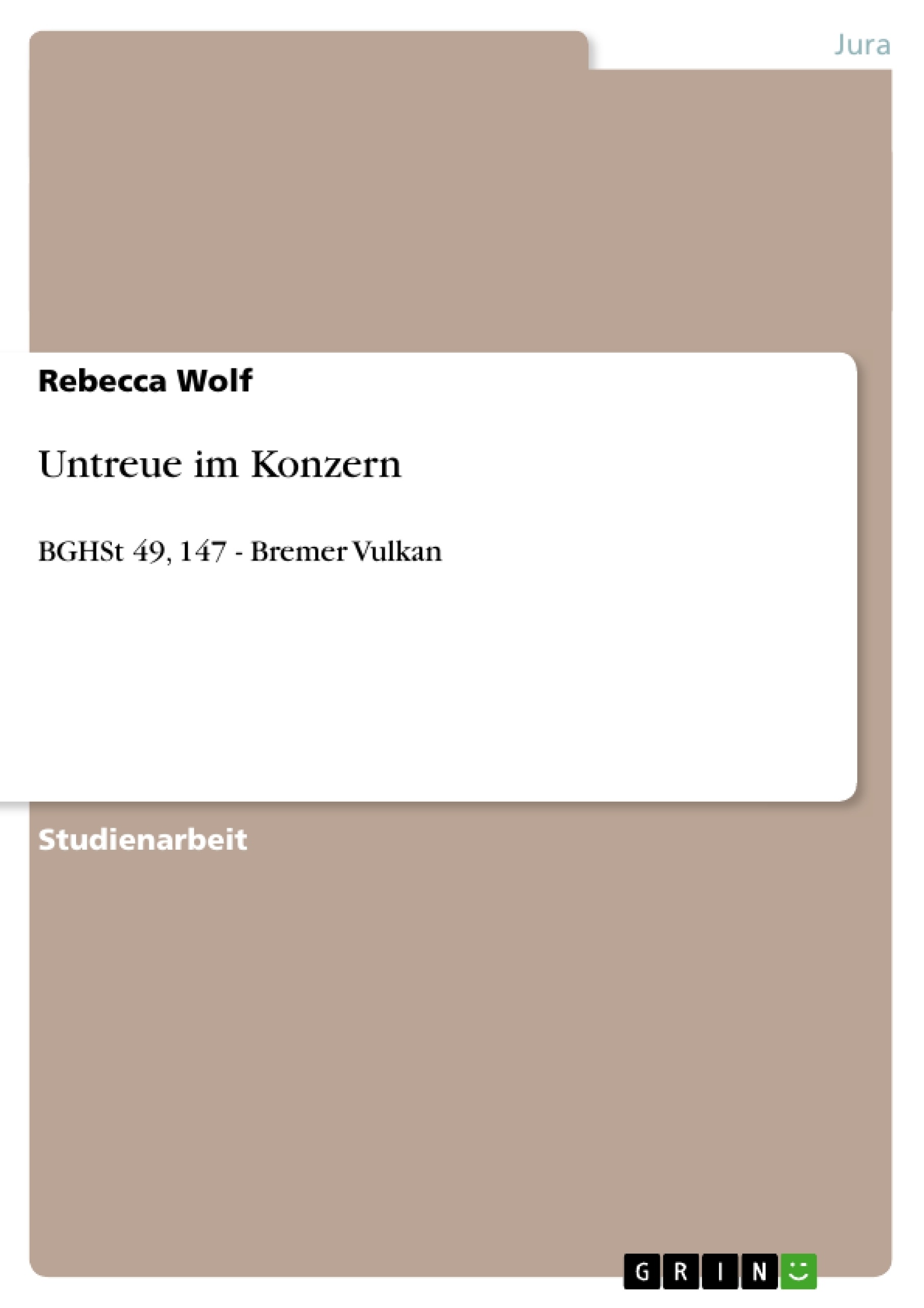Um einen Überblick zu verschaffen, werden zunächst die wichtigsten Kapitalgesellschaften, sowie deren Zusammenschluss zu einem Konzern näher erläutert und auf die wichtigsten Merkmale in Bezug auf eine etwaige Vermögensbetreuungspflicht eingegangen.
Im Folgenden wird der Begriff der Konzernuntreue dargestellt, wobei geklärt wird wer im Rahmen einer Konzernierung taugliches Untreueopfer bzw. tauglicher Untreuetäter sein kann.
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Vermögensbetreuungspflicht im Konzern. Es wird veranschaulicht, wem eine solche zukommt. Dies wird insbesondere anhand von Vertragskonzernen und faktischen AG- und GmbH-Konzernen verdeutlicht.
Pflichtwidrigkeit und Einverständnis des Gesellschafters stellen einen weiteren Gliederungspunkt dar, wobei dies am Beispiel der „Bremer-Vukan“-Entscheidung näher gebracht wird.
Den Abschluss bildet ein Einblick in Nachteil und Nachteilsausgleich in verbundenen Unternehmen, sowie die mittelbare Täterschaft bzw. Mittäterschaft der Gesellschafter im „Bremer-Vulkan“-Konzern.
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel Einleitung
A. Gang der Untersuchung
B. Zusammenfassung des Sachverhalts der „Bremer-Vulkan“ – Entscheidung
C. Darstellung verschiedener Rechtsformen
I. Die GmbH
1. Grundmodell
a. Geschäftsführer einer GmbH
b. Gesamtheit der Gesellschafter
2. Einpersonengesellschaften
II. Die Aktiengesellschaft
III. Der Konzern
1. Merkmale eines Unternehmens
a. Herrschendes Unternehmen
b. Einheitliche Leitung
c. Abhängigkeit
d. Zusammenfassung
2. Konzerntypen
a. Gleichordnungskonzerne, § 18 Abs. 2 AktG
b. Unterordnungskonzerne, § 18 Abs. 1 AktG
aa. Vertragskonzerne
(1) Beherrschungsvertrag
(2) Gewinnabführungsvertrag
bb. Faktischer Konzern
c. Gefahren der Konzernierung
aa. Gefahren für die Minderheitsgesellschafter
bb. Gefahren für die Gläubiger der abhängigen Gesellschaft
2. Kapitel Untreue im Konzern
A. Begriff der Konzernuntreue
B. Konzernspezifische Untreue-Beziehungen
I. Opfer
1. Die abhängige, die herrschende und die Schwester-AG oder -GmbH
2. Der „Konzern“
II. Täter
III. Tathandlungen
IV. „Bremer-Vulkan“-Konzern und mögliche Untreuestrafbarkeit
3. Kapitel Vermögensbetreuungspflicht im Konzern
A. Überblick und Einleitung
B. Vermögensbetreuungspflicht des herrschenden Unternehmens
I. Vermögensbetreuungspflicht aus der Stellung als Gesellschafter
1. Mitgliedschaft
2. Gesellschaftsrechtliche Treuepflicht
3. Zwischenergebnis
II. Vermögensbetreuungspflicht aus konzernrechtlichem Verhältnis
1. Schädigungsverbot
2. Pflicht zur Konzernleitung
3. Zwischenergebnis
III. Vermögensbetreuungspflicht aus Unternehmenskaufverträgen
1. Teilbeträge als Ausgleich für drohende vereinigungsbedingte Verluste
2. Teilbeträge als Investitionshilfen
3. Zwischenergebnis
IV. Vermögensbetreuungspflicht aus Rechtsmacht oder faktischer Beherrschung
1. Vermögensbetreuungspflicht aus faktischer Geschäftsführung?
a. Leitlinien faktischer Geschäftsführung
b. Spezifische Anforderungen des Treubruchstatbestands
c. Zusammenfassung
2. Rechtsmacht oder faktische Beherrschung in den verschiedenen Konzernierungsformen
a. Vertragskonzern
b. Faktischer Konzern
aa. Faktischer AG-Konzern
bb. Faktischer GmbH-Konzern
3. Zusammenfassung
V. Übergeleitete Vermögensbetreuungspflicht
4. Kapitel Pflichtwidrigkeit und Einverständnis des Gesellschafters
A. Wegfall der Pflichtwidrigkeit durch Einverständnis im Konzern
I. Grundlagen des Einverständnisses bei juristischen Personen
1. Willenszurechnung im GmbH-Konzern
a. Organzuständigkeit auf der Ebene der MTW- und VWS-GmbH als Vermögensinhaberin
b. Organzuständigkeit auf der Ebene der herrschenden Gesellschaft als Gesellschafterin
c. Zwischenergebnis
II. Grenzen der Dispositionsbefugnis
1. Das Eigeninteresse der abhängigen GmbH
a. Beeinträchtigung des Stammkapitals
2. Zusammenfassung
5. Kapitel Nachteil und Nachteilsausgleich in verbundenen Unternehmen
A. Bestimmung des Nachteils im Konzern
I. Nachteilsausgleich im Konzern
6. Kapitel Der Gesellschafter als mittelbarer Täter oder Mittäter
A. Mittelbare Täterschaft kraft Organisationsherrschaft
B. Mittäterschaft
Schlusswort
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Kapitel Einleitung
A. Gang der Untersuchung
Um einen Überblick zu verschaffen, werden zunächst die wichtigsten Kapitalgesellschaften, sowie deren Zusammenschluss zu einem Konzern näher erläutert und auf die wichtigsten Merkmale in Bezug auf eine et-waige Vermögensbetreuungspflicht eingegangen.
Im Folgenden wird der Begriff der Konzernuntreue dargestellt, wobei geklärt wird wer im Rahmen einer Konzernierung taugliches Untreueop-fer bzw. tauglicher Untreuetäter sein kann.
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Vermögensbetreuungspflicht im Konzern. Es wird veranschaulicht, wem eine solche zukommt. Dies wird insbesondere anhand von Vertragskonzernen und faktischen AG-und GmbH-Konzernen verdeutlicht.
Pflichtwidrigkeit und Einverständnis des Gesellschafters stellen einen weiteren Gliederungspunkt dar, wobei dies am Beispiel der „Bremer-Vukan“-Entscheidun]g näher gebracht wird.
Den Abschluss bildet ein Einblick in Nachteil und Nachteilsausgleich in verbundenen Unternehmen, sowie die mittelbare Täterschaft bzw. Mittä-terschaft der Gesellschafter im „Bremer-Vulkan“-Konzern.
B. Zusammenfassung des Sachverhalts der „Bremer-Vulkan“ – Ent-scheidung (BGHSt 49, 147)
Im Jahre 1992 wurden die Geschäftsanteile der MTW-GmbH durch den Abschluss eines Abtretungs- und Veräußerungsvertrages mit der Treu-handgesellschaft (THA), eine dem Bundesminister der Finanzen unter-stellten Anstalt des öffentlichen Rechts, auf die Bremer Vulkan Verbund AG (BVV AG) übertragen. Zwar wurden von der BVV AG unmittelbar nur 2 % der Anteile und die restlichen von der V. Schiffbau Verbund GmbH (VSV) gehalten, deren alleinige Gesellschafterin die BVV AG war1. Die MTW-GmbH war also eine Gesellschaft ohne konzernfreie Minderheit und die BVV AG damit mittelbare Alleingesellschafterin2.
Im Jahre 1993 erwarben zwei Gesellschaften, an denen die BVV AG maßgeblich beteiligt war, mit Kauf- und Übertragungsvertrag die Ge-schäftsanteile der VWS-GmbH. Im Laufe des Jahres 1994 erwarb die HH-GmbH, eine 100%ige Tochter der BVV AG, 89 % der Anteile der VWS-GmbH; 11 % wurden von der Stadt Stralsund gehalten. Es ist fest-zuhalten, dass bei beiden Erwerbsverträgen zwischen der THA und der BVV AG Regelungen betreffend Gesamtausgleichsbeträgen, die unter anderem Investitionszuschüsse für die GmbHs enthielten, enthalten wa-ren.
Aufgrund von Liquiditätsproblemen der BVV AG wurde 1992 ein zent-rales Cash-Management System eingeführt, wonach ein Zielkonto bei der BVV AG gebildet wurde, auf das von den Tochterunternehmen Gutha-ben automatisch abgebucht wurden. Die MTW-GmbH und die VWS-GmbH waren zunächst nicht in dieses System eingebunden. Jedoch wur-de die MTW-GmbH ab 1994 in den Liquiditätsausgleich des BVV-Konzerns einbezogen, indem sie verschiedene Festgeldbeträge an die BVV-AG überwies. Dies hatte zur Folge, dass von der EU zweckgebun-dene für die ostdeutsche MTW-GmbH genehmigte Fördermittel zum Teil an westdeutsche Töchter der BVV AG flossen.
Diese finanzielle Abhängigkeit wurde 1994 noch weiter durch den Bei-tritt in das Cash-Management System verstärkt. Danach verpflichtete sich die MTW-GmbH vertraglich, frei verfügbare Mittel ausschließlich bei der Treasury von BVV anzulegen und Betriebsmittel nur bei ihr aufzu-nehmen. Auch die VWS-GmbH trat aufgrund einer Gesellschafterwei-sung nach anfänglichem Widerstand dem Cash-Management System bei. Folglich flossen die danach gezahlten EU Fördermittel an die Konzern-zentrale und waren der Verfügung der MTW-GmbH und VWS-GmbH entzogen. Trotz schwieriger Liquiditätslage der BVV AG im Jahre 1995 flossen weiter finanzielle Mittel von der MTW-GmbH auf das Zielkonto bei der BVV AG. Zugleich nahm die MTW-GmbH auf Veranlassung der Konzernleitung einen Kredit auf. Dies hatte zur Folge, dass mit dem fi-nanziellen Zusammenbruch der BVV AG im Jahre 1996 diese nicht mehr in der Lage war, der MTW-GmbH ihr Kapital zurückzuzahlen, womit de-ren Forderungen in der Bilanz auf Null wertberichtigt werden mussten3. Dies führte zwangsläufig zu einer Unterbilanz und einer Überschuldung der MTW-GmbH, sowie der VWS-GmbH und nur daher nicht zur Insol-venz, da sie auf Betreiben der THA aus dem BVV-Konzern ausgegliedert und finanziell unterstützt wurden. Bemühungen, die Festgeldanlagen zu-rückzuerlangen scheiterten ebenso wie die Versuche, die Einlagen im Cash-Management-System nachträglich besichern zu lassen. Die Ausfäl-le von der MTW-GmbH und der VWS-GmbH wurden im Konkurs der BVV AG zur Konkurstabelle anerkannt4.
C. Darstellung verschiedener Rechtsformen
I. Die GmbH
Die GmbH ist eine Kapitalgesellschaft (§ 13 Abs. 3 GmbHG) mit eigener Rechtspersönlichkeit (§ 13 Abs. 1 GmbHG), die zu jedem gesetzlich zu-lässigen Zweck (§ 1 GmbHG) errichtet werden kann und für deren Ver-bindlichkeiten den Gläubigern nur das Gesellschaftsvermögen (§ 13 Abs. 2 GmbHG) haftet.
Aufgrund des Grundsatzes der Zweckvielfalt (§ 1 GmbHG), wonach die GmbH durch den Gesellschaftsvertrag so ausgestaltet werden kann, wie es die Zwecke der Gesellschaft erfordern, wird sie als „Allzweck-Instrument“ erachtet, da sie sich sowohl für personalistische Zusammen-schlüsse als auch für kapitalistische Großunternehmen eignet5. So haben sich in der Praxis, unter Ausnutzung des hohen Gestaltungsspielraums der GmbH, zwei Gruppen von Zweckrichtungen herausgebildet. Zum ei-nen wird die unmittelbare Verfolgung erwerbswirtschaftlicher oder nichterwerbswirtschaftlicher Ziele als Gesellschaftszweck der GmbH an-gesehen, zum anderen kann die GmbH im Rahmen weiter gespannter un-ternehmerischer Ziele als Instrument zur Erreichung begrenzter wirt-schaftlicher oder rechtlicher Absichten eingesetzt werden6.
1. Grundmodell
Wie jede juristische Person handelt die GmbH durch ihre Organe, vorlie-gend durch den Geschäftsführer, die Gesellschafterversammlung, sowie in bestimmten Fällen durch den Aufsichtsrat7.
Generell geht das GmbHG von einer Personenverschiedenheit zwischen Gesellschafter und Geschäftsführer aus, aufgrund der klaren Trennung der Befugnisse. Anderenfalls würde sich u.a. die Befugnis zur Ausübung des Weisungsrechts aus § 37 Abs. 1 GmbH kaum erklären lassen. Dar-über hinaus ergibt sich aus dem GmbHG, insbesondere der §§ 47 Abs. 1, 48 Abs. 1 GmbHG, dass der Gesetzgeber von mehreren, durch einen Zweck verbundenen Gesellschaftern ausging. Dieses Modell wird als mehrgliedrige Gesellschaft verstanden8.
a. Geschäftsführer einer GmbH
Die Geschäftsführer sind das notwendige Geschäftsführungs- und Vertre-tungsorgan der GmbH9, d.h. sie führen die Geschäfte der Gesellschaft und vertreten die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich, § 35 Abs. 1 GmbHG. Diese Vertretungsbefugnis ist im Außenverhältnis unbe-schränkbar (§ 37 Abs. 2 GmbHG), im Innenverhältnis sind die Befugnis-se jedoch weitestgehend durch den Gesellschaftsvertrag oder durch die Beschlüsse der Gesellschafter festgesetzt, § 35 Abs. 1 GmbHG. So haben die Gesellschafter in ihrer Gesamtheit die Befugnis, den Geschäftsfüh-rern generelle oder konkrete Weisungen im Hinblick auf die Unterneh-mensleitung zu erteilen, § 37 Abs. 1 GmbHG10. Demnach kommt den Geschäftsführern nur eine selbstständige Entscheidungskompetenz zu, wenn die Gesellschafter von ihrem Weisungsrecht keinen Gebrauch ma-chen.
b. Gesamtheit der Gesellschafter
Das oberste Organ der GmbH ist die Gesamtheit der Gesellschaft11, wel-che ihre Beschlüsse regelmäßig in Versammlungen fasst, § 48 Abs. 1 GmbHG.
Ihre Kompetenzen und zu erfüllenden Aufgaben ergeben sich aus dem Gesellschaftsvertrag und den §§ 46, 53, 60 Abs. 1 Nr.2 GmbHG.
Wie schon aufgezeigt, können die Gesellschafter des Weiteren den Ge-schäftsführern Weisungen erteilen, welche für die Geschäftsführer grund-sätzlich bindend sind, § 37 Abs. 1 GmbHG12. Mithin entscheiden die Gesellschafter über die Grundsätze der Unternehmenspolitik13, woraus folgt, dass die Herrschaft in der GmbH bei den Anteilseignern liegt14.
So bestehen bei der GmbH durch die Organisationsverfassung besondere Gefahren. Denn wie schon aufgezeigt, kann der Mehrheitsgesellschafter, welcher über 75 % der Stimmen verfügt, die Organisation der GmbH weitgehend seinen Vorstellungen anpassen15. Zwar steht das Weisungs-recht in der Regel nicht dem einzelnen Mehrheitsgesellschafter zu, denn der Weisung muss ein Gesellschafterbeschluss vorausgehen16, jedoch ist es dem Mehrheitsgesellschafter aufgrund eines Beherrschungsvertrages17 gestattet unmittelbar „Weisungen“ zu erteilen. Gleiches gilt auch für die Einpersonengesellschaft18.
2. Einpersonengesellschaften
Bei der Einpersonengesellschaft handelt es sich um eine Konstellation, bei der sich alle Gesellschaftsanteile in der Hand eines Gesellschafters (Alleingesellschafter) vereinigen19. Eine solche Gesellschaft entsteht entweder dadurch, dass sie durch nur eine Person gegründet wird (§ 1 GmbHG) oder sich nachträglich alle Gesellschaftsanteile in der Hand ei-nes Anteileigners befinden. Diese Organisationsform ist vor allem als Instrument der Konzernbildung von großer Relevanz20, da sie häufig von Unternehmen dazu genutzt wird, besonders risikoreiche Geschäftsberei-che auszugliedern. In einem solchen Fall ist die GmbH in der Regel 100 % Tochter der Muttergesellschaft.
II. Die Aktiengesellschaft
In § 1 AktG findet sich eine auf fünf Begriffsmerkmalen basierende Le-galdefinition der Aktiengesellschaft: Die AG ist eine Gesellschaft mit ei-gener Rechtspersönlichkeit, für deren Verbindlichkeiten nur das Gesell-schaftsvermögen haftet und die über ein, in Aktien gespaltenes Grundka-pital verfügt21.
Die AG handelt durch ihre Organe Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptver-sammlung, deren Kompetenzen jeweils strikt voneinander getrennt sind22. Zwar ist die AG selbstständige Rechts- und Vermögensträgerin23 ; ein Handeln, pflichtwidriges Unterlassen und Verschulden der Organe werden ihr jedoch zugerechnet24. Bei der Abgabe von Willenserklärun-gen und Prozesserklärungen handelt der Vorstand in organschaftlicher, nicht in rechtsgeschäftlicher Vertretungsmacht, weshalb kein Fall des § 164 BGB vorliegt.
Aufgrund der in § 76 Abs. 1 AktG verankerten zwingenden verband-rechtlichen Autonomie und Eigenverantwortlichkeit des Vorstands, ha-ben weder Hauptversammlung noch Aufsichtsrat der abhängigen AG dem eigenen Vorstand gegenüber ein unmittelbares Weisungsrecht. Der Vorstand leitet die AG unter eigener Verantwortung25. Dies wird gem. § 111 Abs. 1 AktG jedoch vom Aufsichtsrat der AG, welcher auch die ein-zelnen Vorstandsmitglieder bestellt, überwacht26. Die Überwachungs-pflicht des Aufsichtsrates erstreckt sich auf die rückblickende Kontrolle des Geschäftsverlaufes und der Amtsführung des Vorstandes. Kernauf-gabe ist die „vorbeugende Kontrolle“27. Bei bestimmten Geschäften kann dem Aufsichtsrat zusätzlich ein Zustimmungsvorbehalte zustehen (§ 111 Abs. 4, Nr. 2 AktG)28 und in einzelnen Fällen (z.B. § 77 Abs. 2 AktG) auch Geschäftsführungsbefugnisse29.
Das dritte Organ der Aktiengesellschaft ist die Hauptversammlung (Ver-sammlung der Aktionäre). Sie wählt die Mitglieder des Aufsichtsrates30, genehmigt den Jahresabschluss, beschließt die Gewinnverwendung und entscheidet über eine Änderung der Satzung (§ 119 Abs. 1 AktG)31.
III. Der Konzern
Unter einem Konzern versteht man den Zusammenschluss mehrerer rechtlich selbstständiger Unternehmen unter einheitlicher Leitung zu ei-ner neuen wirtschaftlichen Einheit, § 18 AktG32. Bereits aus der Definiti-onsnorm des § 18 AktG ergibt sich, dass zwischen Unterordnungs- und Gleichordnungskonzernen unterschieden wird33. In Abhängigkeit von der Rechtsform der Tochtergesellschaft wird zwischen AG-Konzernen und GmbH-Konzernen differenziert34. Festzuhalten ist, dass es sich bei einem Konzern nicht um eine juristische Person handelt, demzufolge sind auch keine Organe des Unternehmensverbundes vorhanden35. Mithin behalten die zusammengeschlossenen Rechtsträger ihre eigene Rechtspersönlich-keit. Jedoch wird ein Konzern wirtschaftlich wie ein Einheitsunterneh-men geleitet36. Vom rechtlichen Modellbild aus betrachtet hat jedes Kon-zernunternehmen ein autonomes Geschäftsführungsorgan, welches ei-genverantwortlich die Geschäftsführung für seine Unternehmung be-stimmt. Durch die Möglichkeit, auf diese Geschäftsführung Einfluss zu nehmen, wird das Exekutivorgan des herrschenden Unternehmens aller-dings zum Konzerngeschäftsführungsorgan37.
So sehen sich abhängige Unternehmen häufig beachtlichen Risiken aus-gesetzt. Die Gefahr besteht darin, dass das Eigeninteresse der Gesell-schaft, durch das von dem beherrschenden Gesellschafter anderweitig verfolgte unternehmerische Interesse, überlagert und die abhängige Ge-sellschaft zu einem dienenden Instrument degradiert wird38. Denn im Un-terschied zu einer unabhängigen Gesellschaft liegt es eben durchaus nicht selten im Interesse des an einer Vielzahl von Gesellschaften beteiligten beherrschenden Unternehmens, einzelne Tochtergesellschaften zum Wohle des Konzernganzen oder auch nur einzelner Beteiligungsgesell- schaften zu benachteiligen39. So reicht ein Kapitalanteil von 51 % aus, um die Geschicke einer Gesellschaft durch Beschlussfassungen zu lenken (§§ 133 Abs. 1 AktG bzw. 47 Abs. 1 GmbHG)40.
1. Merkmale eines Unternehmens
a. Herrschendes Unternehmen
Unternehmensqualität im Sinne der §§ 15-19 AktG weist ein Gesell-schafter auf, wenn er auch außerhalb der Gesellschaft unternehmerische Interessen verfolgt, die stark genug sind, um die erste Besorgnis zu be-gründen, dass der Gesellschafter seinen Einfluss zum Nachteil der Ge-sellschaft geltend machen könnte41. Mithin genügt die Stellung als Al-lein- oder Mehrheitsgesellschafter nicht, um die Unternehmensqualität zu begründen42. Vielmehr muss eine eigenständig betriebene oder aber eine maßgebliche Beteiligung an einer weiteren Gesellschaft hinzutreten, um eine Gefahrenlage in der Form zu schaffen, dass der Gesellschafter in der abhängigen Gesellschaft auch gesellschaftsfremde Interessen verfolgt43. Dabei kommt es nicht auf die Rechtsform des Gesellschafters an44 ; im Rahmen dieser Arbeit ist davon auszugehen, dass das herrschende Unter-nehmen eine Gesellschaft in der Rechtsform der AG oder GmbH ist.
Gemäß § 17 Abs. 1 AktG ist ein Unternehmen herrschend, wenn es auf-grund seiner Leitungsmacht seine wirtschaftlichen Zielsetzungen einem anderen (abhängigen) Unternehmen unterstellt45.
b. Einheitliche Leitung
Zentrales Merkmal eines Unterordnungskonzerns ist die einheitliche Lei-tung mehrerer Unternehmen. Es ist immer noch strittig, welche Anforde-rungen an das Vorliegen einer einheitlichen Leitung i.S.v. § 18 AktG zu stellen sind46.
Nach dem engen Konzernbegriff ist nur dann das Vorliegen eines Kon-zerns zu bejahen, wenn die Konzernspitze für die zentralen unternehme-rischen Bereiche in ihrer Gesamtheit eine einheitliche Planung aufstellt und bei den Konzerngliedern ohne Rücksicht auf deren Selbstständigkeit durchsetzt47.
Demnach ist ein Konzern nur dann anzunehmen, wenn für die verbunde-nen Unternehmen einheitlich festgelegt ist, welchen Beitrag diese für den Konzernerfolg zu erbringen haben und über welche Mittel sie verfügen dürfen und wie selbige aufzubringen sind48. Ein Paradebeispiel hierfür ist ein Zentrales Cash-Management System49.
Der weite Konzernbegriff geht mit dem engen Konzernbegriff derart konform, dass ein Konzern anzunehmen ist, wenn eine einheitliche Fi-nanzplanung vorliegt.
Hingegen genügt nach dieser Ansicht schon eine einheitliche Planung mit Ausstrahlungswirkung auf das Gesamtunternehmen in zentralen Unter-nehmensbereichen, wie z.B. Organisation, Personalwesen oder Einkauf, um einen Konzern anzunehmen50. Dies kann für die strafrechtliche Beur-teilung unter Umständen Bedeutung haben51.
c. Abhängigkeit
Ein weiteres wichtiges Merkmal eines Konzerns ist die Abhängigkeit der Tochtergesellschaften zum herrschenden Unternehmen. Schon die Mög-lichkeit der Einflussnahme des beherrschenden Unternehmens auf das abhängige Unternehmen reicht gemäß des Wortlauts des § 17 Abs. 1 AktG für eine Abhängigkeit aus. Dafür genügt jedoch nicht die vage Möglichkeit der Herrschaftsausübung, sondern das herrschende Unter-nehmen muss über fortdauernde und organisatorische Mittel verfügen, die es ihm erlauben, dem abhängigen Unternehmen seinen Willen aufzu-zwingen52. Die in § 17 Abs. 2 AktG geregelte Vermutungsregel ist die wichtigste Grundlage zur Feststellung einer Abhängigkeit im Falle des Bestehens einer Mehrheitsbeteiligung.
d. Zusammenfassung
Nach überwiegender Meinung kommt diesem Merkmal keine eigenstän- dige Bedeutung zu53.
2. Konzerntypen
Nach § 18 AktG wird zwischen Unterordnungskonzernen (§ 18 Abs. 1 AktG) und Gleichordnungskonzernen (§ 18 Abs. 2 AktG) unterschie-den54.
a. Gleichordnungskonzerne, § 18 Abs. 2 AktG
Von einem Gleichordnungskonzern gemäß § 18 Abs. 2 AktG kann ge-sprochen werden, wenn rechtlich selbstständige Unternehmen unter ein-heitlicher Leitung zusammengefasst sind, ohne das ein Unternehmen von dem anderen abhängig ist oder beherrscht wird55. Aus dem Merkmal der einheitlichen Leitung ergibt sich jedoch die Notwendigkeit der Koordi-nierung der Geschäftspolitik. Diese darf sich nicht nur auf einzelne Teil-bereiche beziehen, sondern muss die beteiligten Unternehmen in ihrer Gesamtheit erfassen56. Im Grunde ist die Situation mit der in einem Un-terordnungskonzern vergleichbar, so dass im Rahmen dieser Arbeit nicht auf den Gleichordnungskonzern eingegangen wird.
b. Unterordnungskonzerne, § 18 Abs. 1 AktG
Ein Unterordnungskonzern gemäß § 18 Abs. 1 AktG ist gegeben, wenn ein herrschendes und ein oder mehrere abhängige Unternehmen unter der einheitlichen Leitung des herrschenden Unternehmens zusammengefasst sind57.
Kennzeichen ist somit die Zusammenfassung mehrerer rechtlich selbst-ständiger, aber voneinander abhängiger Unternehmen unter einheitlicher Leitung eines herrschenden Unternehmens58.
Dabei ist zwischen vertraglichen und faktischen Konzernen als Erschei-nungsformen der Unterordnungskonzerne zu differenzieren59.
[...]
1 BGHZ 149, 10 ff.
2 Vgl. Baumbach/Hueck/Zöllner, SchlAnhKonzernR, Rn. 96.
3 Mödl, JuS 2003, S. 15.
4 BGHSt 49, 147 ff.; BHGZ 149, 10 ff.; vgl. Ransiek, wistra 2005, S. 121; Fleischer, NJW 2004, S. 2867; Lamann, S. 16.
5 Scholz/Westermann, Einleitung, Rn. 32.
6 Scholz/Westermann, Einleitung, Rn.32.
7 Eisenhardt, Rn. 703.
8 Emmerich/Habersack, § 29 III 2, § 30 V; Lamann, S. 4.
9 Eisenhardt, Rn. 704; Schmidt, § 36 II 1a).
10 Scholz/Schneider, § 37 Rn. 30 – Grundsatz der Weisungsabhängigkeit.
11 Eisenhardt, Rn. 712; Kasiske, wistra 2005, S. 81.
12 Timm, JuS 1999, S. 762; Scholz/Schneider, § 37 Rn. 30 – Grundsatz der Folgepflicht; vgl. auch Ransiek in: FS f. Kohlmann, S. 221.
13 Eisenhardt in: FS f. Pfeiffer, S. 839; vgl. auch Schwark, JuS 1987, S. 446.
14 Lamann, S. 7; vgl. Ransiek in: FS f. Kohlmann, S. 211, 221.
15 Emmerich/Habersack, § 29 II; Timm, JuS 1999, S. 555.
16 Scholz/Schneider, § 37 Rn. 31.
17 Auf den Beherrschungsvertrag wird noch genauer eingegangen.
18 Vgl. WM 1992, 2053 ff.
19 Eisenhardt, Rn. 755, Lamann, S. 5.
20 Fezer, in JZ 1981, 608,611, Eisenhardt, Rn. 760.
21 Vgl. Raisel/Veil, S. 37, Rn. 1, vgl. auch Eisenhard, Rn. 482, 485.
22 Vgl. Busch, S. 14; vgl. auch Ensthaler/Kreher, BB 1995, S. 1422.
23 Vgl. Raisel/Veil, S. 37, Rn. 3, vgl. auch Eisenhardt, Rn. 546.
24 Raisel/Veil, S. 41, Rn. 15.
25 Busch, S. 14, vgl. auch Raisel/Veil, S. 139, Rn. 1, vgl. auch Eisenhardt, Rn. 548; vgl. auch Mü-Ko/Hefermehl/Spindler, § 76, Rn. 21.
26 Vgl. Happ, S. 831, Rn. 1, S. 841, Rn. 1.
27 Raisel/Veil, S. 177, Rn. 1 f., vgl. Eisenhardt, Rn. 554 ff.; vgl. auch MüKo/Semler, § 111, Rn. 87 ff..
28 Vgl. Raisel/Veil, S. 179, Rn. 8.
29 Vgl. Raisel/Veil, S. 180, Rn. 12, vgl. auch Eisenhardt, Rn. 486.
30 Vgl. Happ, S. 1001, Rn. 2.
31 Vgl. Eisenhardt, Rn. 547 ff..
32 Vgl. hierzu Zöllner, JuS 1968, S. 297; Schwark, Jus 1987, S. 444, 446; Busch, S. 8.
33 Emmerich/Habersack, § 4 I; Scholz/Emmerich, Anhang Konzernrecht, Rn. 30.
34 Busch, S. 9.
35 Timm, JuS 1999, S. 554.
36 Busch, S. 9.
37 Busch, S. 9.
38 Emmerich/Habersack, § 1 III 3b), Busch, S. 10.
39 Busch, S. 10; vgl. Ransiek in: FS f. Kohlmann, S. 208; Ulmer, NJW 1986, S. 1580.
40 Timm, JuS 1999, S. 555; so auch Zöllner, JuS 1968, S. 298.
41 Scholz/Emmerich, Anhang Konzernrecht, Rn. 15; Emmerich/Habersack, § 2 II 2; Zöllner, JuS 1968, S. 300; NJW 1981, S. 1512 ff. (1513); Busch, S. 11.
42 Vgl. Schwark, JuS 1987, S. 446.
43 Timm, JuS 1999, S. 656; vgl. auch Ulmer, NJW 1986, S. 1581.
44 Schmidt/Lutter/Vetter, § 15, Rn. 41ff.; Kuhlmann/Ahnis, Rn. 30 ff., Emmerich/Habersack, § 2 II 2; Timm, JuS 1999, S. 656, 657.
45 Timm, JuS 1999, S. 556; Emmerich/Habersack, § 1 III 3 b).
46 Emmerich/Habersack, § 4 III 1., Eisenhardt, Rn. 859.
47 Emmerich/Habersack, § 4 III 1., Lamann, S. 11.
48 Emmerich/Habersack, § 4 III 1; vgl. auch Zöllner, JuS 1968, S. 300.
49 Emmerich/Habersack, § 4 III 1; Hüffer, Rn. 8-13; Timm, JuS 1999, S. 658.
50 Timm, JuS 1999, S. 658, Emmerich/Habersack, § 4 III 1.
51 Vgl. Busch, S. 12.
52 Timm, JuS 1999, S. 657; MüKo/Bayer, § 17; R. 11.
53 Emmerich/Habersack § 4 III 1 c); Hüffer, § 18, Rn. 7.
54 Vgl. auch Zöllner, JuS 1968, S. 300.
55 Emmerich/Habersack, § 4 IV 1, Kuhlmann/Ahnis, Rn. 95; Timm, JuS 1999, S. 658; auch Zöllner, JuS 1968, S. 300.
56 Emmerich/Habersack, § 4 IV 1, Hüffer, § 18, Rn. 21.
57 Emmerich/Habersack, § 4 III; Eisenhardt, Rn. 858; vgl. Timm, JuS 1999, S. 554, 658; Busch, S. 11.
58 Timm, JuS 1999, S. 658; vgl. auch Zöllner, JuS 1968, S. 300.
59 Vgl. Lamann, S. 12.
- Quote paper
- Rebecca Wolf (Author), 2008, Untreue im Konzern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125999