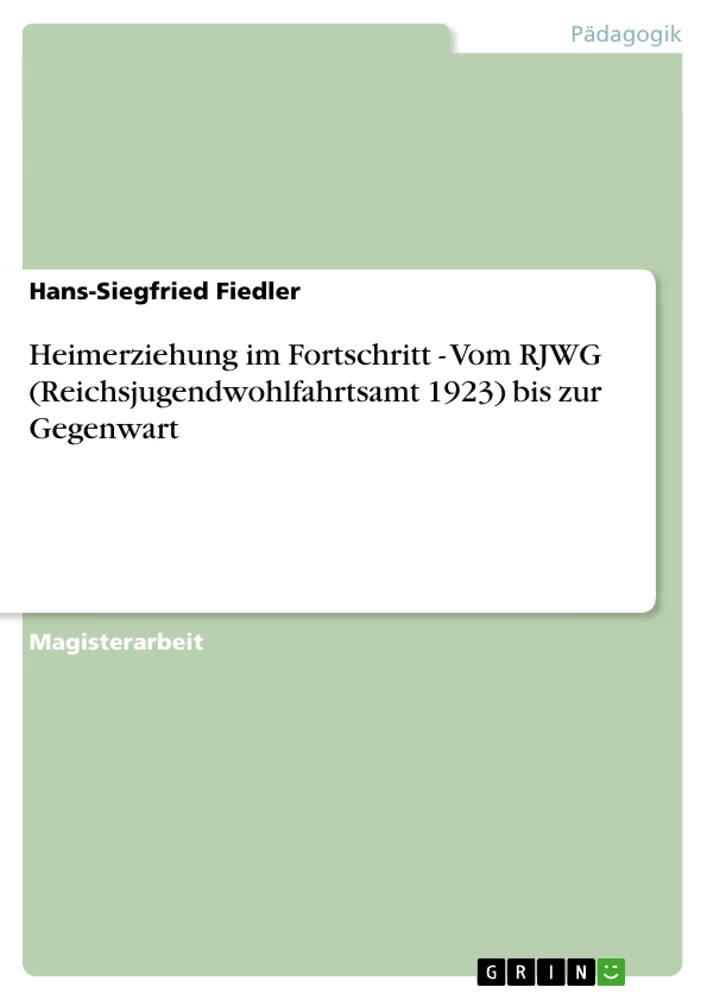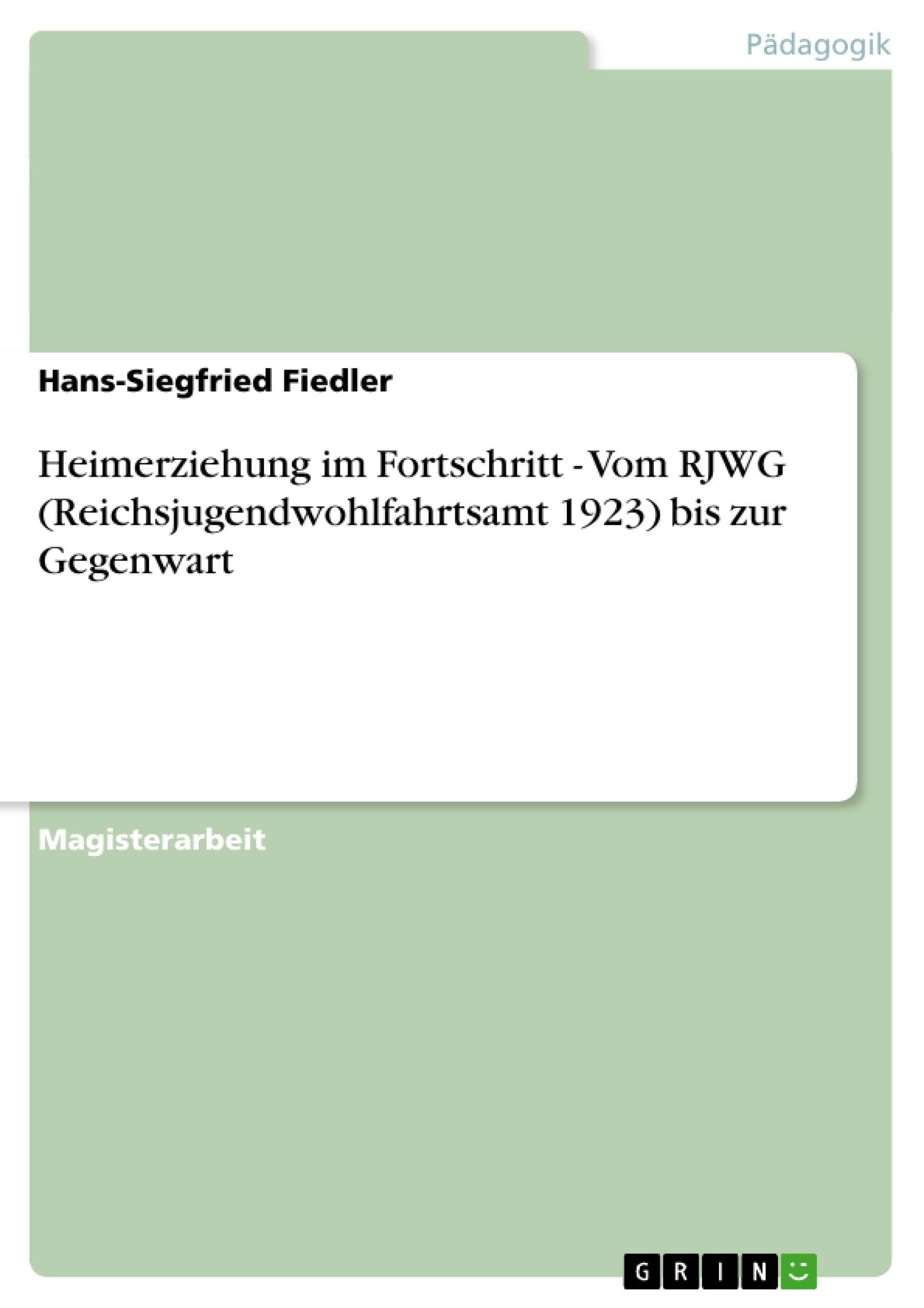Es gab seit ca. 1850 staatlich gesetzlich geregelte Jugendhilfe und auch Hilfen zur Erziehung. Die "Fürsorgeerziehung" wurde als Jugendhilfe in das RJWG (Reichsjugendwohlfahrtsgesetz" aufgenommen.
Verschiedene Gerichte u.a. das Bundesverfassungsgericht haben ca 1984 - 1989 diese gesetzliche Maßnahme der Jugendhilfe als "Makel" oder "Stigma" bezeichnet und die Vermeidung empfohlen.
In der vorliegenden Arbeit habe ich versucht die Hilflosigkeit des Gesetzgebers, als auch der Gesellschaft im Rahmen der Jugendhilfe aufzuzeigen.
Gliederung
1. Vorbemerkungen
2. Einführung
2.1. Zwangserziehung - Fürsorgeerziehung Versuch einer Definition
2.2. Durchführung der Zwangserziehung
2.2.1 Das Strafgesetzbuch 1871
2.2.2 Vor 1871 ,
2.2.3 Erste staatliche Eingriffe
2.2.4 Ansätze privater Jugendfürsorge
2.2.5 Das Bürgerliche Gesetzbuch 1900
2.2.6 Katholische Anstalten
2.2.7 Erste Differenzierungen i.d.Anstalten
3. Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz
3.1. Auswirkungen auf die Zwangserziehung Einführung der Fürsorgeerziehung
3.2. Das RJWG 1933 - 1945
3.3. Das JWG nach 1945
3.4. Momentaner Rechtszustand
3.5. Statistische Anmerkungen
4. Kritik an der Zwangserziehung
4.1. Ist der Verwahrloste (selbst) Schuld an seinem Makel ?
4.1.1 Verwahrlosung
4.1.2 Bekämpfung der Verwahrlosung
4.1.3 Verwahrlosung, ein unscharfer Begriff
4.1.4 Wandel der Verwahrlosung
4.1.5 Verwahrlosung als Vernachlässigung von Maßnahmen
4.1.6 Die sittliche Verwahrlosung Seite
4.1.7 Verwahrlosung, ein Begriff mit Rechtsfolgen
4.1.8 Moderne Definition der Verwahrlsg.
4.1.9 Zusammenfassung
4.2. Hat die Institution Zwangserziehung diese Makel verursacht?
4.2.1 Kritikpunkte an der Fürsorgeerziehung- Zwangserziehung
4.2.2 Vorwürfe im 19. Jahrhundert
4.2.3 Vorwürfe 1919
4.2.4 Kritik der Jugendlichen
4.2.5 Kritik aus den Heimen und Anstalten
4.2.6 Verstummte Kritik 1933-1945
4.2.7 Kritik nach 1945
4.2.8 APO und Kritik 1968-1970
4.2.9 Zusammenfassung
4.3. Zucht und Ordnung
4.3.1 Eigene Erfahrungen
4.3.2 Warum Züchtigungen
4.3.3 Wie kam die Zucht in die Pädagogik
4.3.4 Zusammenfassung
4.4. Die totale Instition als Hindernis für jede zeitgemäße Erziehung
4.4.1 Was ist eine totale Institution?
4.4.2 Organisation und Trägerschaft
4.4.3 Personal und Insassen
4.4.4 Die Wissenschaftsfeindlichkeit
5. Modelle bindungsfördernder Führung und Begleitung junger Menschen in Not
5.1. Die Familie als Vorbild
5.1.1 Leitsätze der Familienerziehung
5.1.2 Lebensraum Familie
5.1.3 Mittelpunkt Familie
5.2. Organisâtionsvoraussetzungen
5.2.1 Die Gemeinde
5.2.2 Die großen Verbände
5.3. Die Menschen in der Erziehung
5.3.1 Die Einstellung der Erzieher
5.3.2 Methodentraining
5.3.3 Begleitung der Pädagogen
5.3.4 Persönlichkeit des Erziehers
6. Schlußbemerkungen
6.1.1 Menschlichkeit in der Zwangserziehung?
6.1.2 Zukunft der Heimerziehung
6.1.3 Müssen wir verzweifeln?
6.1.4 Persönliche Bemerkungen
7. Literaturiiste
8- Lebenslauf
9. Erklärung
10. Anlagen?
Bruckmühl-Heufeld, im März 1989
1 - Vorbemerkungen
Warum
eine Magisterarbeit über die Entwicklung der Fürsorgeerziehung in der Bundesrepublik Deutschland?
Anfang 1966 wurde mir die Leitung und Verantwortung für eine traditionelle Großeinrichtung der Fürsorgeerziehung übertragen.
Voller Hoffnung, Tatendrang und mit einer "modernen Konzeption" durfte ich ein neues Jugenddorf errichten helfen.
Bei der Einweihung des Dorfes mit kleinen Wohneinheiten, Schulen, Werkstätten, Freizeit- und Sportanlagen sagte eine Ordensschwester, die mehr als 40 Jahre bei uns tätig war:
"Denken Sie an meine Worte. Sie heben einen Frosch auf ein silbernes Tablett, er wird in den Sumpf zurückspringen, denn nur dort fühlt er sich wohl."
Scheinbar erfüllt sich die Prophezeihung der Ordensschwester. Es kann doch nicht wahr sein, daß "verwahrloste Kinder und Jugendliche" von vorherein zum Scheitern verurteilt sind, daß sie Fehlleistungen erbringen müssen.
Warum ist es so ?
Es gibt nach meinen jahrzehntelangen Erfahrungen kaum einen Personenkreis von engagierten, fachlich qualifizierten Persönlichkeiten, wie die Mitarbeiter in Einrichtungen der öffentlichen Erziehung und besonders der Fürsorgeerziehung, die so viele Hoffnungen, Zuversicht und Kraft in ihre Arbeit und ihren Beruf investieren und trotzdem von den Jugendlichen, deren Eltern, einweisenden Behörden, der Öffentlichkeit, den Ausbildungsstätten der Pädagogik und Psychologie, der Wissenschaft - also von allen Partnern - immer wieder verlassen, korrigiert und beschimpft werden.
.Warumistesso?
Es vergeht - und dieses sďit Jahrzehnten - kaum eine Woche, in der nicht etwa wie folgt in den Medien berichtet wird: "Der Täter ist seines Verbrechens weitgehend geständig. Der Verteidiger weist jedoch darauf hin, daß der Täter eine schlechte Kindheit hatte (Eltern ließen sich scheiden) und er in Heimen seine Jugend verbringen mußte. Lieblosigkeit,
Härte und Brutalitäten, schlechte Bildungschancen mußten in eine geordnete Sozialisation verhindern. Deswegen bitten wir um Milde." Sie wird meistens gewährt.
Warum ist es so ?
Bereits bei der Verabschiedung des RJWG in den Jahren nach dem 1. Weltkrieg 1922/1924 wurden Befürchtungen geäußert, daß ob hoher Aufwand oder geringes Interesse, das Image der "Zwangserziehung" weiter sinken wird. Nach 65 Jahren Jugendwohlfahrtsgesetz ist dieser Prozeß des "Imageverlust" noch nicht abgeschlossen.
Die Kirchen als "Träger der freien Wohlfahrt" wollten durch ihre Tätigkeit in der "Zwangserziehung" die Fürsorge und Menschlichkeit in die Erziehung einbringen und damit den "Zwangscharakter" aufheben. Dieses ist m.E. nicht gelungen.
Warum ist es so ?
Braucht oder benötigt jede Gemeinschaft "Sündenböcke", die das eigene Versagen decken sollen?
Müssen es ausgerechnet die Kinder und Jugendlichen sein, die ohnehin - meistens allein durch die Geburt - benachteiligt sind ?
Warum ist es so ?
Diese Fragen möchte ich stellen und erwarte - für mich - ein wenig Klarheit und erweiterte Einsichten in diese Problematik.
Liegt es an den Vorstellungen der Gesellschaft, an den Behörden, an den Gerichten oder den Gesetzen, daß Zwangserziehung keine Chance hatte und künftig auch nicht haben wird ?
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit der "öffentlichen Erziehung" oder gar "Zwangserziehung" als Pflichtaufgabe des Staates ?
Liegt es an den Fachleuten in Behörden, an der Organisation der Einrichtungen und Heime, sind die Mitarbeiter in der Lage Verantwortung zu übernehmen oder zu teilen? Wird eigene Schwäche nicht häufig hinter "Formalismen" versteckt und gleichzeitig über die "Bürokratie" geschimpft?
Sind die Mitarbeiter der verschiedenen Fachrichtungen überhaupt bereit und in der Lage zusammenzuarbeiten? Erzieher mit Therapeuten, Sozialarbeiter mit Handwerksmeistern, Analytiker mit Verhaltenstherapeuten?
Verhindern nicht diese Sachverhalte die "Erziehungsgemeinschaft Heim", das notwendige "therapeutische Milieu"?
Liegt es gar an den Kindern und Jugendlichen der heutigen Zeit, daß wir so hilflos sind ?
Dieses "Warum ?" beschäftigt mich seit Jahrzehnten und seit einigen Jahren mit besonderem und verstärktem Interesse.
Durch die Distanz zur direkten täglichen Erziehungsarbeit im Heim und das verstärkte Hinwenden zu Theorien und Dokumenten der Pädagogik hoffe ich Antworten zu finden.
Antworten, die sicher unvollkommen und unbefriedigend sein werden.
2. Einführung
Zwangserziehung - Fürsorgeerziehung
2.1 Versuch einer Definition
"Unter Zwang versteht man die Nötigung zu einer Handlung"
(Buchberger 1938, S.1106)
Für jede Gesellschaft ist das Recht des Menschen auf Leben ein moralischer Zwang, dieses Leben zu schützen, die zeitgerechte Erziehung ist der akute Anlaß zum Handeln.
Kinder und Jugendliche, denen der Erziehungsträger - in der Regel die Eltern - verlustigt gegangen ist, müssen von der Gesellschaft (Staat) erzogen werden.
Die Not der jungen Menschen zwingt den Staat - die Gesellschaft - zum Handeln.
Hier wird der Staat gezwungen oder genötigt, in seiner Gesamtverantwortung Erziehung als Pflichtaufgabe zu sehen.
Wenn Eltern nicht in der Lage sind, ihre Kinder zu erziehen, also eine Gefährdung des Kindes vorliegt,(§ 1666 BGB)oder Kinder verwahrlost sind oder eine Verwahrlosung droht oder Handlungen begehen, die strafbar sind, muß der Staat eingreifen und die Erziehung auf seine Kosten durch das Vormundschaftsgericht erzwingen.
Unter Fürsorgeerziehung versteht man "gerichtlich angeordnete, unter öffentlicher Aufsicht und auf öffentliche Kosten durchgeführte Erziehung gefährdeter oder verwahrloster Minderjähriger."
Vergi. Jans-Happe (1971, S.63)
2.2 Durchführung der Zwangserziehung
2.21 Schon im Strafgesetzbuch des Deutschen Reiches von 1871 wurde im § 55 die Unterbringung in einer Erziehungs- oder Besserungsanstalt gesetzlich geregelt. Dieses war notwendig, wenn Minderjährige noch nicht strafmündig waren (12 Jahre) oder ihnen die nötige Einsicht nach Begehen einer strafbaren Handlung fehlte.
In den Ausführungsgesetzen der Länder folgten diese dem Gesetzgeber nicht, sondern stellten neben Anstaltserziehung auch die Familienerziehung.
Die Familie wurde sogar häufig in den Länderbestimmungen zuerst genannt. Z.B.: Das badische Gesetz (Ausführung zum StGB 1871) vom 04.05.1886: 11 § 1 Jugendliche Personen welche das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können wegen sittlicher Verwahrlosung auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung in eine geeignete Familie, in eine staatliche oder geeignete private Erziehungsoder Besserungsanstalt untergebracht werden. ... "
Das preußische Gesetz (Ausführung zum StGB 1871) vom 10.03.1878:
" § 1 Wer nach Vollendung des sechsten Lebensjahres und vor Vollendung des zwölften Lebensjahres eine strafbare Handlung begeht, kann von Obrigkeits wegen in eine geeignete Familie oder in eine Erziehungs-oder Besserungsanstalt untergebracht werden. ..."
Ähnliche Ausführungsbestimmungen gab es:
- Sachsen-Altenburg vom 20.03.1879
- Oldenburg vom 12.02.1880
- Sachsen-Weimar vom 09.02.1881
- Mecklenburg-Schwerin vom 10.10.1882
- Lübeck vom 17.03.1884
- Hamburg vom 06.04.1887
- Hessen vom 11.06.1887 (nach Schmitz, in Bülow, 1959, S. 76)
Warum die ausführenden Länder dem Strafgesetzbuch des Deutschen Reiches nicht folgten und die Familie nicht nur in gleichrangige, sondern eher vorrangig auch als Träger der Zwangserziehung und der Fürsorgeerziehung nannten, ist aus den vorliegenden Dokumenten nicht ersichtlich.
Ich werde später versuchen, noch im Zusammenhang mit der Kritik an der Zwangserziehung vor 1871 - auch in Verbindung mit dem sogenannten Waisenhausstreit - hierzu Begründungen zu finden.
Bayern hat keine Ausführungsbestimmungen zum Strafgesetz 1871 erlassen. " Die K.bayerische Regierung ist damals nach Einverständnis der Oberstaatsanwälte und der Kreisverwaltungsstellen zu der Überzeugung gelangt, dass die Erlassung eines bezüglichen Landesgesetzes vorläufig nicht veranlasst sei, weil ... dann die Inanspruchnahme der Schuldisziplin endlich die Vermittlung der Unterbringung der Kinder bei braven Familien oder in Anstalten mit Zustimmung und auf Kosten der beteiligten Eltern und Gemeinden, immerhin für die Polizeibehörden ausreichend Gelegenheit böten, auf die gehörige Beaufsichtigung· und Erziehung verwahrloster Kinder in angemessener Weise einzuwirken.'1 (Verh. der Kammer d. Abg., 1899/1900, S.849)
In Bayern wurde somit auf die Kraft der Familie und der Gemeinden in der Zwangserziehung gesetzt. Durch die Verabschiedung des Bürgerlichen Gesetzbuches 1900, mit seinen Bestimmungen der §§ 1666 und 1838, die Zwangserziehung betreffend, wurde eine spätere Korrektur im "Zwangserziehungsgesetz vom 10.05.1902 in Bayern" vorgenommen.
2 . 2,2 Um die Einführung der "Zwangserziehung" würdigen zu können, müssen wir auch die Zeit vor 1871 betrachten.
"Es war im vorchristlichen Zeitalter üblich, besonders bei den Völkern der Römer und Griechen, die Frau in der Familie lebenslänglich als unmündig anzusehen. Die Mutter fiel sogar unter die Vormundschaft des eigenen volljährigen Sohnes, sobald der Gatte verstorben war. Was ein Mann auf Bitten oder auf den Rat einer Frau vollbrachte, sollte dem Gesetz nach ungültig sein." (G. Fangauer, 1922, S.16/17)
So war es nicht wunderlich, daß das Aussetzen oder das Töten von Kindern - besonders von Mädchen und Schwachen - nicht nur toleriert wurde, sondern üblich war. Erinnern wir uns nur an die bekannte Auffassung der Spartaner im Altertum; sie ließ die Übung aufkommen, die "Lebensunwerten" sofort wieder auszuscheiden.
"Das Laster des Kindesaussetzens war so tief in die alten Völker eingedrungen, daß auch das Christentum es nur durch schweres, jahrhundertelanges Mühen erst nach und nach ausrotten konnte. So liegt es nahe, daß es bald auch von Christen ausgesetzte Kinder gab... Damit nun wenigstens die Tötung unehelicher und in ganz armen Verhältnissen geborener Kinder verhütet wurde, schuf man die Möglichkeit, solche Kinder ohne Gefahr für ihr Leben auszusetzen. So wurde z.B. in Gallien an Kirchen Marmorschalen angebracht, in die man ein Kind, dessen man sich entledigen wollte, hineinlegen konnte. Nachdem dann ein solches Kind· vom Kirchendiener dem Bischof gebracht und Tag und Umstände seiner Auffindung schriftlich festgehalten waren, wurde es beim Gottesdienst der versammelten Gemeinde vorgezeigt, damit eine christliche Familie sich seiner annehme, eingedenk des Heilandswortes: "Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf." Mark. 9.37." (Beeking, 1925, S.63)
Die Apostolischen Konstitutionen (Buch IV, 2) im 3. Jahrhundert schreiben vor: "Ihr Bischöfe, tragt Sorge für die Waisen, daß ihnen nichts fehle. Laßt den Jüngling ein Handwerk lernen, damit er sein Brot verdienen kann und verseht ihn mit dem zu seinem Geschäft nötigen Handwerkszeuge. Die Mädchen versorgt bis zum Alter, wo ihr sie einem Bruder zur Gattin geben könnt." (Kettenhofen, 1926,S.17)
Einen Unterschied zwischen Findelkinder, Waisenkinder und gefährdeten oder verwahrlosten Minderjährigen kannte man in Deutschland in der Regel bis tief in das Mittelalter nicht.
Die Waisen- oder Findelkinder wurden in der Familie miterzogen.
2.2/3 Im 15. Jahrhundert trat hier eine Änderung durch das Bettler- und Landstreichertum ein. "Diese Bettelplage trat nach den Kreuzzügen auf, vermehrte sich durch die grausame Art der Kriegsführung und die schändliche Behandlung des Bauernvolkes. Es kamen Seuchen und Hungersnot hinzu, die Geldentwertung und Besitzverschiebung; die handelstreibenden Städte wurden reich, das Land verarmte. So wurden die reichen Städte von Bettel schwärmen geradezu überlaufen. Der Bettel übte ein verheerende Wirkung auf die Kinder der Armen aus. Jeder Familienzusammenhang war gelöst, sodaß von der Verantwortlichkeit der Eltern oder der Familie für die Kinder keine Rede sein konnte. Das zwang die Regierenden, ihr Augenmerk auf die Kinder des fahrenden Volkes zu richten, von denen dieser Land- und Stadtplage ein fast ungemessener Zuzug erwuchs."
(Kettenhofen, 1926, S.18)
Die Nürnberger Bettelordnung von 1478 bestimmt: "Daß den Bettlern und Bettlerinnen ihre über acht Jahre alten und nicht mit Gebrechen behafteten Kinder abgenommen und in der Stadt oder auf dem Lande in den Dienst gebracht werden sollen."
Diese "BettelOrdnung aus Nürnberg" scheint sich bewährt zu haben.
Nach ihrem Muster schreibt der Reichstagsabschied vom Jahre 1500 vor:"daß auch der Bettler Kinder so ihr Brot zu verdienen geschickt sind, von ihnen genommen und zu Handwerkern oder sonst zu Diensten gewiesen werden, damit sie nicht also für und für dem Bettel anhangen." Vgl. Kettenhofen,( 1926» S.19)
Ließ sich eine solche Unterbringung nicht sofort ermöglichen, erfolgte "vorläufig" die Unterbringung in Spitäler und Siechenhäuser.
Hier wurde mit einem alten Rechtsgrundsatz erstmals gebrochen, wonach alle Strafgewalt allein bei der Familie, bei der Sippe war.
Damit wurde auch der jugendliche Rechtsbrecher der Strafgewalt der Familie und Sippe entzogen.
Es war erstmals in der Rechtsgeschichte möglich, "zum Wohl des Kindes" von der Obrigkeit her in die Familie einzugreifen und auch als "Rechtsgewalt" gegen Minderjährige vorzugehen.
Man muß sich - aus heutiger Sicht - jedoch nicht täuschen lassen. Verständlicherweise ging es letztlich um Ruhe und Ordnung. Es sollte Hab und Gut, Besitz und Macht, Gesundheit und Leben der Bürger geschützt werden.
Dieses hatte nicht nur Vorteile, denn die strafrechtlichen Zugriffe auf Jugendliche wurden trotz der Pflicht des Gerichtes zur Prüfung, ob das Kind "seiner Sinne mächtig war" rechtlich willkürlich vollzogen und führten im 16. Jahrhundert zur Eröffnung der sogenannten "Zuchthäuser".
"Darin wurden auch kleine Jungen und junge Leute, die auf einem Irrwege waren und nach dem Galgen liefen, aufgenommen, damit sie davor bewahrt und in Furcht Gottes zu ehrlichen Tätigkeiten und Handwerken angehalten werden." "Die gleichen Häuser wurden für Frauen errichtet, worin jungen Mädchen und andere, welche sich an den Müßiggang gewöhnen, mit Wollspinnen beschäftigt werden und den Unterhalt verdienen konnten." (Kettenhofen, 1926, S.20)
Es ist bemerkenswert festzustellen, daß die Jugendfürsorge in Deutschland an sich keine Chance hatte, sich zu festigen, sich zu entwickeln. Kaum hatte man ein wenig das "Bettelunwesen" im Griff, begann der Dreißigjährige Krieg.
"Es war traurig, wie weit die Jugendfürsorge zurückgeworfen wurde, Scharen der Bettler- und Landstreicherkinder wurden in Zucht-, Spinn- und Arbeitshäuser gesteckt und gegen die verbrecherische Jugend ohne Rücksicht auf ihr Alter mit der ganzen Härte des geltenden Strafrechtes eingeschritten. Die Jugendlichen wurden mit Erwachsenen,
Dirnen, Verbrechern, Landstreichern und Geisteskranken im Zucht- und Armenhaus zusammengesperrt und der üblen Gesellschaft überlassen. So erwuchsen aus diesen Jugendlichen der Gesellschaftsordnung schlimmste Feinde." (Kettenhofen, 1926, S.20)
2.2.4 Papst Clemens XI hat 1703 in Rom eine Anstalt für die Erziehung von verwahrlosten und verbrecherischen Knaben gegründet und auf die Wand des Refektoriums schreiben lassen:
"Nicht genügt die Bändigung der Unbotmäßigen durch Strafe, sie müssen zu rechtschaffenden Menschen erzogen werden."
Männer der verschiedensten Geistesrichtungen dachten Ähnliches, doch die Wirren der Französischen Revolution, der Napoleonischen Zeit, die oft noch verheerender in ihrer Wirkung bei dem einfachen Volke war, als alle Not zuvor, warfen alle guten Grundsätze der Jugendfürsorge wieder durcheinander.
Die kriegerischen Auseinandersetzungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Europa, ausgelöst durch die Ära Napoleons, stellten einen erneuten ) Höhepunkt der "Verwahrlosung" der Jugend dar und damit wurden be
sonnene Persönlichkeiten gefordert, dieser Not zu begegnen.
Die beginnende Landflucht in der Mitte des 19. Jahrhunderts durch die Industriealisierung der Städte, die Hoffnungen, endlich Arbeit und Brot zu bekommen und damit ein besseres Leben zu beginnen, führten in allen Regionen zu großen Anstrengungen und Gründungen von Rettungs anstalten. Nunmehr waren neben den unzumutbaren Wohnverhältnissen die Kinderarbeit, das Alleinsein der Kinder, weil beide Elternteile arbeiten mußten, Ursache der Verwahrlosungen.
"Auf katholischer Seite nahmen sich die Schwestern der Guten Hirten und die Armen Brüder vom hl. Franziskus der gefährdeten Jugend an. 1830 wurden z.B. durch v.Wessenberg in Baden die ersten Rettungs- } anstalten gegründet, in Münster nahm sich 1848 die Bruderschaft des hl. Vinzenz von Paul der Verwahrlosten an. 1851 entstanden im östlichen Deutschland Rettungshäuser zur hl.v Hedwig. 1852 wurde in München der kath. Verein zur Erziehung verwahrloster Jugend gegründet, 1857 in Westfalen eine Rettungsanstalt für Knaben, Haus Hall bei Gescher, für Mädchen eine Anstalt in Marienberg bei Coesfeld.
In wenigen Jahren waren allein 93 Anstalten mit 8420 Betten von der kath. Seite gegründet worden." (Kettenhofen, 1926,S.22)
Zunächst hatten alle Vereine, die sich mit der Not der Jugend beschäftigten, folgenden primären Auftrag: Es wurden Mitgliederbeiträge, Spenden, Sachzuwendungen, öffentliche Hilfen zusammengetragen und auf Kosten des Vereines Partner für die Erziehung der Kinder ge- sucht.
Dieses konnte sein, einfache Betreuung einzelner Kinder in Familien, während bestimmter Zeiten des Tages, Betreuung nach der Schule in Kleingruppen - heute würde man Horte sagen - Betreuung in Pflegefamilien während der Woche, bis hin zur Dauerunterbringung in Pflegefamilien, in Klosterschulen oder in Handwerksausbildungen bzw. Arbeitsstellen, z.B. auf dem Lande. Der Verein bezahlte diese Betreuungsarten und achtete auf Einhaltung der zwischen dem Verein und den Pflege- oder Erziehungsberechtigten getroffenen Vereinbarungen.
Es gab sicher auch hier Auseinandersetzungen zwischen Familien, die eher Pflegegelder als die Erziehung der Kinder im Auge hatten, wer sollte kompetente Kontrollen und Hilfen den einzelnen Erziehungsträgern anbieten. Sicher ist auch die sich anbahnende Kirchenfeindlichkeit zum Ende des 19. Jahrhunderts Auslöser für die Bemühungen, endlich eigene Anstalten ins Leben zu rufen.
"Die Gesetzgebung hatte mit der kirchlichen und privaten Liebestätigkeit nicht gleichen Schritt gehalten. Den Rettungshäusern konnten nur so viel zu rettende Jugendliche überwiesen werden, als ihnen von deren gesetzlichen Vertretern freiwillig zugeführt wurden. Und selbst diese durften in jedem Augenblick der Anstalt wieder entzogen werden, weil es an einem gesetzlichen Zwange zum Verbleiben mangelte, welcher dem bösen Willen der Jugendlichen und der mangelnden Einsicht ihrer Angehörigen hätte entgegengesetzt werden können.
So führten denn alle diese hoffnungsvoll gegründeten Anstalten bald ein kümmerliches Dasein. Die Hoffnung der edlen Menschenfreunde, mit diesen Einrichtungen den Anfang zur Lösung der Jugendfrage erreicht zu sehen, schien wieder erlöschen zu wollen.
Da führte die gesetzliche Regelung der Zwangserziehung auf Grund des Strafgesetzbuches von 1871 zu ungeahnter Belebung des Fürsorgeerziehungsgedankens." (Kettenhofen, 1926, S.22)
Vgl. W. Liese (1922, 2.Bd.)
2.2.5 Durch die Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches 1900 wurde im § 1666 (BGB, Viertes Buch, Familienrecht) die Gefährdung des Kindes beschrieben:
"Wird das geistige oder leibliche Wohl des Kindes dadurch gefährdet, daß der Vater das Recht der Sorge für die Person des Kindes mißbraucht, das Kind vernachlässigt oder sich eines ehrlosen oder unsittlichen Verhaltens schuldig macht, so hat das Vormundschaftsgericht die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen Maßregeln zu treffen.
Das Vormundschaftsgericht kann insbesondere anordnen, daß das Kind zum Zwecke der Erziehung in einer geeigneten Familie oder in einer Erziehungsanstalt oder einer Besserungsanstalt untergebracht wird.(..)
§ 1838 (BGB, Viertes Buch, Familienrecht) beschreibt die Unterbringung des Mündels:
"Das Vormundschaftsgericht kann anordnen, daß das Mündel zum Zwecke der Erziehung in einer geeigneten Familie oder in einer Erziehungsanstalt oder in einer Besserungsanstalt untergebracht wird.
Das Bayerische Zwangserziehungsgesetz vom 10.05.1902 ergänzte das BGB bezüglich der Zwangserziehung.
Wesentlich scheinen mir die Alterbegrenzungen zu sein. Art.1, letzter Absatz:
"Zwangserziehung soll nach Vollendung des 16. Lebensjahres eines Minderjährigen nur in besonderen Fällen angeordnet werden."
Im Art. 4 wird angeordnet, daß die Verfügung des Vormundschaftsgerichtes auch dem Minderjährigen, wenn er das 14. Lebensjahr vollendet hatte, selbst zuzustellen sei. Ein Widerspruch hatte aufschiebende Wirkung.
Art. 6, letzter Absatz: "Über das 18. Lebensjahr des Minderjährigen hinaus soll die Zwangserziehung nur in besonderen Fällen fortgesetzt werden."
Mit diesen gesetzlichen Regelungen hofften die Träger der Jugendfürsorge endlich in Ruhe arbeiten zu können. Es wurden die ersten Vorbereitungen sowohl im Reichstag, als auch in den Ländern für ein Jugendwohlfahrtsrecht getroffen. Neben der Gesetzgebung zur Reichssozialversicherung und dem Bürgerlichen Gesetzbuch sollte ein Reichsjugendwohlfahrtsgesetz ebenso modern und richtungsweisend in Europa sein.
In dieser Zeit der Überlegungen und der Bemühungen um zeitgerechte "Erziehung außerhalb der eigenen Familie" brach 1914 der 1. Weltkrieg aus.
Die eigene Bewertung scheint mir zu den vorgenannten Punkten wesentlich zu sein.
Im BGB wurde sowohl im § 1666, als auch im § 1838 neben der Familie die Unterbringung "in einer Erziehungsanstalt oder einer Besserungsanstalt" genannt.
Es ist mir nicht gelungen, festzustellen, warum diese beiden Anstalten immer wieder genannt wurden, jedoch in der Durchführung nicht erkennbar wurden. Welche Unterschiede bei der Gesetzesberatung hierfür Pate standen, konnte ich nicht eruieren.
Im bayersichen Zwangserziehungsgesetz sind neben der Altersbeschränkung bei der Anordnung (16 Jahre) - das spätere RJWG setzt das Anordnungsalter auf 20 Jahre fest - die Zustellungspflicht des Vormundschaftsgerichtsbeschlußes an den Jugendlichen bemerkenswert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.2,6 "Es ist unmöglich, hier alle katholischen Anstalten aufzuzählen, die zum großen Teil in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden und die nach dem Erlaß des Zwangserziehungsgesetzes neben anderen Kindern dann auch Zwangszöglinge aufnahmen. Nach einer Statistik bei Heinrich Reicher über:
(Die Anstalten zur Aufnahme von Fürsorgezöglingen im Deutschen Reich) sollen im Königreich Bayern im Jahre 1904 schon 185 solcher Anstalten bestanden haben und von diesen 136 katholisch gewesen sind." (Bülow, 1959, S.37/38) Vgl. H.Reicher, (1904,S.175)
2.2.7 Erste Ansätze zur Differenzierung der Heime waren auch vor dem 1. Weltkrieg schon zu beobachten.
Ausschlaggebend hierfür waren jedoch nicht pädagogische Erwägungen, sondern eher "Abgrenzungsbemühungen".
So weigerten sich Anstalten, Kinder und Jugendliche, die nicht mehr schulpflichtig waren, aufzunehmen.
"wegen der befürchteten sittlichen Ansteckungsgefahr für die weniger Verdorbenen, dann wohl auch, weil für Fluchtgefahr die entsprechenden Einrichtungen in den caritativen Anstalten nicht getroffen werden können."
"Mehrere Anstalten schlossen auch die älteren zwölf- bis vierzehnjährigen noch schulpflichtigen Jungen von der Aufnahme aus, wenn sie sittlich bereits verwahrlost waren." (Bülow, 1959, S. 202)
Die schulentlassenen männlichen und weiblichen Zöglinge waren besonders schwierig unterzubringen. Schlimm war es auch mit diesem bereits aufgenommenen Personenkreis zu arbeiten, ohne sie bei Schwierigkeiten abgeben zu können. Es sei, es wurden strafbare Handlungen nachgewiesen, die in der Anstalt verübt wurden.
Nach Kenntnis und Auswertung vieler Unterlagen wurden häufig strafbare Handlungen "konstruiert", um den Zögling aus der Anstalt zu entfernen.
(Bisher unveröffentlichte Aufzeichnungen des Verfassers)
Es wurden auch bereits von mehreren "Vereinen" gemeinsame Einrichtungen geschaffen. So z.B. vom kath. Verein zur Erziehung verwahrloster Jugend e.V. München und von der Vincentivskonferenz München und dem Seraphischen Liebeswerk im Mai 1909 ein katholisches Knabenheim in München,zur vorläufigen Unterbringung obdachloser, gefährdeter und straffälliger Jugendlicher geschaffen. (Archiv, Kath. Verein v. 1852)
Es war somit der Anfang für eine Entwicklung der Heimerziehung, Zwangserziehung, Fürsorgeerziehung gelegt, die - ob begründet oder nicht - immer die " strenge Anstalt" als Druckmittel und ordnenden Hinweis in der täglichen Erziehungsarbeit benützt hat.
Die "schlimmen Anstalten" oder die "Endstationen in der Kette der Erziehungsanstalten" waren in vielen Ländern und Provinzen die Staat- lichen Zwangserziehungsheime. In Bayern war es zunächst die Anstalt im Kloster Andechs, später das Gut "Obermühle" bei Glonn für katholische Jungen und die "Rummelsberger Anstalten" für evangelische Jungen.
Für die Mädchen standen die Anstalten der Schwestern des "Guten Hirten" in München für die katholischen und in Neudettelsau für die evangelischen zur Verfügung.
"Da jedoch auf eine völlige Absperrung, aus erzieherischen Gründen, in diesen Anstalten verzichtet wurde, kamen jedes Jahr auch Entweichungen vor." (Bülow, 1959.S.213)
3. Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz
3-1 Die Auswirkungen auf die Fürsorgeerziehung oder Zwangserziehung
"Jugendwohlfahrt ist das Wohlergehen der Jugend. Dieser Zustand ist nicht schon dann gegeben, wenn es der Jugend so ergeht, wie sie es haben möchte. Die Auffassung, daß ein Kind dann am besten gedeiht, wenn man in seine Entwicklung nicht eingreift, ist längst als ein gefährlicher Irrtum erkannt.(...)"
Die Erziehung des Nachwuchses zur leiblichen, seelischen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit ist oberste Pflicht und natürliches Recht der Eltern; die staatliche Gemeinschaft hat über deren Betätigung zu wachen, sich aber unnötiger Eingriffe zu enthalten. (Reichsver- verfassung Art. 120)
Daß aber die staatliche Gemeinschaft ihrerseits das Recht und auch die Pflicht hat, die Erziehung der Kinder, auf deren richtiger Gestaltung, ja ihr Fortbestand zu wesentlichen Teil beruht, zu beeinflußen, finden wir überall als unbestritten anerkannt.(...) In verschiedenen Zeiten, unter verschiedenen Umständen, werden die Grenzen zwischen den Befugnissen der Eltern und jenen der Gemeinschaft verschieden gezogen. (...)
Die Einführung der Fürsorgeerziehung bedeutete eine entschiedene Wendung; wie wenig sie in ihrem Wesen erkannt wurde, beweist die Tatsache, daß man sie als Zwangserziehung bezeichnete, also sich rein an die Herkunft der Einrichtung aus dem Strafrecht und die äußerliche Tatsache ihrer Durchführung gegen den Willen der unmittelbar Beteiligten hielt, nicht aber betonte, daß damit die Gemeinschaft die Pflicht der Sorge für die Kinder übernahm, die an sich die Eltern betraf,(...)"
"Man befaßte sich zunächst mit der Jugend, die sich gegen das Strafgesetz verfehlt und damit kundgegeben hatte, daß ihre Erziehung dem anzustrebenden Ziele ferngeblieben war.(...) Während des Krieges nahm die Verwahrlosung der Jugend in beängstigender Weise zu. 1918 legte die preußische Staatsregierung dem Landtag den Entwurf eines Fürsorgegesetzes für die Jugend vor, worin die Einrichtung von Jugendämtern in allen Stadt- und Landkreisen ins Auge gefaßt war.(...)
Nachdem die neue Verfassung (RV. Art.7) die Zuständigkeit des Reiches außer Zweifel setzte, wurde das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz ausgearbeitet und am 14.06.1922 einstimmig angenommen. Weniger einmütig waren die Vorarbeiten verlaufen. Die Gegensätze, die unser ganzes öffentliches Leben durchziehen, waren durcheinandergeraten.(...) Das Gesetz mußte unter solchen Umständen auf eine erschöpfende Regelung verzichten und seine Ergänzung dem Landesrecht überlassen."
"Man bezeichnet es darum gewöhnlich als Rahmengesetz in dem Sinne, daß es erst noch der Ausfüllung bedarf.(...) Etwas später war auch der Entwurf eines Jugendgerichtsgesetzes an den Reichstag gelangt. (...) und am 16.02.1923 als Gesetz verkündet.(...)
In den Ländern waren inzwischen, vorwiegend ohne besondere gesetzliche Regelung, Einrichtungen getroffen worden, die den des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes mehr oder weniger entsprachen.(...) In Bayern leistete die Hauptarbeit hier die sehr gut entwickelte freiwillige Tätigkeit.1'
(Riß u.a. 1926, S. 1 - δ)
Wie wir aus den zuvor geschilderten Ansätzen der Zwangserziehung in Deutschland erfahren konnten ist die Einführung der Fürsorgeerziehung nur eine Umbenennung der bisher üblichen Zwangserziehung. Das Wesentliche des Gesetzes der Reichsjugendwohlfahrt ist die Einführung der Jugendämter, die sich in der kommunalen Selbstverwaltung und Mitwirkung etablieren konnten. Es war und ist bis heute üblich, daß das Jugendamt aus der Verwaltung und dem Jugendwohlfahrtsausschuß besteht. (Früher in § 9 RJWG ..in der Jugendwohlfahrt erfahrene und bewährte Männer und Frauen aller Bevölkerungskreise zu berufen.)
Die Mitwirkung als Jugendgerichtshilfe, die Amtsvormundschaft und die detaillierte Regelung des Pflegekinderwesens und die Kostenregelung der öffentlichen Erziehung sind die wesentlichen Merkmale dieses Leistungsgesetzes.
Da das Gesetz viele Pflichtaufgaben beinhaltete und zu einer Zeit der höchsten wirtschaftlichen Not verabschiedet wurde (Inflation), verwundert es nicht, daß die Reichsregierung ermächtigt wurde, dieses Gesetz ganz oder teilweise wieder außer Kraft zu setzen oder nur in einzelnen Ländern eher einführen zu lassen.
In Bayern verzögerte sich die Einführung bis 01.01.1926.
Aus diesen Gründen ist es auch erklärlich, daß immer wieder verschiedene Daten als Enstehungsjahr für das RJWG genannt werden.
So ist es auch verständlich, daß sich die Einrichtung von Jugendämtern in vielen Landkreisen bis in die Jahre nach 1933 hingezogen hat.
Allein aus der wirtschaftlichen Mangelsituation heraus konnten sich die Jugendwohlfahrt und somit auch die Fürsorgeerziehung bis 1933 äußerlich kaum fortentwickeln.
Ich habe bewußt längere Passagen aus der Einleitung von Riß, Weit- pert und Richter zitiert, weil diese drei Herren sich auf diesen Text geeinigt haben und somit einen '‘Zeitbericht" dokumentieren.
Die bereits im 2. Satz geäußerte Vermutung gegenüber der Jugend, ist ein typisches Zeichen der damaligen Zeit.
Auch die folgenden Betrachtungen über die Pflichten der staatlichen Gemeinschaft, aber auch die Rechte, die Erziehung der Kinder zu beeinflussen und die Grenzen zwischen den Befugnissen der Eltern und denen der Gemeinschaft zu ziehen, zeugen von der damaligen Einstellung, die aus dem Kaiserreich entlassen, nach einem verlorenen Krieg, einem "schmachvollen Friedensvertrag", sich in die neue Demokratie einfühlen mußte.
Auch die Beurteilung der Fürsorgeerziehung als entschiedene Wendung, ist aus damaliger Sicht verständlich, jedoch nicht richtig erkannt worden.
Was jahrzehntelang als Zwangserziehung etabliert wurde und in der Gesellschaft als solches existent ist, kann nicht durch ein neues Gesetz einen anderen Inhalt bekommen.
So hat das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz sich einen sehr schlechten Start für die Entwicklung der Jugendwohlfahrt ausgesucht, denn zum Zeitpunkt der Verabschiedung wurde die Inflation und die Not der Menschen immer größer.
So war auch in den Heimen der Fürsorgeerziehung das "Überleben" wichtigeres jede Neuorientierung.
Rückblickend ist die Beratung des RJWG in der jungen Weimarer Demokratie, mit den vielen Gegensätzen sowohl politischer, weltanschaulicher, religiöser usw. Art, ein "Markstein" nicht nur in der Jugendfürsorge, sondern auch für die soziale und kulturelle Ent- wick lung des deutschen Volkes und seiner Demokratie."
Damalige Parlamentarier bezeichneten die Materie des Gesetzes als schwierigste, die der Reichstag zu bewältigen hatte.
Vgl. Jans Happe (1971,S.IX)
Es wird von vielen Fachleuten auch heute noch begrüßt, daß damals "keine Mittel" vorhanden waren.
So wurden Leistungsgesetze erlassen, die "demokratisch" von der Gemeinde, über Bezirke und Länder gleichmäßige Belastungen enthielten.
Es wurde verhindert, daß aus Kostengründen öffentliche Hilfe versagt werden konnte.
3.2 Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz in der Zeit von 1933 - 1945
Wenn wir die Entwicklung der Zwangserziehung und Fürsorgeerziehung untersuchen wollen, müssen wir auch die rechtlichen Auswirkungen untersuchen.
Jans-Happe (1971,S.XI) schreiben in Neue Kommunale Schriften des Deutschen Gemeindeverlages "Jugendwohlfahrtsgesetz" über die Zeit von 1933 - 1945:
"Die ansetzende gute Entwicklung der Jugendhilfe auf Grund des Gesetzes wurde 1933 unterbrochen. Die jugendpflegerischen Aufgaben gingen mehr und mehr auf den Staat über. Das Prinzip der kollegialen Amtführung wurde, nachdem es nicht gelungen war, den Widerstand der Rechtssprechung auf diesem Gebiet zu brechen, durch Reichsgesetz vom 1. Februar 1939 endgültig zu Gunsten des "Führerprinzips" beseitigt, wobei die freien Vereinigungen der Jugendwohlfahrt von der Mitarbeit im Jugendamt ausgeschlossen wurden. Wenn dennoch die Grundzüge des Gesetzes auch in der Zeit von 1933 bis 1945 nicht wesentlich verändert worden sind und es außer den organisatorischen Änderungen kaum eine materielle Einbuße erlitten hat, dann spricht auch das sicherlich für die Güte des Gesetzes und den richtigen Weg, den das RJWG 1922 genommen hat."
Wie Juristen es bis heute geschickt verstanden haben, formal-juristisch die "Nazi-Zeit" zu kommentieren, so wird es auch hier getan.
Es ist sicher richtig, daß das Gesetz selbst während der NS-Zeit "kaum eine materielle Einbuße erlitten hat", doch sollte und darf
man die widerrechtlichen Eingriffe dieser Zeit nicht kommentarlos übergehen. Wie konnten die Erziehungsanstalten, Pflegeheime, Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge, wenn sie unliebsame Träger hatten, ersatzlos "enteignet" werden?
So gibt es unzählige Beispiele aus dieser Zeit, wo Rechtsbrüche an der Tagesordnung waren und auch den Bereich der Fürsorgeerziehung betrafen. Die Einweisung von Kindern und Jugendlichen, wenn die Eltern in Schutzhaft genommen wurden, nur weil sie anderer politischer Meinung waren. Wo sind die Vormundschaftsrichter, die Jugendliche als "unwertes Leben" zur Sterilisation "freigegeben" haben?
So gehört m.E. besonders in einen Kommentar zum Jugendwohlfahrtsrecht der Kommunen - also ein Arbeitsmittel, das in jeder Behörde vorhanden ist - wenigstens die Erwähnung dieses Unrechts.
Über die inhaltliche Veränderung der Fürsorgeerziehung in dieser Zeit wird noch besonders zu berichten sein.
3.3 Nach 194S und dem Zusammenbruch
Wie überall in Europa war das Leben auch in den Einrichtungen der Fürsorgeerziehung beinahe zum Erliegen gekommen.
Die materielle Not war unbeschreiblich, die Flüchtlinge und Vertriebenen mußten in einem verwüsteten Land untergebracht und versorgt werden. Die Jugend ohne Eltern aufwachsen, die Väter waren im Krieg, die Mütter mußten arbeiten, mußten für Lebensunterhalt sorgen. Merkmale der Verwahrlosung, wie Diebereien, Beutezüge durch Ruinen, Betrügereien, das "Besorgen und Organisieren" waren plötzlich "Tugenden des Überlebens". Große Teile des Volkes spürten nunmehr am eigenen Leib Not und Armut und den schmalen Grat auf dem Wege zur "Verwahrlosung".
Die Erziehungsanstalten wurden dringend gebraucht. Eltern- und heimatlose Kinder und Jugendliche mußten untergebracht werden. Behörden suchten verzweifelt Heimplätze um dringender Not begegnen zu können. In den Heimem selbst war die Not groß. Es fehlte an allen Ecken und Enden. Primitivste Verhältnisse mußten verändert werden.
Diese Entwicklung hielt bis ca. I960 an. Erst in diesen Jahren konnte man wieder an geregelte Pädagogik denken.
Rechtlich hat der Bundestag 1953 im Rahmen der Novellierung das RJWG auf den Gesetzesstand vor der NS-Zeit zurückgebracht.
Am 14.07.1961 wird eine Änderung des RJWG verabschiedet. Es nennt sich jetzt mit neuer Paragraphenfolge "JWG", die bewährten Bestimmungen des Gesetzes von 1922 bleiben jedoch unberührt.
Im Bereich der Fürsorgeerziehung hat sich - neben der Verabschiedung des Jugendgerichtsgesetzes von 04.08.1953 - keine wesentliche Veränderung ergeben.
Seit Ende 1968 wird um ein "Neues Jugendrecht" verhandelt und diskutiert. Immer wieder gibt und gab es Höhepunkte, die Materie - die uns von 1922 als "ungeheuer schwierig" bekannt ist - des "Rechts auf Bildung und Erziehung" für junge Menschen gesetzlich zu formulieren.
Die Bundesregierungen seit 1969 versuchen in jeder Legislaturperiode zum Ziel zu kommen. Immer wieder werden Entwürfe zurückgezogen, weil - genau wie 1922 - "die Kassen leer sind". Die Antwort der Abgeordneten: "Dieses Leistungsgesetz ist nicht finanzierbar!"
Gab es somit im Bereich der Fürsorgeerziehung seit 1960 keine Bewegung? Doch, denn die Länder haben in eigenen Bestimmungen und Verordnungen Regelungen getroffen, die bei Fachleuten zur Aussage geführt haben, daß "das Jugendwohlfahrtsgesetz von der Praxis überholt und völlig ausgehöhlt wurde."
Selbst ein höchstrichterliches Urteil des Bundesverfassungsgerichts, daß die Fürsorgeerziehung "diskriminierend" sei, wird zur Kenntinis genommen, eine gesetzliche Änderung jedoch nicht erreicht.
3.4 Momentaner R e c h t s z u s t a nd im JWG, besonders der Fürsorgeerziehung
G. Happe schreibt im April 1982:
"Wenn sich jetzt zu Beginn der 9. Legislaturperiode für den Bundesgesetzgeber die Frage stellt, was aus der in der 7. und 8. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages zweimal gescheiterten Jugendhilferechtsreform werden soll, dann gibt es viel an Für und Wider abzuwägen :
-Zu erörtern sind einerseits ein weiteres Mal ('...) die Einrede der notwendigen Finanzen, sowie der Vorwurf, daß bei den neuen Gesetzesentwürfen Länderkompetenzen mißachtet und bei Rechtspositionen der freien Träger verletzt würden.
Auf der anderen Seite ist auf die immer wieder vorgetragene Forderung der Praxis nach einem neuen Jugendhilfegesetz (JHG) eine Antwort zu geben und sind die Reformdiskussionsbeiträge zu honorieren, die man nun schon jahrzehntelang von ihren Trägern gefordert hat"
(1982,S.2)
"Wer sich bis jetzt - an dieser Jugendhilferechtsreform zweifelnd - auf das alte Gesetz verlassen hat und mit ihm sogar zurechtgekommen ist, der wird langsam in seiner Auffassung irre, weil er erleben muß, daß auch Stellen, die in besonderer Weise für seine Anwendung verantwortlich sind, in ihrer Praxis immer mehr vom Gesetz abweichen.
Das G r u n d p r i n z i p der Gesetzestreue scheint ) für das JWG nicht mehr zu gelten."
(Happe, 1982, S. 2)
Ein wesentlicher Rechtsstreit entsteht in der Frage der Fürsorgeerziehung. "Das Verfahren von oberen Gerichten, das darauf gerichtet ist, die Anwendung der FE durch die Vormundschaftsgerichte zu unter binden, stellt sich als eine Überdehnung des Nachrangprinzips der FE dar." (Happe, 1982,;S.3)
Ich möchte den Leser nicht langweilen, deshalb kurz der Sachverhalt: Wenn Kinder verwahrlost sind oder zu verwahrlosen drohen, soll dann nach § 1666 BGB das Sorgerecht den Eltern entzogen und die Kinder in öffentliche Erziehung genommen werden oder soll die Fürsorgeerziehung vom Vormundschaftsgericht über die Kinder angeordnet j werden?
In beiden Fällen wäre die pädagogische Folgerung (wo und wie erziehen) unterschiedslos.
Hier haben obere Gerichte und der Bundesgerichtshof entschieden, daß die Fürsorgeerziehung ein "Makel" sei und deswegen erst nach Überprüfung aller anderen Möglichkeiten anzuwenden sei.
Kann es möglich sein, in der deutschen Rechtssprechung, daß ein Gesetz eine Maßnahme als "Hilfe" ansieht, (das JWG, die FE) und obere Gerichte diese Hilfe als "Makel" beschreiben?
So haben wir seit Jahren einen Rechtszustand, der der "Fürsorgeerziehung" den "langsamen Tod" bringt.
Wenn man jahrzehntelang in dieser Materie zu Hause ist, kann man diese Entwicklung - die Abschaffung der Zwangserziehung, der Für- sorgeerziehung - nur zustimmen.
Die oberen Gerichte haben den "Makel", d.h. die Diskriminierung oder die Stigmatisierung dieser Form der Erziehung bestätigt.
Es müssen somit gravierende "Fehler" gemacht worden sein, denn sonst könnte doch nicht von der einen Seite eine Maßnahme als "Hilfe" angepriesen und von der anderen Seite diese Hilfe als "Stigma", d.h. "Zeichnung für das ganze Leben" gedeutet werden.
Schwierigkeiten bereitet mir die Tasache, daß gerade in dem sensiblen Bereich der "Jugendverwahrlosung", wo es in der Regel ohne "Rechtsbrüche" nicht geht, diese konsequenterweise bei den Kindern und Jugendlichen verfolgt, d.h. geahndet werden, während mangelnde "Gesetzestreue" von den Ämtern und Gerichten mindestens im Falle des JWG ignoriert werden.
Vgl. Happe (1982,S.2) sowie Bundestag-Drucksache (ВТ)(II1/2226/1960)
Im Februar 1989 erhielt ich von einem Verlag die Mitteilung, daß jetzt das neue Jugendhilferecht zur Verabschiedung bereit liegt.
Ich erbat über unseren MdB um Zusendung evt. Unterlagen und um Bestätigung dieser Verlagsmitteilung.
Ich erhielt Anfang März 1989 eine Drucksache ohne Nummer oder Verfasserangabe "Neuordnung des Jugendhilferechts". Umfang acht DIN А 4 Seiten.
Einige Auszüge seien genannt:
"Das Jugendwohlfahrtsgesetz ist längst von der gesellschaftlichen Entwicklung überrollt worden."
Es werden zwei Ziele genannt: Den jungen Menschen eine bessere Perspektive für ihre künftige Lebensgestaltung zu eröffnen und ihre Integration in die Gesellschaft zu erleichtern. Mütter und Väter bei ihren Erziehungsaufgaben zu unterstützen.
..."neben den klassischen Formen der Pflegefamilie und der Heimerziehung die gesetzliche Verankerung ambulanter und teilstationärer erzieherischer Hilfen (sozialpädagogische Familienhilfen, Tagesgruppe im Heim)."
Von einer Streichung der Fürsorgeerziehung im JWG ist nicht die Rede.
Vor wenigen Tagen, 10.03.89, erhielt ich die mündliche Auskunft eines MdB, daß voraussichtlich der Entwurf des Jugendhilferechtes zurückgezogen wird, da er nicht finanzierbar sei und die "politische
Landschaft" momentan hierzu nicht geeignet scheint. Für diese Legislaturperiode ist somit das Jugendhilferecht "gestorben".
3.5 In dieser Ausarbeitung möchte ich versuchen, die "Fehler und Unstimmigkeiten", die zu dieser Rechtsunsicherheit geführt haben zu untersuchen und vor allen Dingen überprüfen, wie sich diese "Rechtsunsicherheit" in absoluten Zahlen der Statistik der Fürsorgeerziehung in den letzten Jahren ausgewirkt hat.
Hierzu verwende ich ausschließlich Materialien, die vom AFET = früher Allgemeiner Fürsorgeerziehungstag, heute Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe e.V., Sitz Hannover, herausgegeben wurde.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Am 31. Dezember 1970 waren von dem Bestand von 18 928 Minderjährigen in FB 18 060 untergebradit, nicht untergebracht waren 868 (3,0%).
In Heimen „privater gewerblicher Träger" befanden sich 185 Minderjährige ; in Beobachtungs- und Auffangheimen 150.
Die meisten Minderjährigen in FE waren in Erziehungsheimen untergeb rächt: 48,9 %i in. den Vorjahren 1969 : 52,1 %, 1968: 55,0%, 1967: 53,3%, 1966: 51,6%. Von den in Heimen untergebracfaten Minderjährigen in FE (9266) sind 74,6 % (1969: 74,1 %, 1968: 72,6%, 1967: 72,0%) in Heimen der Träger der freien Jugendhilfe (Verbände der freien Wohlfahrtspflege) untergebracht (gern. § 5 Abs. 4 JWG). Die Minderjährigen in Erziehungsheimen der öffentlichen Hand waren zu 77,8 % männlich, während der Anteil der männlichen Minderjährigen in Heimen der Träger der freien Jugendhilfe nur 52,7 % betrug.
Ein erheblicher, Teil der Minderjährigen in FE ist in Familien (einschließlich Lehr- und Arbeitsstellen) untergebracht (7687, das sind 42,5 %), und zwar überwiegend (30,7 %) in der eigenen Familie.
11,4% der in FE untergebrachten Minderjährigen (2072) standen in einem Lehr- und Arbeitsverhältnis, weitere 21,6% in einem sonstigen Arbeitsverhältnis (3931).
Quelle: Mitgiederrundbrief der Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe (AFET) e.V. Bundesvereinigung. Nr. 2 April 1972 Seite 9/lo
4.20 Minderjährige der FE nach Art der Unterbringung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die errechneten Prozentsätze wurden nach der zweiten Kommastelle auf- bzw. abgerundet. z.B. 4,48 = 4,5, 17.23 = 17,2.
1967 habe ich mit 100 % angenommen um die Abnahme der iahlen sichtbar zu dokumentieren. So ist z.B. 1983 = 7,6 % im Verhältnis zu 1967.
Die im Heim untergebrachten Jugendlichen'sind selbstverständlich zur ' Gesamtzaftl gedacht.
Der Anteil der Jugendlichen aus NRW war immer schon um ca 2o %, also relativ hoch. Nach der Konsolidierung der FE Ende der 70er Jahre steigt der Anteil auf über 30 %, nach den Zeiten der "Differenzierung sozialer Hilfen" steigt der Anteil in NRW auf über 50 %.
Anmerkungen und Bewertungen zu den statistischen Angaben.
1 - Es geht bei meinen Bemühungen einzig um die verbliebene Zwangserziehung = die FE oder Fürsorgeerziehung.
'Selbstverständlich ist mir bekannt und bewußt, daß es andere Formen der Erziehungshilfen - auch in der Heimerziehung - gibt. So die FEH= Freiwillige Erziehungshilfe, die HzE = Hilfe zur Erziehung, Erziehungsbeistandschaft, § 75a JWG = Hilfe für Volljährige.
Alle diese Hilfemöglichkeiten finden wir auch in der Heimerziehung, z.B. wenn ein Erwachsener (Volljähriger) seine Ausbildung in der Heim- erziehung"freiwillig" beenden will.
2.Die statistischen Zahlen sind zuverlässig, sie werden jährlich von der Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaft Erziehungshilfe e.V. im Zusammenwirken mit der Arbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter und dem statistischen Bundesamt erstellt.
3.In der Skizze 1 und 2 sind die Original-Unterlagen der Jahre 1970 und 1986 abgedruckt. Aus diesen Unterlagen und den der dazwischenliegenden Jahre habe ich die Skizze 3 erstellt.
4. Aus dieser graphischen Darstellung ist der "Absturz der Fürsorgeerziehung" besonders abzulesen. Die schraffierten Anteile stellen den Teil der jungen Menschen dar, die sich in der Heimerziehung befinden.
5. Der Anteil der jungen Menschen, die am Ende 1986 in Fürsorgeerziehung waren beträgt im Verhältnis zur gesamten jungen Generation in der Bundesrepublik nicht einmal 0,1 ooo. d.h. nicht einmal 1 junger Mensch von 10.000 ist zur Zeit in der Zwangserziehung.
6- In der Skizze 4 sind die Zahlen der Skizze 3 überprüfbar. Wichtig ist der Hinweis, daß das Land Nordrhein-Westfalen allein 1986 54,3 % aller angeordneter Fürsorgeerziehungen verantwortet.
Es liegt nicht am bevölkerungsreichsten Bundesland, denn wie aus Skizze 2 ersichtlich, hat Hamburg keine FE mehr, Bremen 9, davon 5 im Heim, Saarland 4,Berlin 12,Rheinland-Pfalz 17, usw.
7. Liegt es an der von Happe zuvor geschilderten "Gesetzestreue" der Behörden in den Bundesländern ? Liegt es daran, daß Herr Happe Landesrat in Nordrhein-Westfalen ist und für Gesetzestreue in seiner Behörde sorgt? Aus welchen Gründen weiterhin in NRW die Fürsorgeerziehung angeordnet wird, konnte ich letztlich nicht eruieren.
8. Aus den statistischen Unterlagen ist jedenfalls überzeugend dargelegt, daß sich die Fürsorgeerziehung und damit der "Rest" der Zwangserziehung in der Bundesrepublik überlebt hat. Sie ist bedeutungslos geworden.
4 . Kritik an der Zwangserziehung.
Worauf zielt die Kritik?
"Wir haben anläßlich des "Benno Festes ", eine Veranstaltung des Katholikenrates der Erzdiözese München und Freising im "Internationalen Jahr des Kindes" 1979, mit dem Straßentheater " Das häßliche Entlein " in der Münchner Fußgängerzone auf die Diskrimminierung der "Heimkinder" hinweisen wollen. Wir sammelten für die Kinder der Dritten Welt.
Ein Jugendlicher erhielt ein Plakat mit der Aufschrift "Vollwaise" ein anderer eines mit "Verwahrlost". Beide hatten Sammelbüchsen. Wir mußten nach kurzer Zeit die Büchse des "Vollwaisen" erneuern, da sie gefüllt war. Die Sammelbüchse des "Verwahrlosten" war am Nachmittag noch nicht gefüllt."(Tagebuchnotiz des Verfassers, bisher unveröffentlicht.)
"Immer wenn sich ein Waisenkind in der Öffentlichkeit zeigt, findet es allgemeine Teilnahme, man bedauert und bemitleidet es,...Wenn aber eines seiner bedauernswerten Stiefgeschwister, ein Fürsorgekind sich zeigt,erlischt die Wärme des Blickes im Auge des Menschen...gleichgültig wendet sich die weiteste Öffentlichkeit von ihm ab, den das Gesetz gezeichnet, der Volksmund als Sträfling bezeichnet und zum Verbrecher prädestiniert. Die wenigen, die sich seiner in liebevoller Teilnahme annehmen, werden mit fragenden Blicken betrachtet." (Kettenhofen, 1926, S.16)
Woher kommt dieses Verhalten der Mitmenschen gegenüber den "Verwahrlosten" oder "Verhaltensgestörten" ?
Ist der " Verwahrloste " Schuld an seinem Makel ?
Hat die Zwangserziehung diesen Makel erzeugt ?
4.1. Ist der Verwahrloste (selbst) Schuld an seinem Makel ?
Es sind über Verwahrlosungen, ihre Entstehung unzählige Kommentare und Berichte geschrieben worden. So kann ich mich auf wesentliche plakative Aussagen beschränken, denn wenn man sich mit der Zwangserziehung beschäftigt, kann man an diesem Begriff nicht Vorbeigehen.
[...]
- Arbeit zitieren
- Dr. Phil. M.A. Hans-Siegfried Fiedler (Autor:in), 1989, Heimerziehung im Fortschritt - Vom RJWG (Reichsjugendwohlfahrtsamt 1923) bis zur Gegenwart, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125952