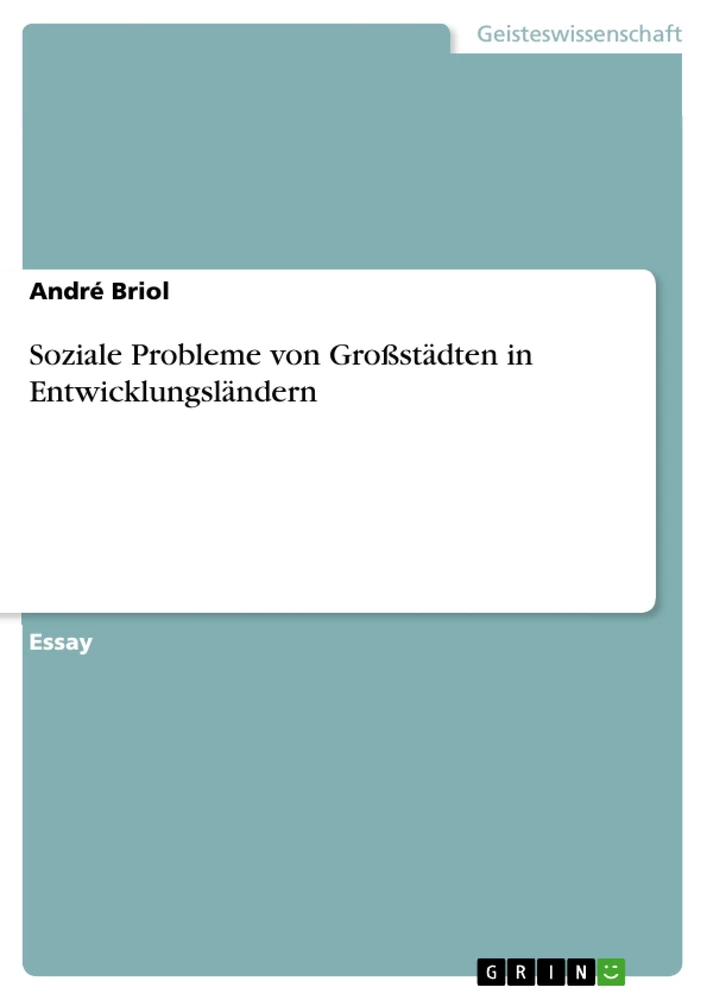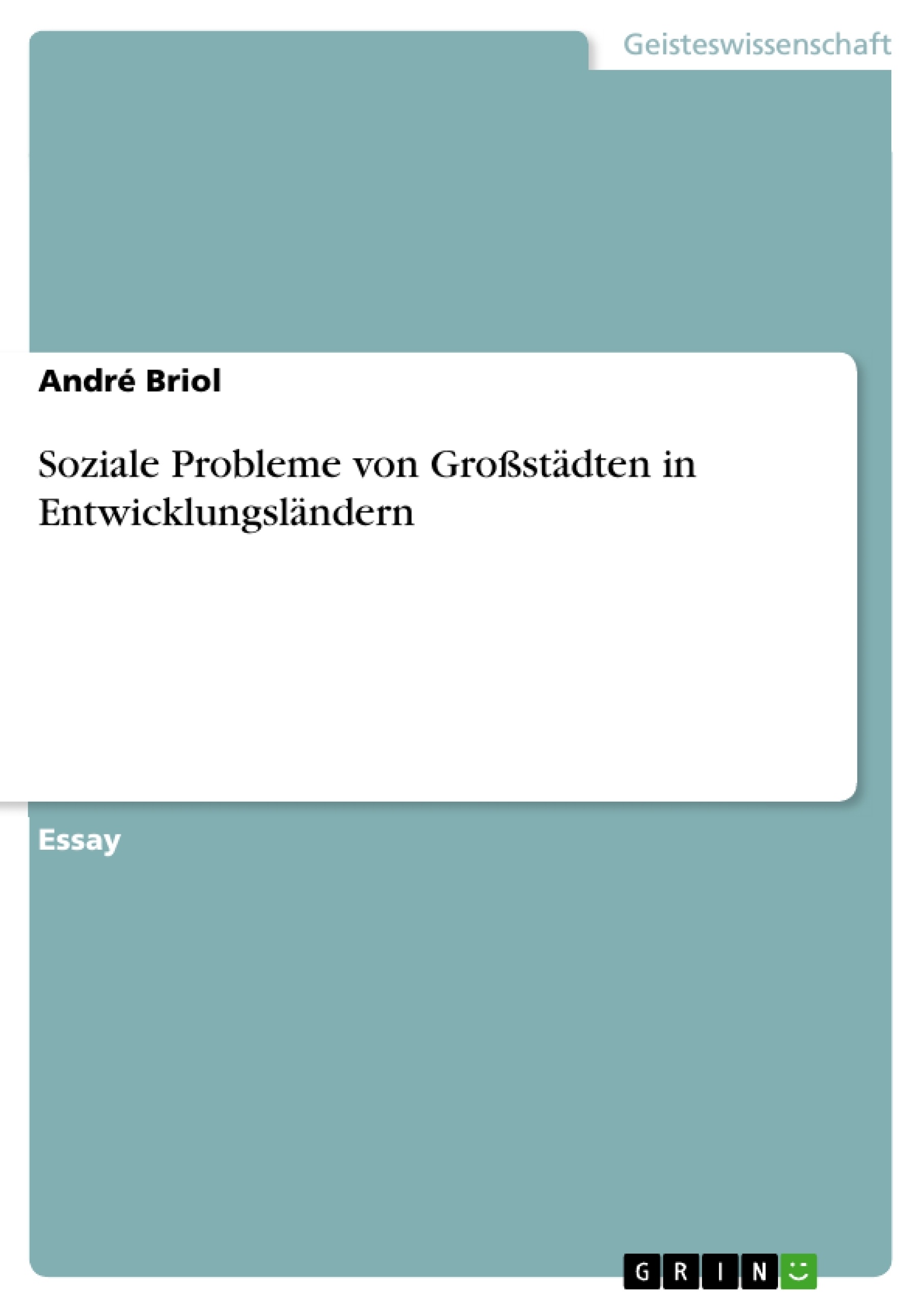Bei der Betrachtung der Probleme von Großstädten in Entwicklungsländern bietet es sich an, den Fokus auf die so genannten Megacities zu richten, da diese Probleme, ungeachtet welcher Natur, in diesen Ballungsräumen am deutlichsten zu Tage treten und so im Hinblick auf den unverhältnismäßig starken Bevölkerungszuwachs, der für Großstädte in Entwicklungsländern obligat ist, durchaus auch auf die Städte mit unter 10 Millionen Einwohnern übertragbar ist.
1. Vorbemerkung
Bei der Betrachtung der Probleme von Großstädten in Entwicklungsländern bietet es sich an, den Fokus auf die so genannten Megacities zu richten, da diese Probleme, ungeachtet welcher Natur, in diesen Ballungsräumen am deutlichsten zu Tage treten und so im Hinblick auf den unverhältnismäßig starken Bevölkerungszuwachs, der für Großstädte in Entwicklungsländern obligat ist, durchaus auch auf die Städte mit unter 10 Millionen Einwohnern übertragbar ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab.1: Die 20 Megacities der Erde
Wie die nebenstehende Tabelle[1] veranschaulicht, liegen 12 der 20 Megacities der Erde in Entwicklungs- bzw. Schwellenländern. Den Status einer Megacity erhält eine Stadt (inklusive deren Agglomeration), wenn sie eine Einwohnerzahl von mindestens 10 Millionen aufweisen kann. Ein weiteres Kriterium, welches eine Großstadt zur Megacity werden lässt, ist eine Bevölkerungsdichte von mindestens 2000 Einwohnern pro Quadratkilometer.
Megacities in Entwicklungsländern entstehen einerseits durch massenhafte Binnenmigration der Landbevölkerung. Die Ursachen für diese Landflucht sind in erster Linie in den attraktiven Erwerbsmöglichkeiten zu finden, die Großstädte bieten. Andererseits explodieren die Bevölkerungszahlen innerhalb der Megacities aufgrund der Tatsache, dass die meisten der Zugewanderten junge Menschen sind und deren Nachwuchs ebenso zu einem rasanten Bevölkerungszuwachs beiträgt.
2. Probleme der Megacities
Megacities sehen sich – gerade durch den unkontrolliert rasanten Anstieg der Einwohnerzahlen – mit zahlreichen Problemen konfrontiert. Zwar beschränken sich diese Probleme keineswegs nur auf Großstädte in Entwicklungsländern, treten hier aber dennoch mit vermehrter Intensität auf. So ist an erster Stelle der Mangel an Wohnraum und die damit verbundene infrastrukturelle Überforderung zu nennen. Da Megacities in der Dritten Welt nicht wie beispielsweise London oder andere Großstädte in Industrieländern natürlich gewachsen sind oder sich ausbreiten konnten, ist der angesprochene Wohnraummangel zum Teil ganz profan durch einen Platzmangel begründet. Zum anderen sind Megacities dadurch auch nicht in der Lage, ausreichend Erwerbsmöglichkeiten für alle Bevölkerungsschichten anzubieten. Gerade deshalb sind besonders hier extreme Vermögens- und Einkommensgefälle innerhalb der Bevölkerung auf engstem Raum zu beobachten. Ergebnis dessen ist wiederum eine starke Segregation der Bevölkerungsschichten in Großstädten – es findet eine Entmischung statt. So sind die so genannten ‚gated communities’ ein Symptom dieser Entwicklung – vermögende Stadtbewohner ziehen sich zum Schutz in meist abgezäunte und von Sicherheitsdiensten überwachte Wohngebiete zurück; die Mittelschicht verschwindet immer mehr aus dem sozialen Gefüge der Großstädte. Letztendlich bildet die überproportional vertretene Unterschicht der Großstadtbevölkerung einen informellen Sektor heraus. Eine knappe und präzise Definition für den Terminus ‚informeller Sektor’ findet man bei Bronger (1997b): „Informeller Sektor (ist ein) alternativer Beschäftigungssektor der marginalisierten Bevölkerungsteile vornehmlich in den Entwicklungsländern. Im Unterschied zur Schattenwirtschaft in den Industrieländern, deren Einkommen Neben- und Zuerwerb sind, gilt der informelle Sektor als Überlebensökonomie – im Unterschied zum formellen Sektor ohne soziale Sicherheit und gewerkschaftliche Organisationen.“
Eine weitere Folgewirkung der beschriebenen Arbeits- und Wohnraumdefizite sind die Entstehung von Marginalsiedlungen innerhalb von Großstädten – Elends- und Armenviertel mit zum Großteil einfachsten Hüttenbauten. Zudem meist ohne jegliche kommunale Verwaltung und städtebauliche Kontrolle entstanden, lassen sich diese Marginalsiedlungen noch weiter in Slums und Squattersiedlungen unterscheiden[2]. Ein Slum ist so ein „Elendsviertel, entstanden durch baulichen Verfall und Verwahrlosung ehemaliger Arbeiter-, aber auch mittelständiger Viertel. Heruntergekommene Bausubstanz, hohe Wohndichte, geringe Einkommen der Bewohner, sowie häufig ein hohes Maß an sozialem Verfall (z.B. Kriminalität, Drogenkonsum) kennzeichnen die Slums, deren Ausgang in England (19. Jahrhundert), später in den USA zu suchen ist und deren Verbreitung heute zwar überwiegend in den Großstadtagglomerationen der ‚Dritten Welt’ zu finden, aber keineswegs auf diese beschränkt ist.“[3] Dem gegenüber sind Squattersiedlungen nach Bronger (1997b) „im Gegensatz zu den Slums spontan und ohne rechtliche Erlaubnis der Behörden oder des Landeigentümers auf fremden Boden errichtete Hüttensiedlungen. Squatter sind fast ausschließlich auf Entwicklungsländer beschränkt. Sie finden sich am Rande, öfter jedoch in zentrumsnahen Bereichen der Großstädte: hier in peripheren Gebieten (entlang von Bahndämmen, Flussufern, an Hängen, versumpften Gebieten etc.). Die Squatterbewohner rekrutieren sich zum Teil aus solchen innerstädtischen Slums. Die große Mehrheit der „squatters“ sind Hüttenbesitzer; sie empfinden den Wegzug aus den Slums somit als sozialen Aufstieg.“
[...]
[1] Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung
[2] Vgl. Bronger (1997b)
[3] Vgl. Bronger (1997b)
- Quote paper
- André Briol (Author), 2008, Soziale Probleme von Großstädten in Entwicklungsländern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125870