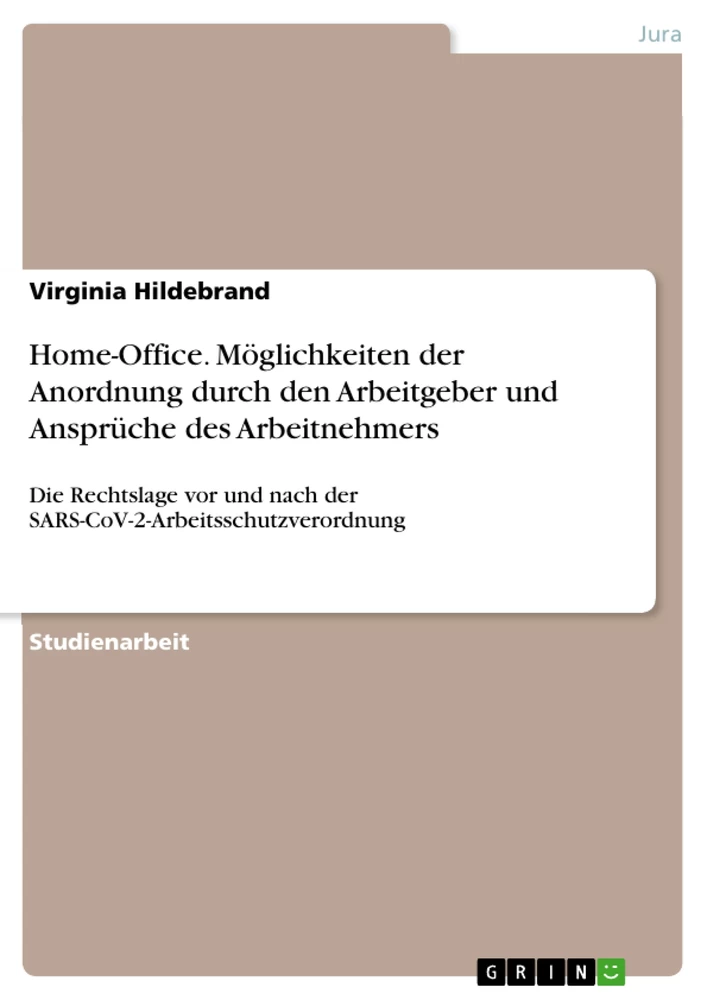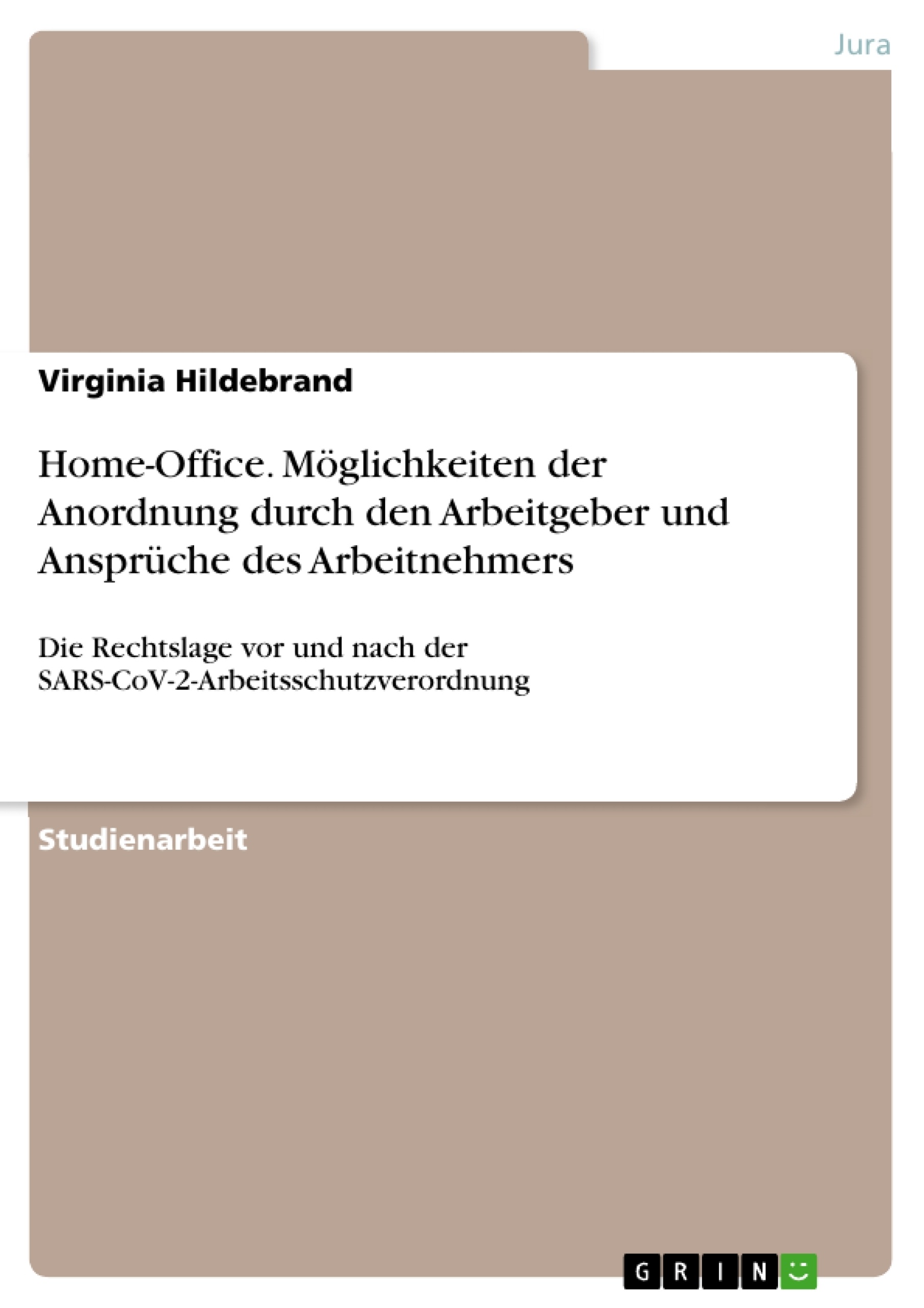Aufgrund der bisher nur befristeten Gültigkeit der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung und dem Ziel, gem. § 1 Abs. 1 SARS-CoV-2-Arbeitschutzverordnung der Eindämmung der Pandemie zu dienen, wird in dieser Arbeit sowohl die bisherige Rechtslage als auch die aktuelle Rechtslage im Sinne der Verordnung dargestellt. Ein gesetzlicher Anspruch auf Home-Office, welcher über die Pandemie hinaus bestehen soll, ist klar von der aktuell geltenden Verordnung abzugrenzen. Den Medien zufolge soll es jedoch bereits vor Inkrafttreten der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung einen Arbeitsentwurf für ein Gesetz zur mobilen Arbeit, welches einen gesetzlichen Anspruch auf mobiles Arbeiten regeln soll, im Bundesarbeitsministerium gegeben haben. Jedoch sieht dieses lediglich einen Anspruch von 24 Tagen Home-Office pro Jahr vor.
Die Einführung von Home-Office in einem Unternehmen bedarf einer wirksamen Rechtsgrundlage. Eine solche Rechtsgrundlage kann zum einen mit Hilfe einer individuellen Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geschaffen werden. In diesen Fällen ist es üblich eine Regelung in den Arbeitsvertrag mit aufzunehmen oder eine gesonderte Home-Office-Vereinbarung neben dem Arbeitsvertrag zu verfassen. Zum anderen können in Unternehmen, die über einen Betriebsrat verfügen, die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit Home-Office innerhalb einer Betriebsvereinbarung geregelt werden. Wie sieht es jedoch in den Fällen aus, in denen Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich nicht einig werden? Welche Möglichkeiten für Arbeitgeber gibt es, den Arbeiternehmer auch gegen dessen Einwilligung ins Home-Office zu schicken? Gibt es Fallkonstellationen nach denen der Arbeitnehmer auch ohne eine Anweisung des Arbeitgebers ein Anrecht darauf hat von zu Hause zu arbeiten und dem Büro fernzubleiben? Werden sich im Hinblick auf die Pandemie neue rechtliche Möglichkeiten ergeben?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinition: Home-Office
- 3. Rechtslage
- 3.1 Ansprüche des Arbeitnehmers
- 3.1.1 Während der Corona-Krise
- 3.1.2 Mit in Kraft treten der Corona-ArbSchV
- 3.1.3 Nach der Covid-19-Pandemie
- 3.2 Möglichkeiten der Anordnung durch den Arbeitgeber
- 3.2.1 Vor der Corona-Pandemie
- 3.2.2 Während der Corona-Krise
- 3.1 Ansprüche des Arbeitnehmers
- 4. Arbeitsmittel und Aufwendungsersatz
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit den arbeitsrechtlichen Fragen rund um das Thema Home-Office, insbesondere im Kontext der Covid-19-Pandemie. Ziel ist es, die Rechtslage sowohl vor, während und nach der Krise zu klären und die Ansprüche von Arbeitnehmern sowie die Möglichkeiten der Anordnung durch Arbeitgeber zu beleuchten.
- Ansprüche des Arbeitnehmers auf Home-Office
- Möglichkeiten der Anordnung von Home-Office durch den Arbeitgeber
- Rechtslage vor, während und nach der Corona-Pandemie
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Home-Office"
- Arbeitsmittel und Aufwendungsersatz im Home-Office
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Ausarbeitung, der durch die Covid-19-Pandemie und die damit verbundene Zunahme von Home-Office-Arbeit geprägt ist. Sie hebt die Notwendigkeit einer Klärung der arbeitsrechtlichen Fragen hervor, die sich aus der schnellen und spontanen Umsetzung von Home-Office ergeben. Die Einleitung stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor, beispielsweise die Frage nach dem Recht des Arbeitgebers zur Anordnung von Home-Office und den Ansprüchen des Arbeitnehmers in diesem Zusammenhang. Die Bedeutung der Rechtsgrundlagen für die Einführung von Home-Office wird betont, wobei sowohl individuelle Vereinbarungen als auch Betriebsvereinbarungen erwähnt werden. Die Einleitung führt den Leser in die Problematik ein und formuliert die Forschungsfrage nach den Möglichkeiten und Grenzen von Home-Office im Arbeitsrecht.
2. Begriffsdefinition: Home-Office: Dieses Kapitel widmet sich der Definition des Begriffs "Home-Office", der im Gesetz nicht explizit definiert ist. Es analysiert die rechtliche Einordnung des Begriffs anhand von § 2 Abs. 7 ArbStättV, der Telearbeit beschreibt. Der Unterschied zwischen Home-Office, alternierender Telearbeit und mobilem Arbeiten wird herausgearbeitet. Es wird erklärt, dass Home-Office im allgemeinen Verständnis oft eine Kombination aus Arbeit im Unternehmen und zu Hause beinhaltet, im Gegensatz zum rein mobilen Arbeiten von beliebigen Orten aus. Das Kapitel schließt mit der Abgrenzung zum Begriff der Heimarbeit und der Diskussion des Gesetzesentwurfs zur mobilen Arbeit.
3. Rechtslage: Dieses Kapitel untersucht die Rechtslage bezüglich Home-Office, getrennt in die Ansprüche des Arbeitnehmers und die Anordnungsmöglichkeiten des Arbeitgebers. Es analysiert die Entwicklung der Rechtslage während und nach der Corona-Krise. Der Fokus liegt auf der Frage nach einem gesetzlichen Anspruch auf Home-Office, der über die Pandemie hinaus bestehen soll. Das Kapitel untersucht auch die Rechtslage vor der Pandemie und beleuchtet die verschiedenen Möglichkeiten der Rechtsgrundlagen wie individuelle Vereinbarungen und Betriebsvereinbarungen. Es wird eingegangen auf die Situation, wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich nicht einigen können, und welche Handlungsmöglichkeiten dem Arbeitgeber zur Verfügung stehen.
4. Arbeitsmittel und Aufwendungsersatz: Dieses Kapitel befasst sich mit den arbeitsrechtlichen Aspekten der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und des Aufwendungsersatzes für Arbeitnehmer im Home-Office. Es analysiert die rechtlichen Verpflichtungen des Arbeitgebers bezüglich der Ausstattung des Home-Office Arbeitsplatzes und die Erstattung von entstehenden Kosten.
Schlüsselwörter
Home-Office, Arbeitsrecht, Corona-Pandemie, Arbeitnehmerrechte, Arbeitgeberpflichten, Rechtsgrundlagen, Telearbeit, mobiles Arbeiten, Arbeitsschutzverordnung, individuelle Vereinbarung, Betriebsvereinbarung, Aufwendungsersatz, Arbeitsmittel.
FAQ: Arbeitsrechtliche Fragen rund um Home-Office im Kontext der Covid-19-Pandemie
Was ist der Gegenstand dieser Ausarbeitung?
Diese Ausarbeitung behandelt arbeitsrechtliche Fragen zum Thema Home-Office, insbesondere im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Sie klärt die Rechtslage vor, während und nach der Pandemie und beleuchtet die Ansprüche von Arbeitnehmern sowie die Anordnungsmöglichkeiten für Arbeitgeber.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Ausarbeitung deckt folgende Themen ab: Ansprüche des Arbeitnehmers auf Home-Office, Möglichkeiten der Anordnung von Home-Office durch den Arbeitgeber, die Rechtslage vor, während und nach der Corona-Pandemie, Definition und Abgrenzung des Begriffs "Home-Office", sowie Arbeitsmittel und Aufwendungsersatz im Home-Office.
Wie ist die Ausarbeitung strukturiert?
Die Ausarbeitung beinhaltet eine Einleitung, eine Begriffsdefinition von Home-Office, einen Abschnitt zur Rechtslage (unterteilt in Arbeitnehmeransprüche und Arbeitgeberanordnungen), ein Kapitel zu Arbeitsmitteln und Aufwendungsersatz und abschließend ein Fazit. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Wie wird der Begriff "Home-Office" definiert?
Da der Begriff "Home-Office" gesetzlich nicht explizit definiert ist, wird er im Kontext von § 2 Abs. 7 ArbStättV (Telearbeit) eingeordnet. Die Ausarbeitung differenziert zwischen Home-Office, alternierender Telearbeit und mobilem Arbeiten und grenzt den Begriff auch von Heimarbeit ab. Der Unterschied liegt vor allem in der Kombination von Arbeit im Unternehmen und zu Hause im Gegensatz zum rein mobilen Arbeiten von beliebigen Orten aus.
Welche Ansprüche hat ein Arbeitnehmer auf Home-Office?
Die Ausarbeitung untersucht die Ansprüche des Arbeitnehmers auf Home-Office vor, während und nach der Corona-Krise. Sie analysiert, ob ein gesetzlicher Anspruch auf Home-Office besteht, der über die Pandemie hinausgeht, und beleuchtet die verschiedenen Rechtsgrundlagen wie individuelle und Betriebsvereinbarungen. Die Situation, wenn sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht einigen können, wird ebenfalls behandelt.
Welche Möglichkeiten hat der Arbeitgeber, Home-Office anzuordnen?
Die Ausarbeitung beleuchtet die Möglichkeiten des Arbeitgebers, Home-Office anzuordnen, sowohl vor als auch während der Corona-Krise. Sie untersucht die Rechtslage und die verschiedenen Möglichkeiten der Rechtsgrundlagen, wie individuelle Vereinbarungen und Betriebsvereinbarungen. Es wird darauf eingegangen, welche Handlungsmöglichkeiten dem Arbeitgeber zur Verfügung stehen, wenn keine Einigung mit dem Arbeitnehmer erzielt wird.
Wie verhält es sich mit Arbeitsmitteln und Aufwendungsersatz im Home-Office?
Dieses Kapitel befasst sich mit den arbeitsrechtlichen Aspekten der Bereitstellung von Arbeitsmitteln durch den Arbeitgeber und dem Aufwendungsersatz für die Arbeitnehmer im Home-Office. Es analysiert die rechtlichen Verpflichtungen des Arbeitgebers hinsichtlich der Ausstattung des Home-Office-Arbeitsplatzes und der Erstattung entstehender Kosten für den Arbeitnehmer.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Ausarbeitung?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Home-Office, Arbeitsrecht, Corona-Pandemie, Arbeitnehmerrechte, Arbeitgeberpflichten, Rechtsgrundlagen, Telearbeit, mobiles Arbeiten, Arbeitsschutzverordnung, individuelle Vereinbarung, Betriebsvereinbarung, Aufwendungsersatz, Arbeitsmittel.
- Quote paper
- Virginia Hildebrand (Author), 2021, Home-Office. Möglichkeiten der Anordnung durch den Arbeitgeber und Ansprüche des Arbeitnehmers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1257372