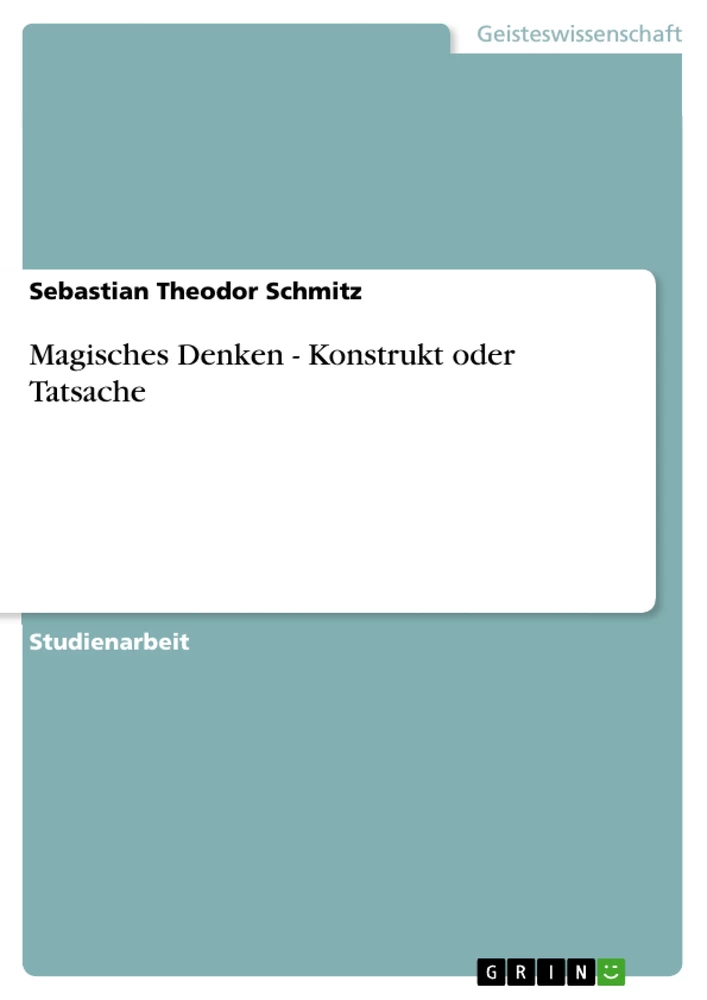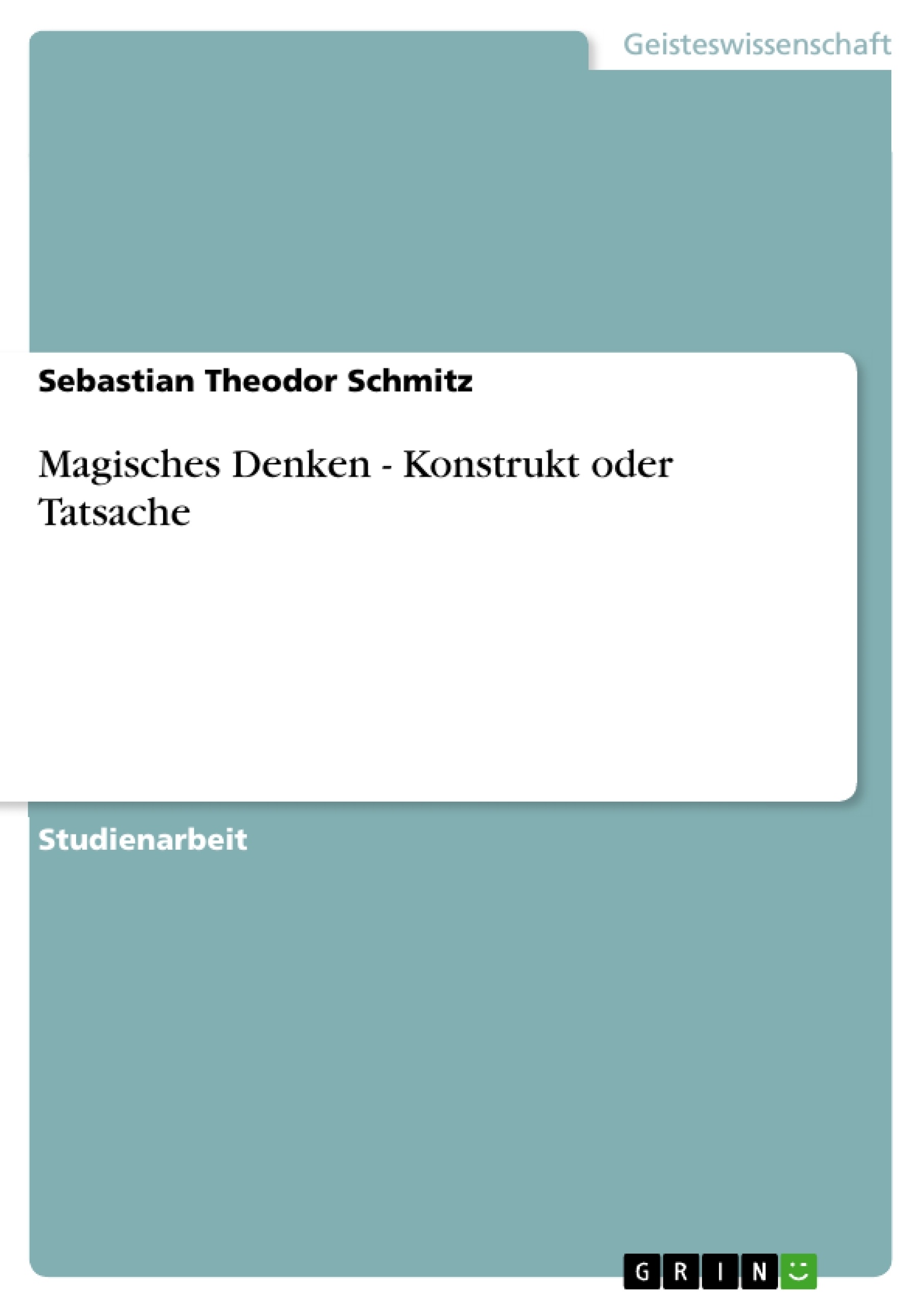„Die Seele enthält so viele Rätsel wie die Welt mit ihren galaktischen Systemen, vor deren erhabenem Anblick nur ein phantasieloser Geist sein Ungenügen sich nicht zugestehen kann. Bei dieser äußersten Unsicherheit menschlicher Auffassung ist aufklärerisches Getue nicht nur lächerlich, sondern auch betrüblich geistlos“ (Jung 1976: 414). Mit der Veröffentlichung seines Cours de philosophie positive läutet Auguste Comte
zu beginn der 1840er Jahre die Geburtsstunde der akademischen Disziplin Soziologie ein. Das neu erschaffene Fach sollte zugleich Bindeglied und Krone im Reigen der Wissenschaften sein. Wie lässt sich nun dieser hohe Anspruch begründen? Die
Aufgabe der Soziologie sah Comte in der Produktion „empirischen Wissens über Tatsachen im Kontext eines sich naturgesetzlich
durchsetzenden Fortschritts […] Das soziologische Denken will er auf Tatsachen und die Naturgesetzlichkeit sozialer Erscheinungen zurückführen.“ (Rolshausen 2001: 89) Die Soziologie erklärt dieser Auffassung folgend sowohl die „Modernisierung“ und
Industrialisierung des Abendlandes, als auch deren Ausbleiben in weniger entwickelten Gesellschaften. Gesellschaftlicher und kulturgeschichtlicher Entwicklung liegt demnach eine exakte Funktion zugrunde. Sind die Variablen mitsamt mathematischen
Verhältnissen zueinander bekannt, so lässt sich jede soziale Tatsache rekonstruieren. Es sind, so Comte, objektive Kriterien, die Gesellschaften und wichtiger: deren Fortentwicklung determinieren. Die Beschaffenheiten und die Evolution
menschlichen Zusammenlebens werden so auch in der Makroperspektive erklärbar. Und mehr noch: Die Kenntnis der Funktionsgleichung der sozialen Welt impliziert
nicht nur, dass sämtliche ihrer Determinanten bekannt und erfassbar sind, es ist hier sogar möglich sozialem Geschehen einen Punkt in der Funktionskurve zuzuweisen und mit anderen Punkten zu vergleichen. Für Comte und Generationen seiner geistigen Nachfolger ist die Entwicklung der Menschheit vor allem und in erster Linie eine Entwicklung des Denkens. Dies kommt in seinem Dreistadiengesetz in prägnanter Weise zum Ausdruck. So wie das Kind zum Erwachsenen heranreift, so befindet sich auch die Menschheit in einem fortwährenden Reifeprozess1, der freilich im Triumph der Wissenschaft über primitive Affektlastigkeit und mythische Irrationalitäten mündet. Das finale positive Stadium Comtes ist durch die Erforschung von Kausalbeziehungen
objektivierter Tatsachen geprägt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lévy-Bruhl
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, ob magisches Denken ein Konstrukt oder eine Tatsache ist. Sie analysiert die Konzepte des magischen Denkens, wie sie von Lucien Lévy-Bruhl und anderen beschrieben wurden, im Kontext der soziologischen Theorie August Comte's und dessen Dreistadiengesetz. Die Arbeit beleuchtet kritisch die methodischen Ansätze und die impliziten kulturellen Werturteile der frühen soziologischen Studien zum Thema.
- Magisches Denken als Konzept in der frühen Soziologie
- Kritische Analyse der Methoden von Lévy-Bruhl
- Der Einfluss von Kultur und Zivilisationstheorien
- Die Rolle von Missionaren als Informationsquellen
- Die Frage nach Objektivität und Perspektivübernahme
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung präsentiert die Forschungsfrage, ob magisches Denken ein Konstrukt oder eine Tatsache ist. Sie setzt den Kontext durch die Darstellung von August Comte's positivistischer Soziologie und deren Zielsetzung, gesellschaftliche Entwicklung durch naturgesetzliche Funktionsgleichungen zu erklären. Die Einleitung führt die zentralen Autoren der Arbeit, Lévy-Bruhl und Oesterdiekhoff, ein und kündigt die Auseinandersetzung mit Webers Entzauberungsbegriff an.
Lévy-Bruhl: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Werke Lévy-Bruhls "Die geistige Welt der Primitiven" und "Die Seele der Primitiven". Es analysiert seine Klassifizierung des magischen Denkens, die primär auf Berichten von Missionaren über Naturvölker basiert. Der Text kritisiert die eurozentrische Perspektive Lévy-Bruhls, der die "Primitiven" als weniger entwickelt darstellt und deren Denkweise als "magisch" im Gegensatz zum "rationalen" Denken des Westens kategorisiert. Die Arbeit hebt die problematischen methodischen Ansätze hervor und die implizite Rechtfertigung kolonialistischer Praktiken in Lévy-Bruhls Werk. Die Kapitel zeigt, wie die Berichte der Missionare selektiv verwendet werden, um eine vorgefasste These zu stützen, und wie die Perspektive der "Primitiven" selbst nicht adäquat berücksichtigt wird. Das Kapitel beleuchtet den Zusammenhang zwischen Evolutionstheorien und der Rechtfertigung des Kolonialismus und die implizite kulturelle Überlegenheit des Westens in Lévy-Bruhls Argumentation.
Schlüsselwörter
Magisches Denken, Soziologie, Auguste Comte, Lucien Lévy-Bruhl, Primitiven, Zivilisationstheorie, Kolonialismus, Ethnozentrismus, Methodologie, Wissenschaft, Rationalität, Kultur.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Magisches Denken - ein Konstrukt oder eine Tatsache?
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Frage, ob magisches Denken ein soziales Konstrukt oder eine objektive Tatsache ist. Sie analysiert kritisch frühe soziologische Konzepte des magischen Denkens, insbesondere die von Lucien Lévy-Bruhl, im Kontext von August Comtes positivistischer Soziologie und dessen Dreistadiengesetz.
Welche Autoren werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Werke von Lucien Lévy-Bruhl ("Die geistige Welt der Primitiven", "Die Seele der Primitiven") und bezieht sich auf August Comte und dessen positivistische Soziologie. Der Begriff der "Entzauberung" von Max Weber wird ebenfalls erwähnt.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind die kritische Analyse der Methoden der frühen Soziologie bei der Erforschung von "magischem Denken", der Einfluss von Kultur- und Zivilisationstheorien, die Rolle von Missionaren als Informationsquellen, die Frage nach Objektivität und Perspektivübernahme, sowie der Zusammenhang zwischen Evolutionstheorien, Kolonialismus und der impliziten kulturellen Überlegenheit des Westens.
Wie wird Lévy-Bruhls Werk kritisiert?
Die Arbeit kritisiert Lévy-Bruhls eurozentrische Perspektive und dessen Klassifizierung des Denkens von "Primitiven" als "magisch" im Gegensatz zum "rationalen" Denken des Westens. Es wird die selektive Verwendung von Missionsberichten und das Fehlen einer adäquaten Berücksichtigung der Perspektive der untersuchten Gruppen hervorgehoben. Die implizite Rechtfertigung kolonialistischer Praktiken in Lévy-Bruhls Werk wird ebenfalls thematisiert.
Welche methodischen Aspekte werden diskutiert?
Die Arbeit untersucht kritisch die methodischen Ansätze der frühen soziologischen Studien zum magischen Denken, insbesondere die Probleme der Objektivität, Perspektivübernahme und die potenziellen Verzerrungen durch die Nutzung von Berichten von Missionaren als Hauptquelle.
Was ist die Bedeutung von August Comte's Dreistadiengesetz im Kontext der Arbeit?
Comtes positivistische Soziologie und dessen Dreistadiengesetz bilden den Kontext, in dem die Konzepte des magischen Denkens betrachtet werden. Die Arbeit untersucht, wie diese Theorie die Interpretation und Einordnung von "magischem Denken" beeinflusst hat.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Magisches Denken, Soziologie, Auguste Comte, Lucien Lévy-Bruhl, Primitiven, Zivilisationstheorie, Kolonialismus, Ethnozentrismus, Methodologie, Wissenschaft, Rationalität, Kultur.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Ist magisches Denken ein Konstrukt oder eine Tatsache?
- Quote paper
- Sebastian Theodor Schmitz (Author), 2008, Magisches Denken - Konstrukt oder Tatsache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125627