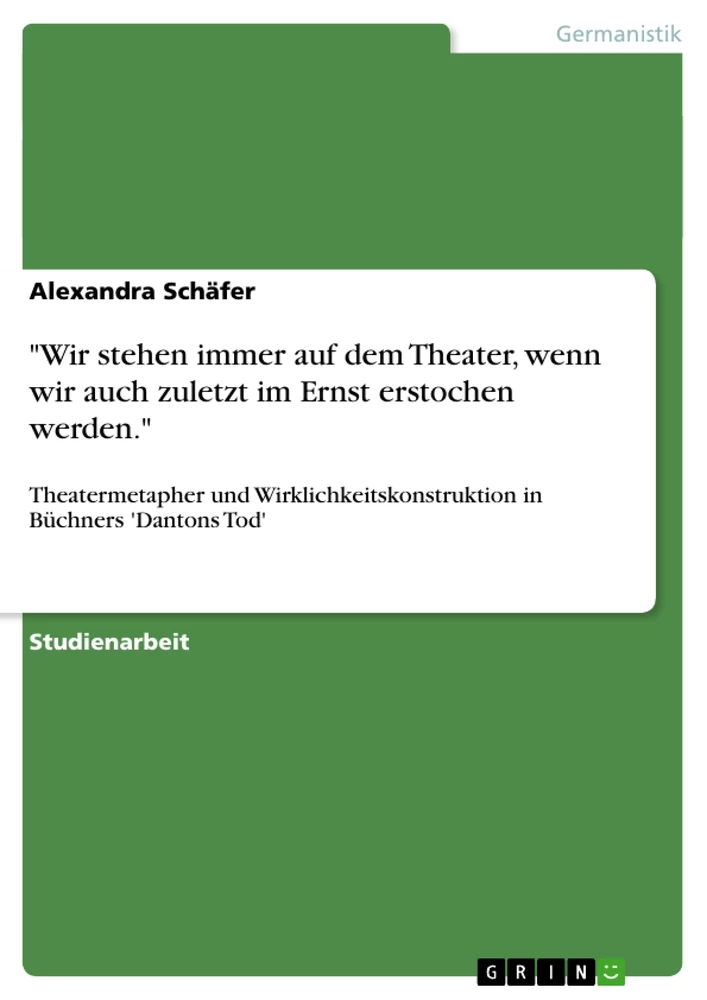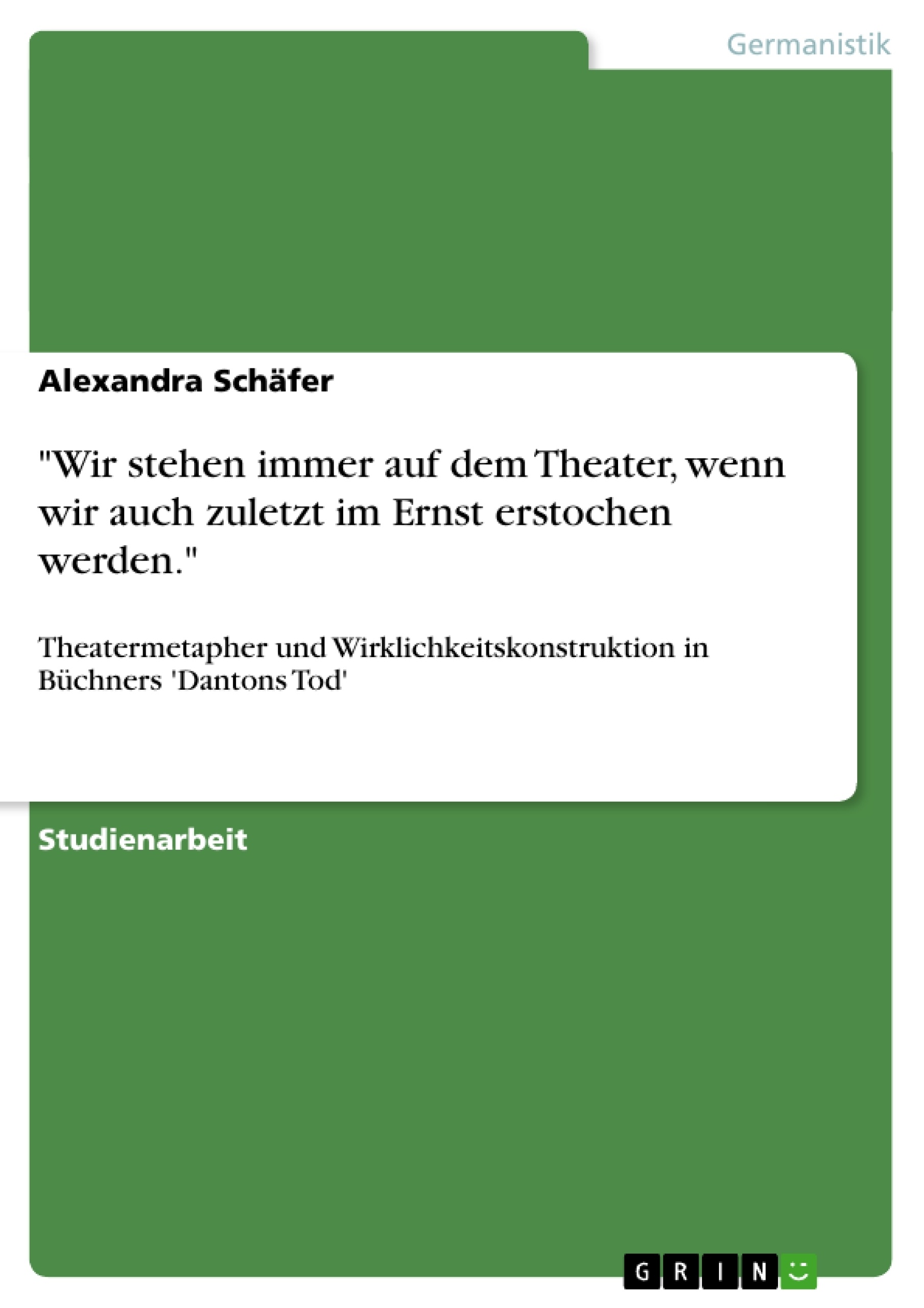[...] In dieser Arbeit soll unter Tragik das Tragische im Sinne einer Grenzsituation zwischen in ihrer
Gegensätzlichkeit paradoxen Polaritäten, die dialektisch aufeinander bezogen sind, verstanden
werden. Übergewicht oder Absolutheitsanspruch eines Prinzips würde das Paradoxe und damit
die Tragik innerhalb des sich vollziehenden Untergangs, der aus der Einheit der Gegensätze
entsteht, auflösen. Farce wird hier als eine bewusste, künstlerisch intendierte Abkehr von
lebensweltlicher Realität verstanden, um in einer subversiven Komik „Wirklichkeit“ zu entlarven. Umkehr von Ordnungsprinzipien und groteske Körperlichkeit sowie das von
parodistisch bis zynisch reichende, entlarvende Lachen sind charakteristisch.
Bei der schier endlosen Liste von Auseinandersetzungen mit Büchners „Dantons Tod“ ist die
Theatermetapher meist nur als Randaspekt betrachtet worden. Der Forschungsschwerpunkt lag
bisher weitestgehend auf der Entstehungsgeschichte und Quellenverarbeitung oder dem
Versuch der politischen Einordnung Büchners, oft in biografischer Lesung des Werkes, wobei
häufig tendenziös die politische Einstellungen des Autors stärker durchscheint als die
Büchners. Neben Solomons für diese Arbeit grundlegenden Artikel „Büchner`s Dantons Tod:
History as Theatre“ wurde, trotz seiner offensichtlichen sozialistischen Prägung, Michael
Voges intensiv herangezogen, da er sich in detaillierter Weise mit der Frage der
Theatermetapher in „Dantons Tod“ auseinandergesetzt hat. Weiterhin stützt sich diese Arbeit
auf Auseinandersetzungen mit Teilaspekten theatralischer Inszenierung wie der Rolle des
Antikenzitats oder der Frauenfiguren.
Inhaltsverzeichnis
- Geschichte im Theater zwischen Tragik und Farce: Eine Einleitung zu Büchners „Dantons Tod“
- „Wir stehen immer auf dem Theater, wenn wir auch zuletzt im Ernst erstochen werden“ (Danton, II, 1) – Theatermetapher und Wirklichkeitskonstruktion in Büchners „Dantons Tod“
- Er „parodiert[e] das erhabene Drama der Revolution“ (Robespierre, I, 3) – Büchners Dramenkonzept und das implizite Kunstprogramm
- „[…] spinne deine Perioden, worin jedes Komma ein Säbelhieb und jeder Punkt ein abgeschlagener Kopf ist“ (Barère, III, 6) – Die Körperlichkeit von Sprache, Tod und Sexualität
- „Köpfe statt Brot, Blut statt Wein“ (Erster Bürger, III, 10) – Das Politiktheater, Genuss versus Moral
- „Puppen sind wir von unbekannten Gewalten am Draht gezogen; nichts, nichts wir selbst“ (Danton, II, 5) – Dekonstruktion von Wirklichkeit, Selbstbestimmung und Verantwortung im fatalistischen Welttheater
- „Einander kennen? Wir müssten uns die Schädeldecken aufbrechen und die Gedanken einander aus den Hirnfasern zerren“ (Danton, I, 1) – Die Privatsphäre als Alternative zur Maskenhaftigkeit der Politik?
- Theatermetapher und Wirklichkeitskonstruktion in Büchners „Dantons Tod“: Ein Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung der Theatermetapher in Georg Büchners „Dantons Tod“ und deren Einfluss auf die Wirklichkeitskonstruktion im Drama. Es wird analysiert, wie Büchner die historischen Ereignisse der Französischen Revolution als theatralisches Geschehen darstellt und welche impliziten Aussagen über Kunst, Politik und menschliche Existenz er damit verbindet.
- Die Verwendung der Theatermetapher als zentrales Gestaltungsmittel
- Das Verhältnis von Wirklichkeit und Scheinwirklichkeit im Drama
- Die Darstellung von Politik als Theater und die Rolle der Rhetorik
- Die Beziehung zwischen Körperlichkeit, Sinnlichkeit und dem politischen Geschehen
- Die Frage nach Selbstbestimmung und Verantwortung im Kontext des historischen Fatalismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Fokus der Arbeit auf das Verhältnis von Wirklichkeit und Theater in Büchners „Dantons Tod“. Das Hauptkapitel analysiert Büchners Dramenkonzept, die inhaltliche Verwendung der Theatermetapher und deren Verhältnis zur Wirklichkeitskonstruktion. Dabei werden Aspekte wie Körperlichkeit, Fatalismus, Freiheit, Politik und Privatleben sowie Tragik und Farce beleuchtet. Es werden die Promenadenszene und das "Kunstgespräch" untersucht um unterschiedliche Wirklichkeitsauffassungen darzustellen.
Kapitel 2.2 fokussiert auf die Körperlichkeit von Sprache, Tod und Sinnlichkeit im Stück und untersucht Dantons Rolle als Antiheld. Kapitel 2.3 befasst sich mit dem Politiktheater und dem Gegensatz von Genuss und Moral. Hier wird analysiert, wie historische und literarische Zitate zur Konstruktion von Wirklichkeit eingesetzt werden und wie das Volk in dieser Darstellung erscheint.
Kapitel 2.4 betrachtet die Dekonstruktion von Wirklichkeit, Selbstbestimmung und Verantwortung im Kontext des fatalistischen Welttheaters. Dantons fatalistische Sichtweise und sein Verhältnis zur historischen Determiniertheit werden untersucht.
Kapitel 2.5 analysiert die Privatsphäre als mögliche Alternative zur Maskenhaftigkeit der Politik, indem es die Beziehungen der Frauenfiguren und die ihnen zugeschriebenen Rollen untersucht.
Schlüsselwörter
Georg Büchner, Dantons Tod, Theatermetapher, Wirklichkeitskonstruktion, Französische Revolution, Tragik, Farce, Politiktheater, Körperlichkeit, Sinnlichkeit, Fatalismus, Selbstbestimmung, Verantwortung, Privatsphäre.
- Quote paper
- M.A. Alexandra Schäfer (Author), 2007, "Wir stehen immer auf dem Theater, wenn wir auch zuletzt im Ernst erstochen werden." , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125507