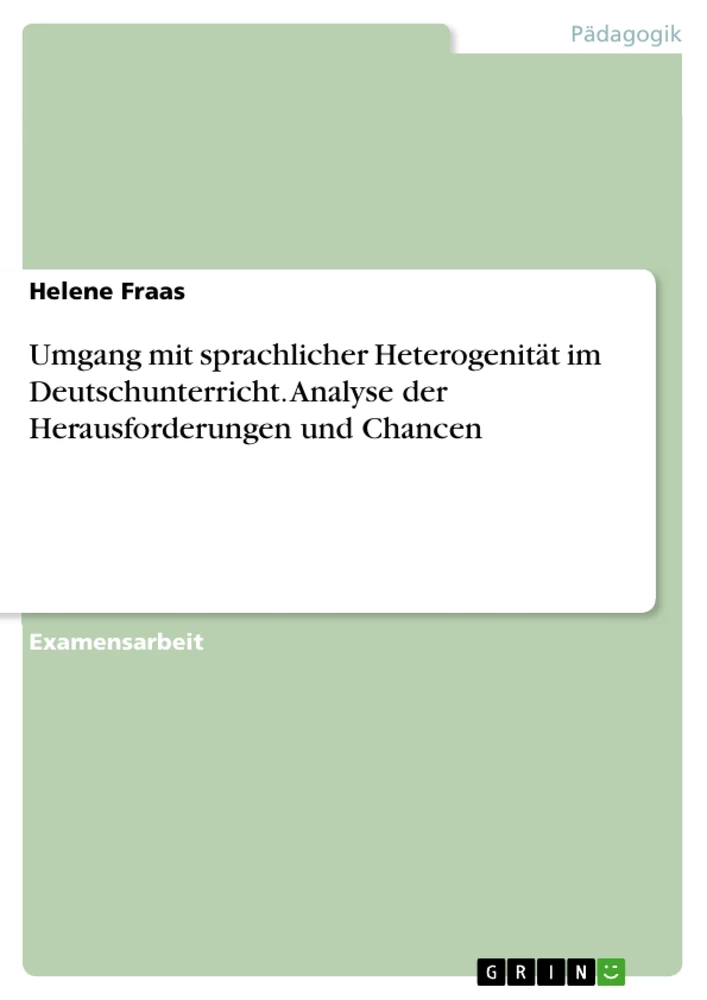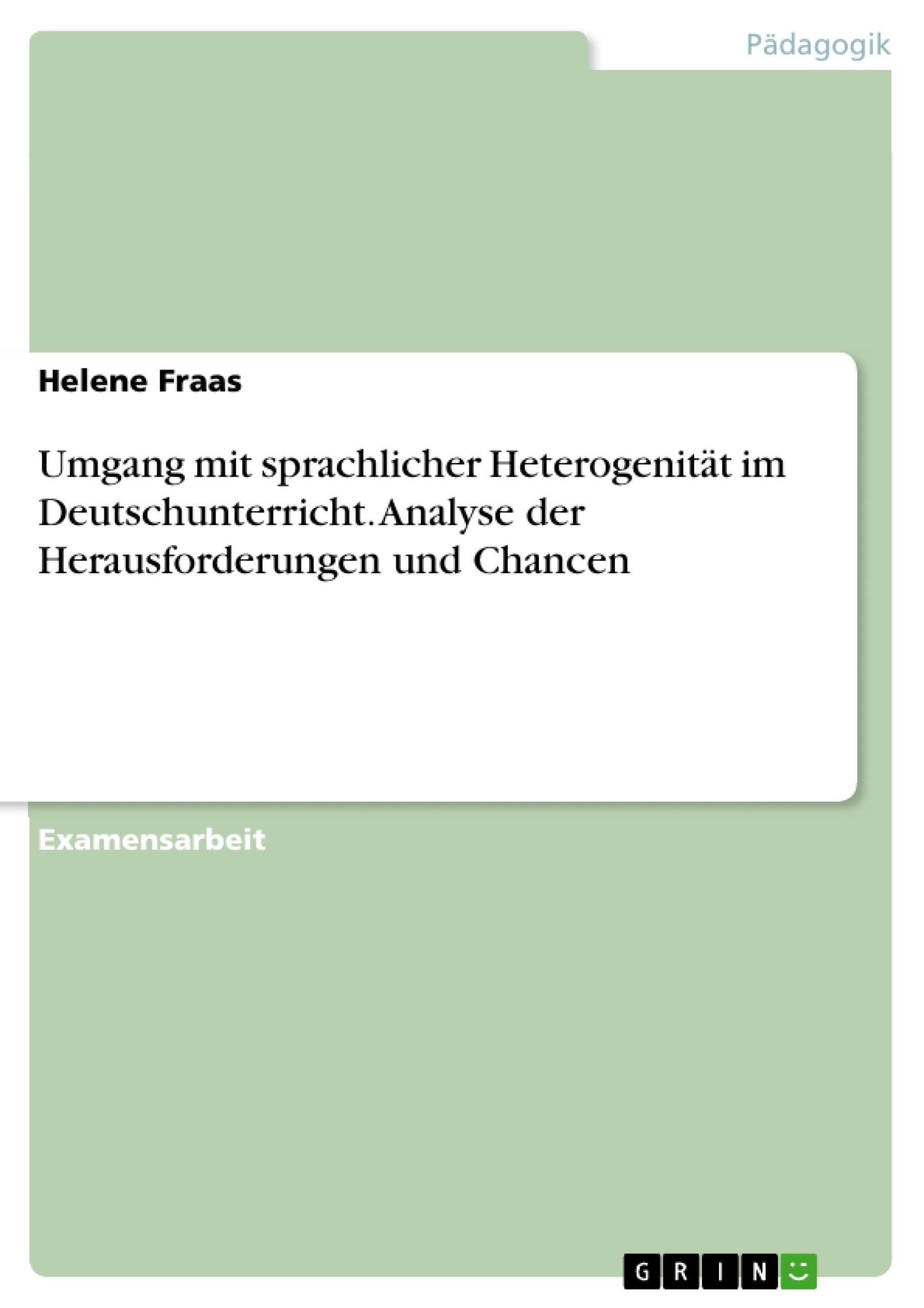In dieser Arbeit sollen einerseits die aktuelle Lehrer*innenbildung sowie der Aspekt des Selbstverständnisses von Sprachenvielfalt der Lehrenden eine tragende Rolle spielen, um die Herausforderungen der Sprachenvielfalt im Deutschunterricht (DU) näher zu betrachten. Andererseits soll der Blick auf die mit sprachlicher Heterogenität einhergehenden Chancen gerichtet werden, um diese mit den bestehenden Herausforderungen ins Verhältnis setzen zu können. Diesbezüglich sollte danach gefragt werden, ob "Heterogenität nur ein Baustein der Unterrichtsplanung oder zugleich ein Auftrag, sich gesellschaftlicher Ungleichbehandlung entgegenzustellen?"
Heterogenität, Mehrsprachigkeit, der Umgang mit sprachlicher und kultureller Vielfalt sowie die damit verbundene Differenzierung sind spätestens nach der ersten PISA-Studie und im Sinne unserer heutigen pluralen Gesellschaft in aller Munde. Doch trotz der verstärkten Diskussion zur Umsetzung der damit einhergehenden Differenzierung und individuellen Förderung haben entsprechende Konzepte längst keine flächendeckende Etablierung erfahren können. Aus aktueller Sichtweise nimmt das deutsche Bildungssystem somit wohl keine ausreichende Berücksichtigung der sozialen, kulturellen sowie sprachlichen Aspekte vor. Der Grund dafür liegt oftmals in Befürchtungen, aber auch in tief verankerten Haltungen, indem die Ausrichtung des Unterrichtsgeschehens am Individuum und die Wahrung der (sprachlichen) Heterogenität oftmals als problematisch behafteter Widerspruch betrachtet oder schlichtweg ignoriert wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- (Sprachliche) Heterogenität, Mehrsprachigkeit und deren Einfluss auf die schulische Bildungsinstanz
- Heterogenität als Grundbegriff einer inklusiven Schul- und Unterrichtsforschung
- Heterogenität – eine Begriffsbestimmung
- Heterogenitätsdimensionen
- Umgang mit Heterogenität als Schulentwicklungsaufgabe
- Zum Umgang mit Heterogenität im Deutschunterricht
- Individualisierung
- Differenzierung
- Inklusion
- Interkulturelle Bildungsarbeit als Querschnittsaufgabe
- Sprachliche Heterogenität und migrationsbedingte Mehrsprachigkeit
- Migrationshintergrund – eine Begriffsbestimmung
- Sprachlich-kulturelle Heterogenität
- Mehrsprachigkeit und deren Einfluss auf die schulische Bildung
- Dimensionen der Mehrsprachigkeit
- Die Rolle der Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht
- Schule und Sprachunterricht in der Migrationsgesellschaft
- Zur Bedeutung von Sprache als identitätsstiftendes Element
- Migrationsbedingter gesellschaftlicher und schulischer Wandel
- Auswirkungen auf das berufliche Handlungsfeld der Lehrer*innen
- Heterogenität als Grundbegriff einer inklusiven Schul- und Unterrichtsforschung
- Konzepte zur Unterrichtsgestaltung im Umgang mit sprachlicher Heterogenität im Deutschunterricht
- Konzepte zur Sichtbarmachung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt
- Sprachenportraits als Instrument für das eigene und fremde Spracherleben im Klassenzimmer
- ,,Deutsch ist vielseitig“ – Aus- und Fortbildungsmodule zur Sprachvariation im urbanen Raum
- Dialekttest - ein Quizspiel zu deutschen Dialekten
- Umgang mit kultureller Vielfalt und den Herkunftssprachen – der sprachintegrative Deutschunterricht nach Rothstein
- Bedingungen für den deutschunterrichtlichen Einbezug von Herkunftssprachen
- Einstellungen von Lehrkräften zum sprachintegrativen Deutschunterricht
- Die Didaktik der Sprachenvielfalt nach Oomen-Welke
- Language Awareness und sprachvergleichendes Arbeiten von der Sprachreflexion zur Sprachbewusstheit
- Vielsprachiger Deutschunterricht - ein Orientierungsrahmen für Lehrkräfte
- Sprachen entdecken, Sprachen vergleichen: Der Sprachenfächer - Materialien für einen interkulturellen Deutschunterricht
- Das Curriculum Mehrsprachigkeit nach Reich/Krumm
- Mehrheitssprachenunterricht zur Förderung des Plurilingualismus nach Boeckmann
- Konzepte zur Sichtbarmachung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt
- Der mehrsprachige Deutschunterricht im Spannungsfeld zwischen Herausforderungen und Chancen
- Grenzen und Herausforderungen sprachlicher Heterogenität für die Entwicklung schulischer Bildungsprozesse
- Der monolinguale Habitus von Lehrer*innen
- Die Komplexität der Konzeption und Nutzung geeigneter Unterrichtsmaterialien
- Qualifizierung für den Umgang mit sprachlicher Heterogenität im Rahmen der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften
- Sprachenvielfalt als Chance für den Deutschunterricht
- Grenzen und Herausforderungen sprachlicher Heterogenität für die Entwicklung schulischer Bildungsprozesse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Herausforderungen und Chancen, die mit sprachlicher Heterogenität im Deutschunterricht verbunden sind. Sie befasst sich mit dem Wandel von Bildungsprozessen in einer zunehmend multikulturellen Gesellschaft und der Bedeutung von Mehrsprachigkeit für den Lernerfolg.
- Heterogenität als Grundbegriff in der Schul- und Unterrichtsforschung
- Umgang mit sprachlicher und kultureller Vielfalt im Deutschunterricht
- Konzepte zur Unterrichtsgestaltung im Umgang mit sprachlicher Heterogenität
- Der mehrsprachige Deutschunterricht im Spannungsfeld zwischen Herausforderungen und Chancen
- Plädoyer für einen Paradigmenwechsel im Umgang mit sprachlicher Vielfalt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung thematisiert den Wandel hin zu einer inklusiven Schule, die Heterogenität als Chance begreift und die Verantwortung übernimmt, jedem gerecht zu werden. Das zweite Kapitel beleuchtet den Begriff der Heterogenität und deren Einfluss auf die schulische Bildung, insbesondere den Deutschunterricht. Es werden Konzepte wie Individualisierung, Differenzierung und Inklusion sowie der Einfluss migrationsbedingter Mehrsprachigkeit auf die schulische Bildung untersucht.
Das dritte Kapitel präsentiert verschiedene Konzepte zur Unterrichtsgestaltung im Umgang mit sprachlicher Heterogenität. Es werden Sprachenportraits, Aus- und Fortbildungsmodule, der sprachintegrative Deutschunterricht, die Didaktik der Sprachenvielfalt und das Curriculum Mehrsprachigkeit behandelt. Die verschiedenen Ansätze werden im Hinblick auf ihre Stärken und Schwächen analysiert.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den Grenzen und Herausforderungen der sprachlichen Heterogenität für die Entwicklung schulischer Bildungsprozesse. Der monolinguale Habitus von Lehrkräften, die Komplexität der Konzeption und Nutzung geeigneter Unterrichtsmaterialien sowie die Qualifizierung von Lehrkräften werden als zentrale Aspekte betrachtet. Zudem werden Chancen und Möglichkeiten, die sich aus der Sprachenvielfalt für den Deutschunterricht ergeben, aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die zentralen Themen der sprachlichen und kulturellen Heterogenität, der Mehrsprachigkeit, der Individualisierung, der Differenzierung und der Inklusion im Deutschunterricht. Sie untersucht die Auswirkungen von migrationsbedingter Mehrsprachigkeit auf die schulische Bildung und beleuchtet verschiedene Konzepte zur Unterrichtsgestaltung im Umgang mit sprachlicher Vielfalt. Wichtige Begriffe in diesem Zusammenhang sind: Spracherleben, Sprache und Identität, Sprachreflexion, Sprachenvergleich, Plurilingualismus, interkulturelle Bildungsarbeit, Lehrerausbildung und Schulentwicklung.
- Quote paper
- Helene Fraas (Author), 2022, Umgang mit sprachlicher Heterogenität im Deutschunterricht. Analyse der Herausforderungen und Chancen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1254957