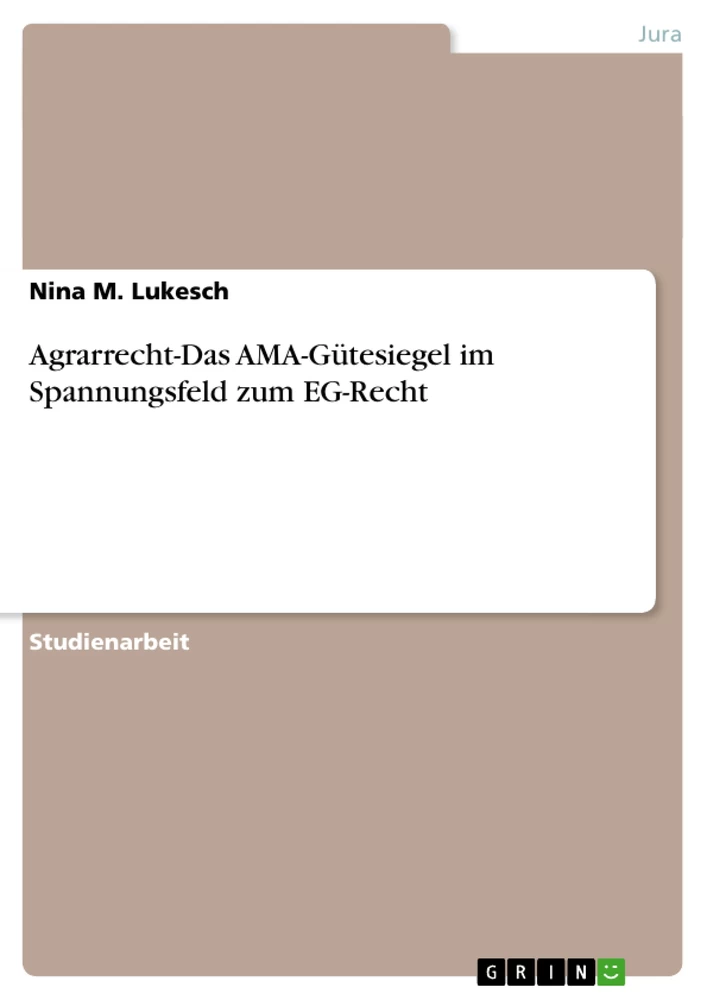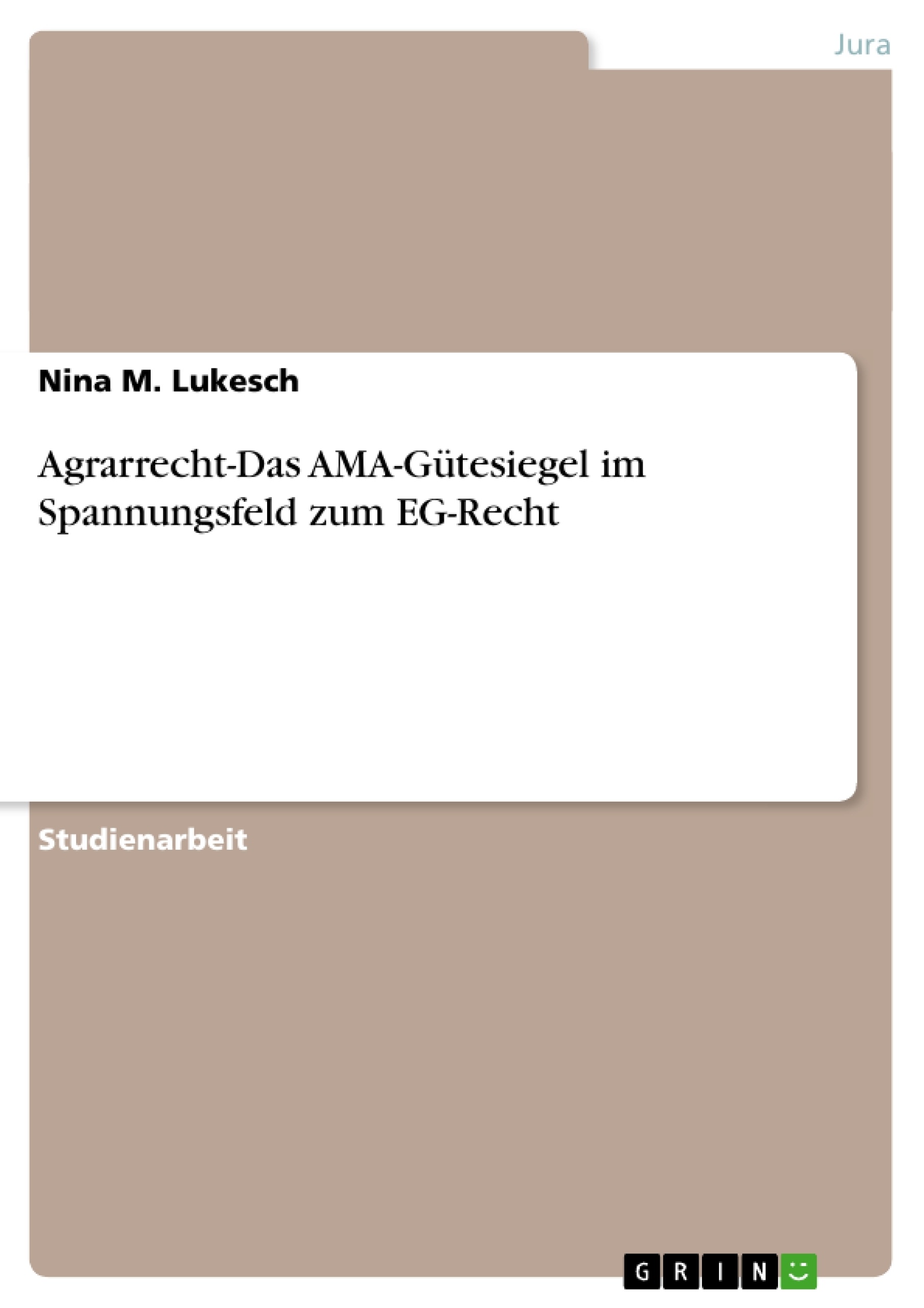Die Warenverkehrsfreiheit zählt zu den Kernbestandteilen primärrechtlicher
Regelungsbereiche (Art 3 Abs 1 lit a und Art 23ff EGV) und dient der Verwirklichung
des gemeinsamen Marktes. Gemäß Art 14 Abs 2 umfasst der Binnenmarkt einen
Raum ohne Binnengrenzen, indem der freie Verkehr von Waren, Personen,
Dienstleistungen und Kapital gewährleistet ist. Die Warenverkehrsfreiheit zählt zu
den Grundfreiheiten der EU, diese haben unmittelbare Geltung und begründen
unmittelbar Rechte und Pflichten der Unionsbürger. „Waren“ sind iSv Art 23 Abs 2
EGV sind alle körperlichen Gegenstände, welche zum Handel geeignet sind und
über einen Geldwert verfügen.
Dem freien Warenverkehr stehen nationale Regelungen vor der Zeit der Öffnung der
freien Märkte, sowie die Rücksicht auf nationale Interessensgruppen gegenüber. Der
klassische Fall der Behinderung des freien Warenverkehrs – dadurch wollen Staaten
ihre märkte schützen – sind Zölle, mengenmäßige Beschränkungen oder
Einfuhrverbote. Allesamt sind heute gemeinschaftsrechtswidrig.
Art 28 EGV beschreibt das Verbot mengenmäßiger Einfuhrbeschränkungen
(Kontingentierung) sowie Maßnahmen gleicher Wirkung. Im grundlegenden Urteil
Dassonville formuliert der EuGH erstmals eine Definition der Begriffe im Art 28 EGV.
Gemäß Dassonville Formel sind alle Handelsregelungen verboten welche dazu
geeignet sind den innergemeinschaftlichen freien Warenverkehr unmittelbar oder
mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behindern. Die bloße Möglichkeit eines
Handelshemmnisses ist ausreichend, ein konkreter Nachweis ist nicht erforderlich.
Hausarbeit
Das AMA-Gütesiegel im Spannungsfeld zum EG-Recht
Einleitung - Europarechtliche Rahmenbedingungen
Die Warenverkehrsfreiheit zählt zu den Kernbestandteilen primärrechtlicher Regelungsbereiche (Art 3 Abs 1 lit a und Art 23ff EGV) und dient der Verwirklichung des gemeinsamen Marktes. Gemäß Art 14 Abs 2 umfasst der Binnenmarkt einen Raum ohne Binnengrenzen, indem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gewährleistet ist. Die Warenverkehrsfreiheit zählt zu den Grundfreiheiten der EU, diese haben unmittelbare Geltung und begründen unmittelbar Rechte und Pflichten der Unionsbürger. „Waren“ sind iSv Art 23 Abs 2 EGV sind alle körperlichen Gegenstände, welche zum Handel geeignet sind und über einen Geldwert verfügen.
Dem freien Warenverkehr stehen nationale Regelungen vor der Zeit der Öffnung der freien Märkte, sowie die Rücksicht auf nationale Interessensgruppen gegenüber. Der klassische Fall der Behinderung des freien Warenverkehrs – dadurch wollen Staaten ihre märkte schützen – sind Zölle, mengenmäßige Beschränkungen oder Einfuhrverbote. Allesamt sind heute gemeinschaftsrechtswidrig.
Art 28 EGV beschreibt das Verbot mengenmäßiger Einfuhrbeschränkungen (Kontingentierung) sowie Maßnahmen gleicher Wirkung. Im grundlegenden Urteil Dassonville formuliert der EuGH erstmals eine Definition der Begriffe im Art 28 EGV.
Gemäß Dassonville Formel sind alle Handelsregelungen verboten welche dazu geeignet sind den innergemeinschaftlichen freien Warenverkehr unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behindern[1]. Die bloße Möglichkeit eines Handelshemmnisses ist ausreichend, ein konkreter Nachweis ist nicht erforderlich.
Die zunächst sehr weit reichende Dassonville-Formel wurde durch die Cassis -Rechtssprechung[2] wieder eingeschränkt. Mit dem Urteil aus 1979 hat sich der EuGH über die – ohne hin schon existierenden - vertragsrechtlichen Schranken des überschaubaren Art 30 EGV, die Möglichkeit geschaffen, warenverkehrsbeschränkende Maßnahmen zu rechtfertigen: Hemmnisse für den Binnenhandel (….) sind hinzunehmen, soweit diese Bestimmungen notwendig sind, um zwingenden Erfordernissen gerecht zu werden, insbesondere den Erfordernissen eine wirksamen steuerlichen Kontrolle, des Schutzes der öffentlichen Gesundheit, der Lauterkeit des Handelverkehrs und des Verbraucherschutzes (vgl. 2. Leitsatz der Entscheidung). Weiter konkretisiert wurde der Umfang der Warenverkehrsfreiheit durch die Keck -Rechtssprechung[3] welche davon ausgeht, dass Verkaufsmodalitäten nicht als Verstoß gegen Art 28 EGV zu sehen sind, solange sie unterschiedslos für alle Marktteilnehmer gelten und der Absatz der in- und ausländischen Erzeugnisse rechtlich wie tatsächlich in gleicher Weise geregelt ist. Mit dem Keck-Urteil wurde der Anwendungsbereich des Art.28 EGV massiv eingeschränkt.
Das AMA-Gütesiegel
Das AMA-Gütesiegel ist ein Herkunfts- und Gütezeichen der Republik Österreich und soll Auskunft über die Einhaltung bestimmte Qualitätsanforderungen, die inländische Herkunft der verwendeten Rohstoffe und garantieren umfassende Kontrollen. Die von der Tochtergesellschaft der AMA, der AMA Marketing GmbH, erarbeiteten Richtlinien, legen Bestimmungen für die Erteilung des Rechtes das AMA-Gütesiegel zu führen, fest[4]. Es werden Produkte gekennzeichnet, die für den menschlichen Verzehr bestimmt sind. Österreichische Unternehmen der Land- und Ernährungswirtschaft, welche die Bestimmungen der Richtlinien einhalten und einen Lizenzvertrag mit der AMA Marketing GmbH geschlossen haben, sind zur Führung des Siegels berechtigt. Die Unternehmen sind zur Entrichtung einer Abgabe (Agrarmarketingbeiträge[5]) verpflichtet. Diese Abgaben sind nicht als parafiskalische Abgaben iSd Art 90 EGV zu sehen und sind demnach nicht diskriminierend.[6]
Das Bundesgesetz über die Errichtung der Marktordnungsstelle „Agrarmarkt Austria“ ist seit 1.7.1992 in Kraft und wurde zuletzt durch BGBl. Nr. 55/2007 geändert. Art 1 des Bundesgesetzes hat seit 11.8.2001 Verfassungsrang, mit der Vollziehung ist die Bundesregierung betraut.
[...]
[1] EuGH 11.7.1974 Rs 8/74 Dassonville, Slg. 1974, 837, vor allem Randnr. 5.
[2] EuGH 20.2.1979 Rs 120/78 REWE Zentral AG, Slg. 1979, I-649.
[3] EuGH 24.11.1993 Rs C-267/91 und C-268/91 Bernhard Keck und Daniel Mithouard, Slg. 1993, I-6097.
[4] Zur Rechtsstellung der AMA kann weiters auch auf 24. Jänner 2005, VwGH Zl. 2003/17/0023 verwiesen werden.
[5] Siehe auch Norbert Wimmer/Thomas Müller, Wirtschaftsrecht, Kapitel Beihilfen- und Förderungsrecht, Wien 2007, hier: Seite 711.
[6] Parafiskalische Abgaben werden für im Inland produzierte als auch für importiere Produkte gezahlt. Der Ertrag kommt allerdings nur den inländischen Erzeugnissen zu Gute. Folglich widersprechen gem. Art. 90 EGV parafiskalische Abgaben dem Gemeinschaftsrecht.
Häufig gestellte Fragen zu: Das AMA-Gütesiegel im Spannungsfeld zum EG-Recht
Was ist die Warenverkehrsfreiheit und warum ist sie wichtig?
Die Warenverkehrsfreiheit ist ein Kernbestandteil des EU-Rechts (Art. 3 Abs. 1 lit. a und Art. 23ff EGV) und dient der Verwirklichung des gemeinsamen Marktes. Sie gewährleistet den freien Verkehr von Waren innerhalb der EU ohne Binnengrenzen.
Was sind "Waren" im Sinne des EU-Rechts?
Gemäß Art. 23 Abs. 2 EGV sind "Waren" alle körperlichen Gegenstände, die zum Handel geeignet sind und einen Geldwert haben.
Was sind typische Hindernisse für den freien Warenverkehr?
Typische Hindernisse sind Zölle, mengenmäßige Beschränkungen (Kontingentierung) und Einfuhrverbote, die darauf abzielen, nationale Märkte zu schützen. Diese sind heute gemeinschaftsrechtswidrig.
Was besagt Art. 28 EGV?
Art. 28 EGV verbietet mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen und Maßnahmen gleicher Wirkung.
Was ist die Dassonville-Formel?
Die Dassonville-Formel besagt, dass alle Handelsregelungen verboten sind, die den innergemeinschaftlichen freien Warenverkehr unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell behindern können.
Wie wurde die Dassonville-Formel durch die Cassis-Rechtsprechung eingeschränkt?
Die Cassis-Rechtsprechung ermöglicht es, warenverkehrsbeschränkende Maßnahmen zu rechtfertigen, wenn sie notwendig sind, um zwingenden Erfordernissen gerecht zu werden, wie z.B. dem Schutz der öffentlichen Gesundheit, der Lauterkeit des Handelsverkehrs und des Verbraucherschutzes.
Was besagt die Keck-Rechtsprechung?
Die Keck-Rechtsprechung besagt, dass Verkaufsmodalitäten nicht als Verstoß gegen Art. 28 EGV zu sehen sind, solange sie unterschiedslos für alle Marktteilnehmer gelten und der Absatz der in- und ausländischen Erzeugnisse rechtlich wie tatsächlich in gleicher Weise geregelt ist.
Was ist das AMA-Gütesiegel?
Das AMA-Gütesiegel ist ein Herkunfts- und Gütezeichen der Republik Österreich, das Auskunft über die Einhaltung bestimmter Qualitätsanforderungen und die inländische Herkunft der verwendeten Rohstoffe geben soll. Es garantiert umfassende Kontrollen.
Wer darf das AMA-Gütesiegel führen?
Österreichische Unternehmen der Land- und Ernährungswirtschaft, die die Bestimmungen der Richtlinien der AMA Marketing GmbH einhalten und einen Lizenzvertrag abgeschlossen haben, sind zur Führung des Siegels berechtigt.
Sind die Agrarmarketingbeiträge, die zur Führung des AMA-Gütesiegels entrichtet werden müssen, diskriminierend?
Nein, diese Abgaben werden nicht als parafiskalische Abgaben iSd Art. 90 EGV gesehen und sind demnach nicht diskriminierend.
Welchen Status hat das Bundesgesetz über die Errichtung der Agrarmarkt Austria?
Art. 1 des Bundesgesetzes über die Errichtung der Marktordnungsstelle „Agrarmarkt Austria“ hat seit 11.8.2001 Verfassungsrang.
- Quote paper
- Mag. Nina M. Lukesch (Author), 2008, Agrarrecht-Das AMA-Gütesiegel im Spannungsfeld zum EG-Recht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125470