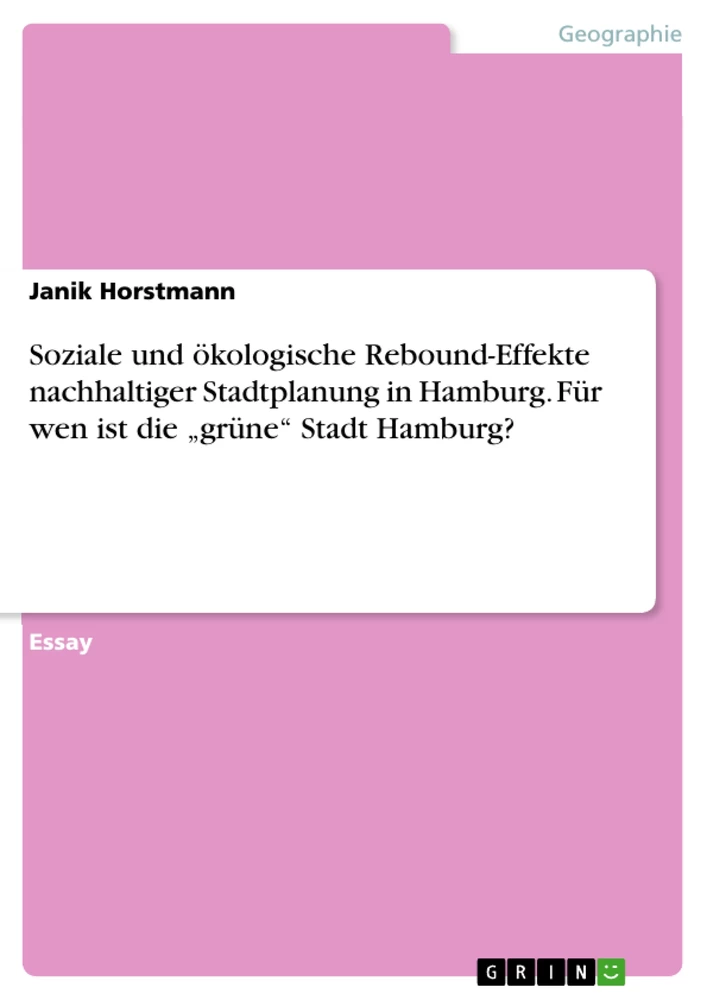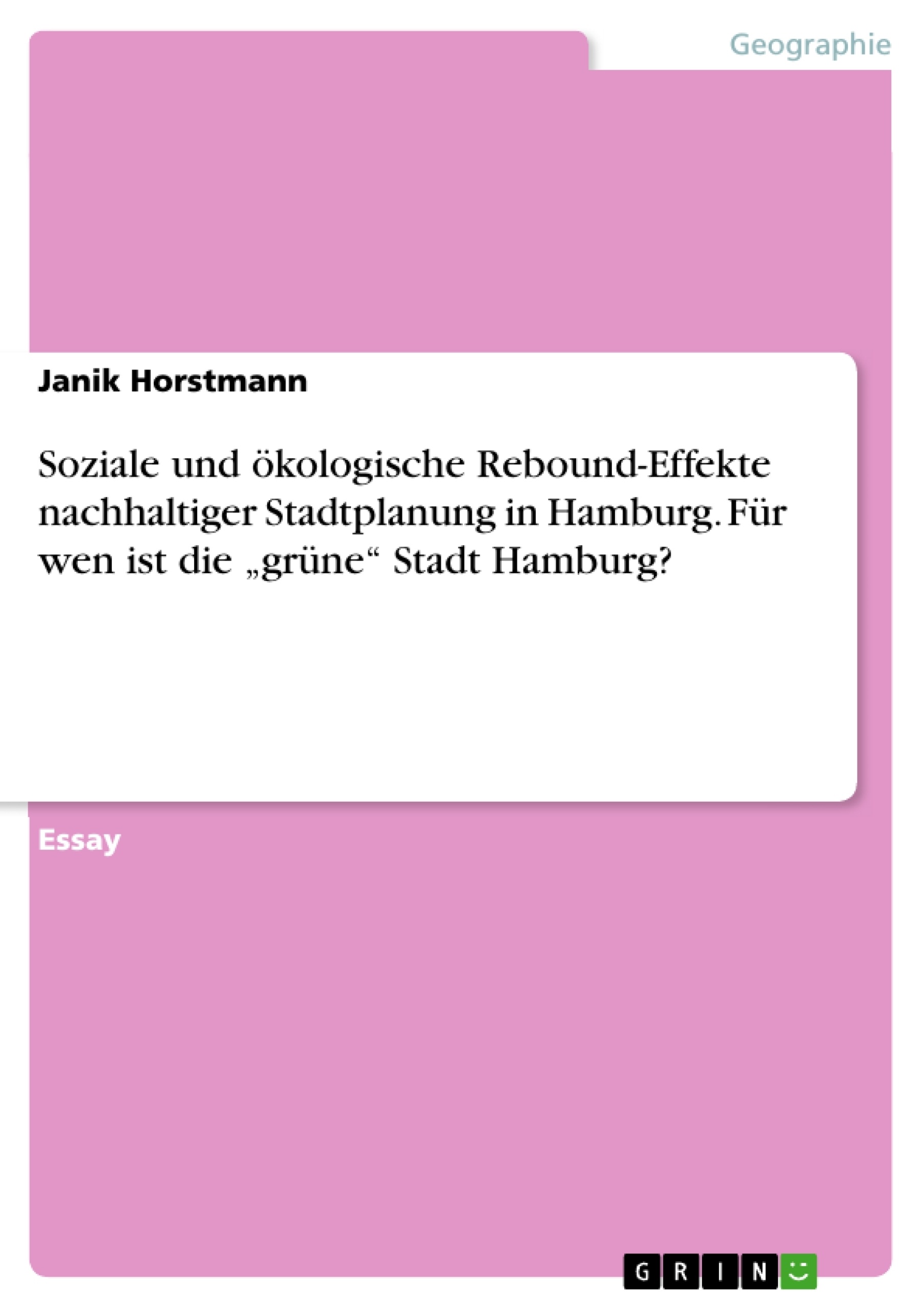Mit Bezug auf die „Urban Political Ecology“ und Studien zu „Green Gentrification“ und „Urban Sustainability“ wirft diese Arbeit einen kritischen Blick auf die Hansestadt Hamburg, die Umwelthauptstadt Europas 2011, die Grüne Stadt des Jahres 2021 und Deutschlands selbsternannter grünster Stadt, gemessen an der Einwohner:innen-Zahl. Die Analyse von Rebound-Effekten im Zusammenhang mit Umweltungleichheiten bei der städtischen Begrünung steht dabei im Mittelpunkt dieser Arbeit. Zunächst werde ich das „Green-Self-Branding“, im Kontext von Post-Politisierung und Neoliberalisierung von Nachhaltigkeit, im Rahmen der Stadt Hamburg, einordnen. Anschließend werde ich Stadtplanungsprojekte in Hamburg bezogen auf die sozialräumlichen Dynamiken und Auswirkungen möglicher oder bereits bestehender „grüner“ Gentrifizierung hin untersuchen. Ich hoffe so einen Ausgangspunkt, für eine umfassendere Analyse der „grünen“ Stadt Hamburg mit dem Fokus auf die Stadtteile im Süden und Osten des Bezirks Hamburg-Mitte erarbeiten zu können. Entlang der aktuellen wissenschaftlichen Debatten zu „Green Gentrification“ sollen Mechanismen, die so auch in Hamburg wirken, identifiziert werden. Im abschließenden Teil der vorliegenden Arbeit sollen die Grenzen meiner Betrachtung dargelegt, die verfolgten Ansätze in einen größeren Kontext eingeordnet und weitere mögliche Schwerpunkte für die Analyse von Rebound-Effekten im Zusammenhang mit sozialen und ökologischen Ungleichheiten besprochen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. „Urban Political Ecology“ (UPE)
- 3. Nachhaltige Stadtplanung und Begrünungsstrategien in Hamburg
- 3.1 Betreibt Hamburg „Green-Self-Branding“ als Standortmarketing?
- 3.2 Soziale und Ökologische Rebound-Effekte in Hammerbrook?
- 4. Konklusion: Führt Urban Groening in Hamburg zu mehr sozialen und ökologischen Ungleichheiten?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht kritisch die Auswirkungen nachhaltiger Stadtplanung, insbesondere Begrünungsstrategien, auf soziale und ökologische Gerechtigkeit in Hamburg. Sie hinterfragt das "Green-Self-Branding" der Stadt und analysiert mögliche Rebound-Effekte im Kontext von Gentrifizierung. Der Fokus liegt auf der Frage, ob "grüne" Stadtentwicklung zu mehr Ungleichheiten führt.
- Kritische Analyse des "Green-Self-Branding" Hamburgs
- Untersuchung sozialer und ökologischer Rebound-Effekte von Begrünungsprojekten
- Analyse der sozialen Auswirkungen nachhaltiger Stadtplanung
- Beziehung zwischen Urban Political Ecology (UPE) und "grüner" Gentrifizierung in Hamburg
- Bewertung der Gerechtigkeit von Begrünungsmaßnahmen in Hamburg
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der zunehmenden Bedeutung von Natur in urbanen Räumen ein und stellt die These "Green is (always) Good" kritisch in Frage. Sie betont den Mangel an Analysen zu sozialen Auswirkungen von Begrünungsprojekten und kündigt eine kritische Betrachtung Hamburgs als "grüne" Stadt an. Der Fokus liegt auf der Analyse von Rebound-Effekten im Zusammenhang mit Umweltungleichheiten, wobei das "Green-Self-Branding" Hamburgs im Kontext von Post-Politisierung und Neoliberalisierung von Nachhaltigkeit eingeordnet wird. Die Arbeit untersucht Stadtplanungsprojekte in Hinblick auf sozialräumliche Dynamiken und "grüne" Gentrifizierung, mit dem Ziel, einen Ausgangspunkt für eine umfassendere Analyse zu schaffen.
2. „Urban Political Ecology“ (UPE): Dieses Kapitel erläutert den theoretischen Rahmen der Urban Political Ecology (UPE). Es beschreibt die Entwicklung der UPE als Reaktion auf das traditionelle Verständnis von Stadt und Natur als dichotome Einheiten. Die UPE betont den metabolischen und sozio-natürlichen Charakter der Stadt, wobei soziale und natürliche Verbindungen und Netzwerke von Stoffwechselprozessen den urbanen Raum prägen. Das Kapitel diskutiert die Einbeziehung der politischen Ökonomie und die Bedeutung von Machtverhältnissen in der Gestaltung des urbanen Raumes. Es wird der Ansatz von Erik Swyngedouw zur Integration von politischer Ökonomie, politischer Ökologie und Science and Technology Studies (STS) beleuchtet und der Begriff "Sozionatur" eingeführt. Der "urbane Metabolismus" wird als Konzept zur Beschreibung ungleicher Machtverhältnisse im urbanen Raum erklärt, wobei die Arbeiten von David Harvey und Neil Smith hervorgehoben werden.
Schlüsselwörter
Grüne Stadt, nachhaltige Stadtplanung, Urban Political Ecology (UPE), Green Gentrification, Rebound-Effekte, soziale und ökologische Ungleichheiten, Hamburg, Stadtmarketing, Stadtbegrünung, Umwelthausptstadt, sozio-ökologischer Metabolismus, Post-Politisierung, Neoliberalisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Auswirkungen nachhaltiger Stadtplanung auf soziale und ökologische Gerechtigkeit in Hamburg
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert kritisch die Auswirkungen nachhaltiger Stadtplanung, insbesondere von Begrünungsstrategien, auf soziale und ökologische Gerechtigkeit in Hamburg. Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage, ob "grüne" Stadtentwicklung zu mehr Ungleichheiten führt und wie sich das "Green-Self-Branding" Hamburgs auf diese Entwicklung auswirkt.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit untersucht das "Green-Self-Branding" Hamburgs, analysiert soziale und ökologische Rebound-Effekte von Begrünungsprojekten, betrachtet die sozialen Auswirkungen nachhaltiger Stadtplanung, untersucht die Beziehung zwischen Urban Political Ecology (UPE) und "grüner" Gentrifizierung in Hamburg und bewertet die Gerechtigkeit von Begrünungsmaßnahmen.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf dem theoretischen Rahmen der Urban Political Ecology (UPE). Dieser Ansatz betont den metabolischen und sozio-natürlichen Charakter der Stadt und die Bedeutung von Machtverhältnissen in der Gestaltung des urbanen Raumes. Konzepte wie "urbane Metabolismus", "Sozionatur" und die Arbeiten von David Harvey, Neil Smith und Erik Swyngedouw werden diskutiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Urban Political Ecology (UPE), ein Kapitel zu nachhaltiger Stadtplanung und Begrünungsstrategien in Hamburg (inkl. der Analyse von "Green-Self-Branding" und Rebound-Effekten) und eine Schlussfolgerung, die die Frage nach erhöhten sozialen und ökologischen Ungleichheiten durch Urban Greening in Hamburg beantwortet.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Grüne Stadt, nachhaltige Stadtplanung, Urban Political Ecology (UPE), Green Gentrification, Rebound-Effekte, soziale und ökologische Ungleichheiten, Hamburg, Stadtmarketing, Stadtbegrünung, Umwelthausptstadt, sozio-ökologischer Metabolismus, Post-Politisierung und Neoliberalisierung.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die Arbeit hinterfragt kritisch die These "Green is (always) Good" und untersucht, ob und inwiefern "grüne" Stadtentwicklung in Hamburg zu sozialen und ökologischen Ungleichheiten beiträgt, insbesondere im Kontext von Gentrifizierung und "Green-Self-Branding".
Welche konkreten Beispiele aus Hamburg werden untersucht?
Die Arbeit analysiert Begrünungsstrategien und Stadtplanungsprojekte in Hamburg, um die Auswirkungen auf soziale und ökologische Gerechtigkeit zu untersuchen. Ein genauerer Fokus liegt auf dem Stadtteil Hammerbrook, um Rebound-Effekte zu analysieren.
Was ist der Mehrwert dieser Arbeit?
Die Arbeit liefert eine kritische Analyse der sozialen Auswirkungen von nachhaltiger Stadtplanung in Hamburg und trägt zu einem umfassenderen Verständnis der komplexen Zusammenhänge zwischen "grüner" Stadtentwicklung, Gentrifizierung und sozialräumlicher Gerechtigkeit bei.
- Quote paper
- Janik Horstmann (Author), 2021, Soziale und ökologische Rebound-Effekte nachhaltiger Stadtplanung in Hamburg. Für wen ist die „grüne“ Stadt Hamburg?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1254367