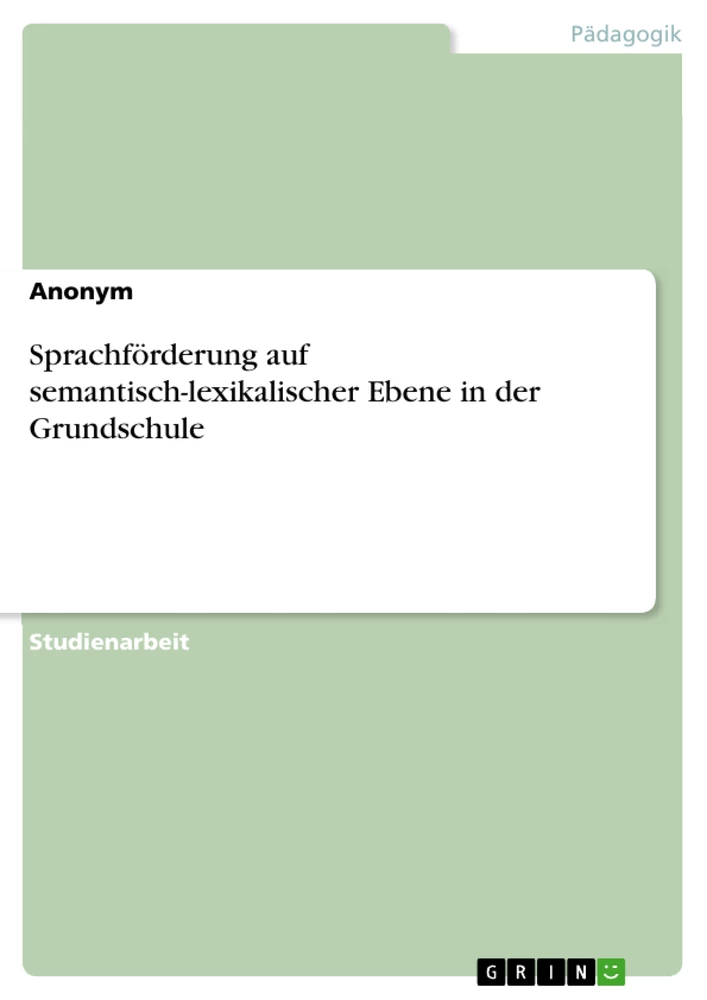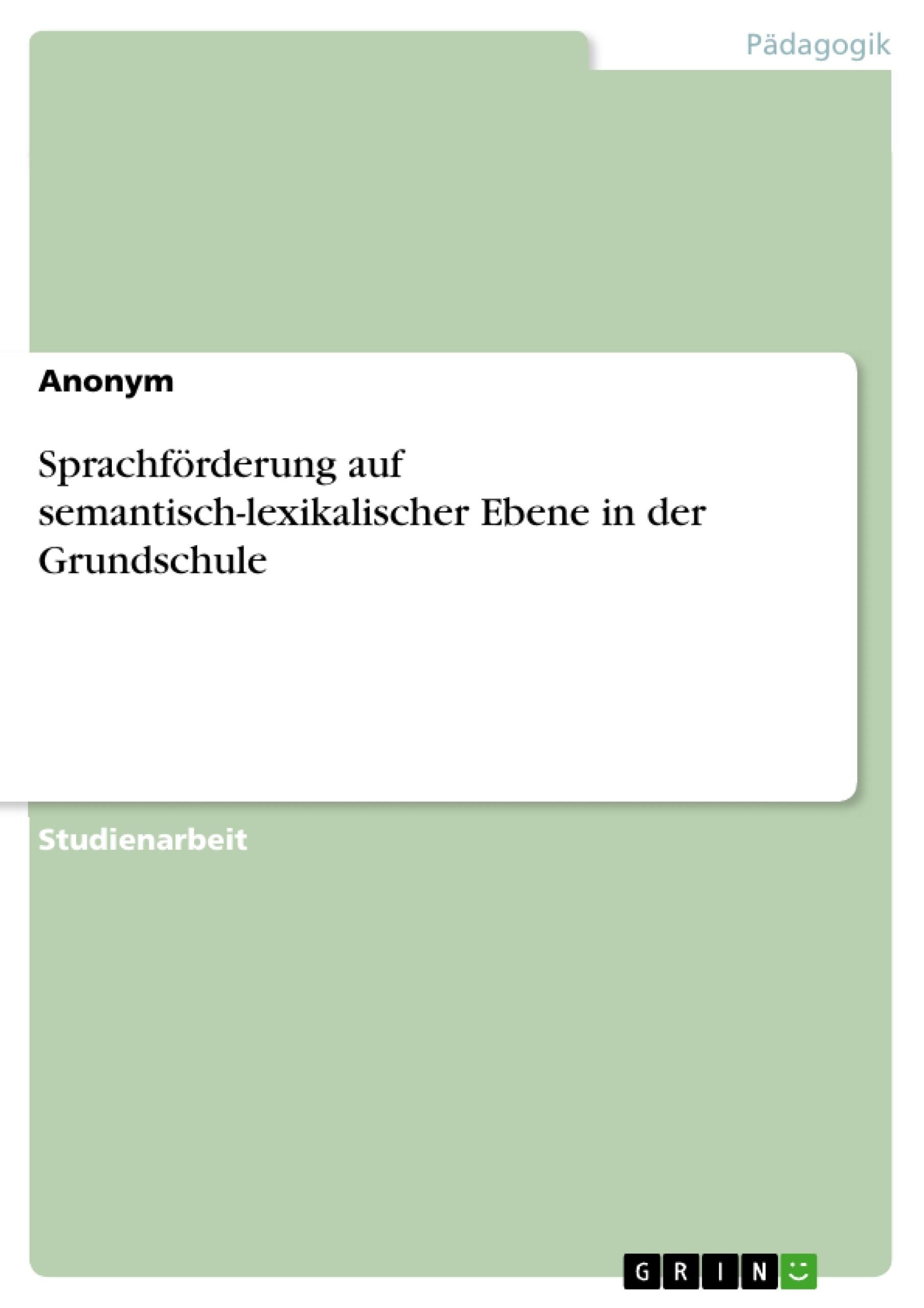In dieser Arbeit wird anhand von aktuellen Studien in Erfahrung gebracht, wie notwendig eine Förderung der Sprache in der Grundschule ist. Dabei liegt der Fokus auf dem semantisch- lexikalischen Bereich, um herauszufinden, wie diese Ebene im Unterricht gefördert werden kann. Dazu werden zudem Praxisbeispiele einbezogen. Anhand geeigneter Fachliteratur wird ein sprachheilpädagogischer Unterricht dargestellt, welcher das Ziel verfolgt, den Wortschatz aufzubauen und zu fördern.
In Deutschland sind etwa 54000 Kinder von einer nicht altersgemäßen Sprachentwicklung betroffen, was zur Folge hat, dass sie in der Schule und im sozialen Alltag nur schwer und teilweise gar keinen Anschluss finden können, oder im schlimmsten Fall an psychischen Störungen leiden. Aus diesem Grund ist es wichtig, Kinder mit einer solchen Störung so zu fördern, damit sie ein unbeschwertes und normales Leben führen können. Die Sprachentwicklung eines Kindes vollzieht sich auf verschiedenen Ebenen, die miteinander eng verknüpft und abhängig voneinander sind. Die Fähigkeiten, miteinander zu kommunizieren, grammatisch richtig zu sprechen und Zusammenhänge zu verstehen, basiert hauptsächlich auf einem fundierten mentalen Lexikon. Aus diesem Grund beschäftige ich mich in dieser Arbeit ausschließlich mit der semantisch- lexikalischen Ebene.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Aktuelle Studien
- 3. Prävention
- 3.1 Das grundlegende Unterrichtsprinzip: Wortschatzarbeit
- 3.2 Die Lehrersprache
- 4. Intervention
- 4.1 Vorbereitung einer sprachtherapeutischen Unterrichtsstunde
- 4.2 Elaborationstraining
- 4.2.1 Lemmaebene
- 4.2.2 Lexemebene
- 4.3 Wortabruf
- 4.4 Rituale
- 5. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Sprachförderung auf semantisch-lexikalischer Ebene in der Grundschule. Ziel ist es, anhand aktueller Studien den Bedarf an Sprachförderung aufzuzeigen und pädagogische Methoden zur Förderung des Wortschatzes und der semantischen Fähigkeiten im Unterricht zu präsentieren. Der Fokus liegt auf interventionsorientierten Maßnahmen und deren praktischen Anwendung.
- Notwendigkeit von Sprachförderung in der Grundschule
- Einfluss semantisch-lexikalischer Fähigkeiten auf den Schulerfolg
- Methoden zur Wortschatzarbeit im Unterricht
- Interventionelle Strategien zur Sprachförderung
- Praxisbeispiele für die Umsetzung im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung von Sprache für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und stellt die Problematik von Sprachentwicklungsstörungen bei Grundschulkindern dar. Sie unterstreicht die Notwendigkeit von Sprachförderung, insbesondere auf semantisch-lexikalischer Ebene, und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Arbeit konzentriert sich auf Fördermaßnahmen und Methoden, wobei die Notwendigkeit einer vorherigen Diagnostik angedeutet wird. Das Zitat von Wilhelm von Humboldt verdeutlicht die zentrale Rolle der Sprache für die Weltaneignung.
2. Aktuelle Studien: Dieses Kapitel präsentiert Ergebnisse zweier aktueller Studien zur Sprachentwicklung bei Grundschulkindern. Die Barmer-Studie zeigt einen besorgniserregenden Anstieg von Sprachentwicklungsstörungen in Thüringen und Sachsen. Die Kisses-Probula-Studie untersucht den Einfluss von Sprachentwicklungsstörungen auf den Erwerb von Lese- und Schreibkompetenzen sowie auf das soziale und emotionale Wohlbefinden der Kinder. Die Ergebnisse beider Studien unterstreichen die Notwendigkeit frühzeitiger und intensiver Sprachförderung.
3. Prävention: Dieses Kapitel widmet sich präventiven Maßnahmen zur Sprachförderung. Es hebt die Bedeutung der Wortschatzarbeit als grundlegendes Unterrichtsprinzip hervor. Der Einfluss der Lehrersprache auf die Sprachentwicklung der Schüler wird diskutiert. Es wird ein Überblick über Strategien zur vorbeugenden Stärkung der semantisch-lexikalischen Fähigkeiten gegeben.
4. Intervention: Das Kapitel konzentriert sich auf interventionelle Methoden zur Sprachförderung bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen. Es werden konkrete Strategien und Unterrichtsideen vorgestellt, die auf die semantisch-lexikalische Ebene abzielen. Die Kapitel 4.2 (Elaborationstraining), 4.3 (Wortabruf) und 4.4 (Rituale) beschreiben verschiedene Techniken zur Verbesserung von Wortschatz und Sprachverständnis. Die Vorbereitung einer sprachtherapeutischen Unterrichtsstunde wird als wichtiger Aspekt der Intervention hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Sprachförderung, semantisch-lexikalische Ebene, Grundschule, Sprachentwicklungsstörung, Wortschatzarbeit, Intervention, Prävention, Elaborationstraining, Wortabruf, Lehrersprache, Kisses-Probula Studie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Sprachförderung auf semantisch-lexikalischer Ebene in der Grundschule
Was ist der Hauptfokus dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Sprachförderung auf semantisch-lexikalischer Ebene in der Grundschule. Sie zeigt anhand aktueller Studien den Bedarf an Sprachförderung auf und präsentiert pädagogische Methoden zur Förderung des Wortschatzes und der semantischen Fähigkeiten im Unterricht. Der Fokus liegt auf interventionsorientierten Maßnahmen und deren praktischen Anwendung.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Notwendigkeit von Sprachförderung in der Grundschule, den Einfluss semantisch-lexikalischer Fähigkeiten auf den Schulerfolg, Methoden zur Wortschatzarbeit im Unterricht, interventionelle Strategien zur Sprachförderung und Praxisbeispiele für die Umsetzung im Unterricht. Sie umfasst präventive Maßnahmen (Wortschatzarbeit, Lehrersprache) und interventionelle Strategien (Elaborationstraining, Wortabruf, Rituale).
Welche Studien werden in der Arbeit zitiert?
Die Arbeit bezieht sich auf die Barmer-Studie (zeigt einen besorgniserregenden Anstieg von Sprachentwicklungsstörungen) und die Kisses-Probula-Studie (untersucht den Einfluss von Sprachentwicklungsstörungen auf den Erwerb von Lese- und Schreibkompetenzen sowie auf das soziale und emotionale Wohlbefinden der Kinder).
Welche präventiven Maßnahmen werden vorgestellt?
Die Arbeit betont die Bedeutung der Wortschatzarbeit als grundlegendes Unterrichtsprinzip und diskutiert den Einfluss der Lehrersprache auf die Sprachentwicklung der Schüler. Sie gibt einen Überblick über Strategien zur vorbeugenden Stärkung der semantisch-lexikalischen Fähigkeiten.
Welche interventionellen Strategien werden beschrieben?
Im Bereich der Intervention werden konkrete Strategien und Unterrichtsideen vorgestellt, die auf die semantisch-lexikalische Ebene abzielen. Es werden Elaborationstraining (auf Lemma- und Lexemebene), Wortabruf und Rituale als Techniken zur Verbesserung von Wortschatz und Sprachverständnis beschrieben. Die Vorbereitung einer sprachtherapeutischen Unterrichtsstunde wird ebenfalls thematisiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sprachförderung, semantisch-lexikalische Ebene, Grundschule, Sprachentwicklungsstörung, Wortschatzarbeit, Intervention, Prävention, Elaborationstraining, Wortabruf, Lehrersprache, Kisses-Probula Studie.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Aktuelle Studien, Prävention, Intervention und Resümee. Jedes Kapitel befasst sich mit einem spezifischen Aspekt der Sprachförderung, beginnend mit der Begründung der Notwendigkeit bis hin zu konkreten Methoden und Praxisbeispielen.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit unterstreicht die Notwendigkeit frühzeitiger und intensiver Sprachförderung in der Grundschule, insbesondere auf semantisch-lexikalischer Ebene, und bietet einen Überblick über präventive und interventionelle Maßnahmen mit praktischen Anwendungshinweisen. Die Bedeutung einer fundierten Diagnostik wird angedeutet.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Sprachförderung auf semantisch-lexikalischer Ebene in der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1254366