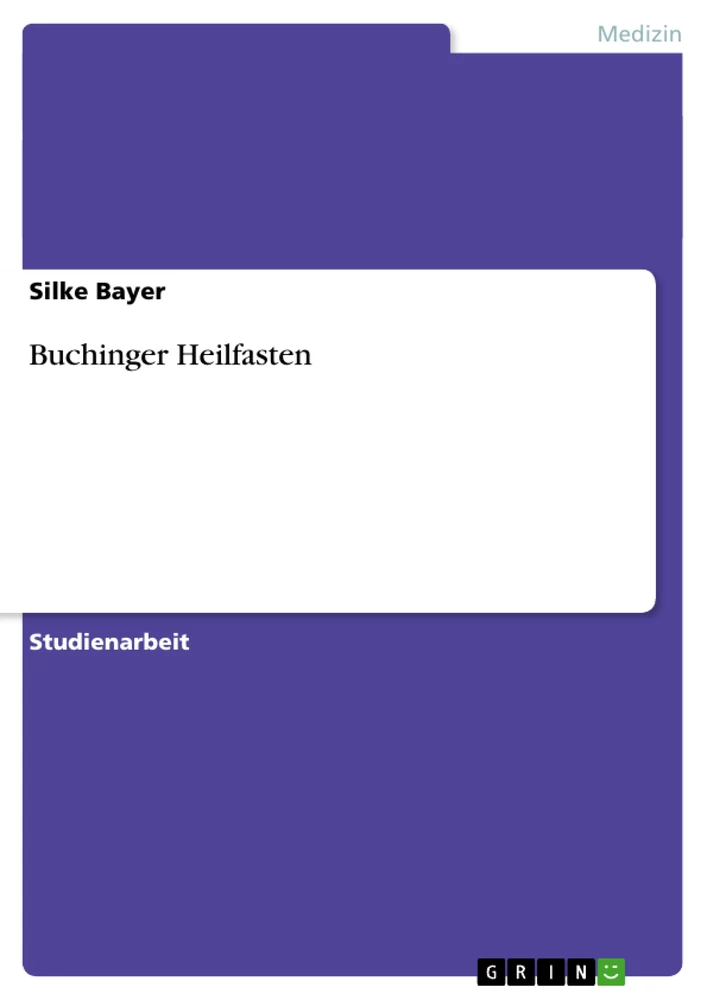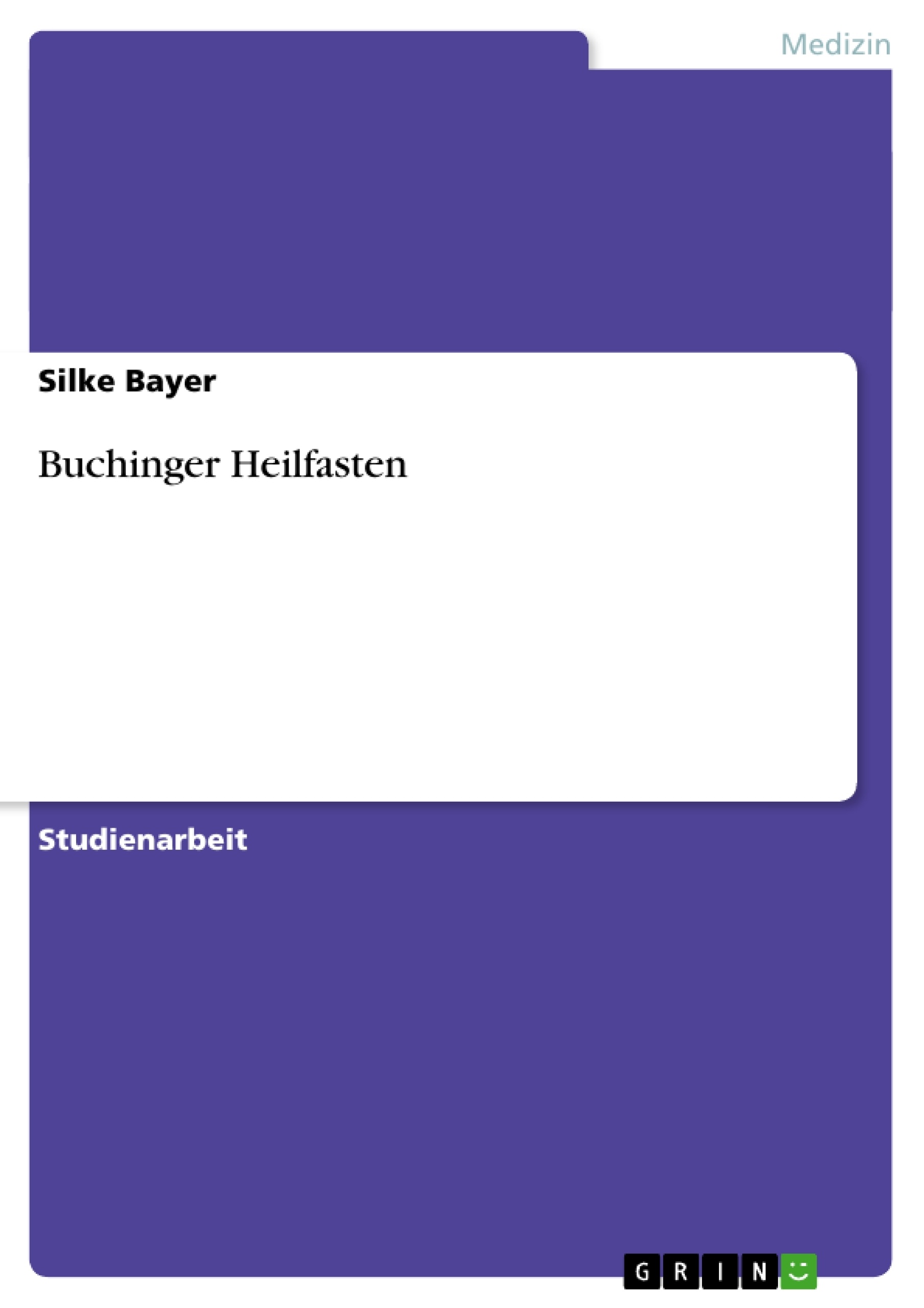Fastenkuren haben im Laufe der Geschichte schon unzähligen Menschen zu Gesundheit verholfen. Doch fasten ist nicht gleich fasten. Es gibt unzählige Formen; von der Nulldiät bis hin zu Körnern- oder Ahornsirupkuren o.ä.
Beim Heilfasten nach Buchinger - der verbreitetsten Fastenvariante - nimmt der Patient täglich 200-300 Kcal in Form von Honig, Säften und Brühe zu sich. Im Zentrum stehen neben den körperlichen Veränderungsprozessen auch die geistig-seelischen Dimensionen des Nahrungsverzichts.
Der Begriff "Heilfasten" stammt von dem dt. Arzt Otto Buchinger (1878-1966).
· "Heil" beinhaltet für ihn vier lateinische Begriffe:
1. curare: heilen/kurieren, aber auch fürsorgen, bemühen (Aspekt des Heilens)
2. integer: ganz/voll/unversehrt/unverletzt (Aspekt der Ganzheitlichkeit)
3. sanctus: heilig/geweiht (religiöser Aspekt)
4. salus: Gesundheit/Wohl(fahrt)/ Heil/Rettung (seelisch-geistiger Aspekt)
· "Fasten" lässt sich vom Gotischen ableiten ("fastan") und bedeutet festhalten, sich an die Verordnungen des Priesters / Arztes halten.
Vor allem die Ganzheitlichkeit des Heilfastens wird immer wieder betont. Die körperlichen Vorgänge, die der Nahrungsverzicht auslöst, haben auch Auswirkungen im seelisch-geistigen Bereich. Man könnte sagen, dass das Körperliche während dem Fasten ruht und sich regeneriert während das Geistige, das Bewusstsein wächst.
Definiert wird Heilfasten als "bewusster und freiwilliger Verzicht auf feste Nahrung und Genussmittel für einen begrenzten Zeitraum".
Diese Definition beinhalten eine wichtige Regel für die Zeit des Fastens: Wer auf das Essen verzichtet, muss auch auf Rauchen und Alkohol verzichten.
Außerdem besagt die Bezeichnung "bewusster Verzicht", dass sich die Person, die sich zum Fasten entschließt, vorher mit der Thematik auseinandersetzen muss, z.B. indem sie Fastenliteratur liest. Für die eigentliche Fastenzeit bedeutet "bewusst", dass sich der Fastende auch Zeit zur Besinnung nimmt. Ein unüberlegtes "Losfasten" im hektischen Alltag wäre damit nicht dem Heilfasten zuzuordnen
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung des Heilfastens
- Religiöse Wurzeln des Fastens
- Familiengeschichte der Buchingers
- Die stationäre Fastenkur
- Dauer einer (stationären) Fastenkur
- Physiologische Vorgänge beim Heilfasten
- Stoffwechselveränderungen
- Nebenerscheinungen des Heilfastens
- Seelisch-geistige Aspekte des Heilfastens
- Indikation und Kontraindikation
- Indikation
- Kontraindikation
- Schlussbetrachtung und Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Heilfasten nach Buchinger, seinen historischen Wurzeln, den physiologischen Prozessen, den seelisch-geistigen Aspekten und den medizinischen Indikationen und Kontraindikationen. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis dieser Fastenmethode zu vermitteln.
- Historische Entwicklung des Heilfastens und dessen religiöse Einflüsse
- Physiologische Veränderungen während des Heilfastens
- Seelisch-geistige Aspekte und die Bedeutung der inneren Einkehr
- Medizinische Aspekte: Indikationen und Kontraindikationen
- Die stationäre Fastenkur als optimale Durchführungsform
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Heilfastens ein und hebt die Unterschiede zu anderen Fastenformen hervor. Sie betont die Bedeutung der körperlichen und seelisch-geistigen Dimensionen beim Heilfasten nach Buchinger, das durch die tägliche Zufuhr von 200-300 kcal in Form von Honig, Säften und Brühe gekennzeichnet ist. Der Begriff „Heilfasten“ wird etymologisch beleuchtet, wobei die vier lateinischen Bedeutungen von „Heil“ (curare, integer, sanctus, salus) und die gotische Wurzel von „Fasten“ (fastan) im Sinne von „sich an Verordnungen halten“ herausgestellt werden. Die Ganzheitlichkeit des Heilfastens, die Verbindung von körperlicher Regeneration und geistigem Wachstum, wird als zentrales Element definiert.
Entwicklung des Heilfastens: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Wurzeln des Heilfastens, beginnend mit den religiösen Traditionen des Fastens in verschiedenen Weltreligionen (Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus). Es wird der Zusammenhang zwischen Religion und Medizin im Mittelalter erläutert, wobei Fasten als eine wichtige therapeutische Methode von Priesterärzten eingesetzt wurde. Die Ablösung der Medizin von der Religion und die anschließende Wiederentdeckung des Fastens ab dem 18. Jahrhundert werden beschrieben, wobei die Arbeiten von Dr. Otto Buchinger im 20. Jahrhundert im Mittelpunkt stehen. Der anhaltende religiöse Aspekt des Heilfastens wird hervorgehoben, im Gegensatz zu modernen Fastenkuren, die primär auf Gewichtsverlust abzielen.
Die stationäre Fastenkur: Dieses Kapitel argumentiert für die Vorteile einer stationären Fastenkur im Vergleich zu einer ambulanten Durchführung. Die stationäre Kur wird als besonders effektiv dargestellt, da sie eine intensive Betreuung ermöglicht und die Loslösung vom Alltag unterstützt, was essentiell für die seelische und geistige Regeneration ist. Die unterschiedlichen Wirkungen des Fastens von Person zu Person und von Kur zu Kur werden betont. Die Dauer einer stationären Fastenkur (in der Regel 4 Wochen, mindestens 10 Tage) und die verschiedenen Phasen (Entlastung, Fasten, Aufbau) werden erklärt. Die Bedeutung der minimalen Fastendauer (um Rückvergiftungen zu vermeiden) und die Notwendigkeit einer Betreuung, besonders in den Umstellungsphasen, werden hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Heilfasten, Buchinger, Fastenkur, Gesundheit, Entgiftung, Stoffwechsel, seelisch-geistige Aspekte, Religion, Medizin, Indikation, Kontraindikation, stationäre Kur, ambulante Kur.
Häufig gestellte Fragen zum Heilfasten nach Buchinger
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Heilfasten nach Buchinger. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, sowie eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der historischen Entwicklung, den physiologischen Prozessen, den seelisch-geistigen Aspekten und den medizinischen Aspekten (Indikation und Kontraindikation) dieser Fastenmethode.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: die historische Entwicklung des Heilfastens mit seinen religiösen Wurzeln, die physiologischen Veränderungen während des Fastens, die seelisch-geistigen Aspekte und die Bedeutung der inneren Einkehr, die medizinischen Indikationen und Kontraindikationen, sowie die stationäre Fastenkur als optimale Durchführungsform. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Vergleich zum ambulanten Fasten und der Bedeutung einer umfassenden Betreuung.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Entwicklung des Heilfastens (inklusive religiöser Wurzeln und der Familiengeschichte der Buchingers), Die stationäre Fastenkur (mit Fokus auf Dauer und Phasen), Physiologische Vorgänge beim Heilfasten (Stoffwechselveränderungen und Nebenwirkungen), Seelisch-geistige Aspekte des Heilfastens, Indikation und Kontraindikation, sowie Schlussbetrachtung und Kritik.
Was sind die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte?
Die Zielsetzung des Dokuments ist es, ein umfassendes Verständnis des Heilfastens nach Buchinger zu vermitteln. Die Themenschwerpunkte liegen auf der historischen Entwicklung, den physiologischen Prozessen, den seelisch-geistigen Aspekten und den medizinischen Indikationen und Kontraindikationen. Es wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt, der die körperliche und seelisch-geistige Dimension berücksichtigt.
Welche Vorteile bietet eine stationäre Fastenkur?
Eine stationäre Fastenkur wird als besonders effektiv dargestellt, da sie eine intensive Betreuung ermöglicht und die Loslösung vom Alltag unterstützt, was essentiell für die seelische und geistige Regeneration ist. Die stationäre Kur bietet im Vergleich zur ambulanten Durchführung eine bessere Kontrolle und Unterstützung während der verschiedenen Phasen des Fastens.
Wer ist Otto Buchinger und welche Rolle spielt er?
Dr. Otto Buchinger spielt eine zentrale Rolle im Kontext des Heilfastens. Das Dokument hebt seine Arbeiten im 20. Jahrhundert hervor, die zur Entwicklung und Verbreitung der heute bekannten Buchinger-Methode beigetragen haben. Seine Methode wird als eine Weiterentwicklung des traditionellen Heilfastens dargestellt, die sowohl die körperlichen als auch die seelisch-geistigen Aspekte berücksichtigt.
Welche religiösen Einflüsse hat das Heilfasten?
Das Heilfasten hat tiefe religiöse Wurzeln, die in verschiedenen Weltreligionen (Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus) zu finden sind. Das Dokument erläutert den Zusammenhang zwischen Religion und Medizin im Mittelalter und die Bedeutung des Fastens als therapeutische Methode. Es wird hervorgehoben, dass der religiöse Aspekt im Heilfasten nach Buchinger, im Gegensatz zu modernen Fastenkuren, eine wichtige Rolle spielt.
Welche physiologischen Prozesse werden beim Heilfasten beschrieben?
Das Dokument beschreibt die Stoffwechselveränderungen und möglichen Nebenwirkungen, die während des Heilfastens auftreten können. Es betont die Bedeutung der fachlichen Begleitung, insbesondere in den Umstellungsphasen, um mögliche Risiken zu minimieren. Die minimal notwendige Fastendauer wird im Zusammenhang mit dem Vermeiden von Rückvergiftungen erläutert.
Was sind die Indikationen und Kontraindikationen des Heilfastens?
Das Dokument erwähnt Indikationen und Kontraindikationen des Heilfastens, wobei jedoch keine detaillierte Auflistung erfolgt. Es wird die Notwendigkeit einer individuellen ärztlichen Beratung betont, um festzustellen, ob ein Heilfasten für die jeweilige Person geeignet ist.
Welche Schlüsselwörter beschreiben das Thema?
Die Schlüsselwörter umfassen: Heilfasten, Buchinger, Fastenkur, Gesundheit, Entgiftung, Stoffwechsel, seelisch-geistige Aspekte, Religion, Medizin, Indikation, Kontraindikation, stationäre Kur, ambulante Kur.
- Quote paper
- Silke Bayer (Author), 2002, Buchinger Heilfasten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12535