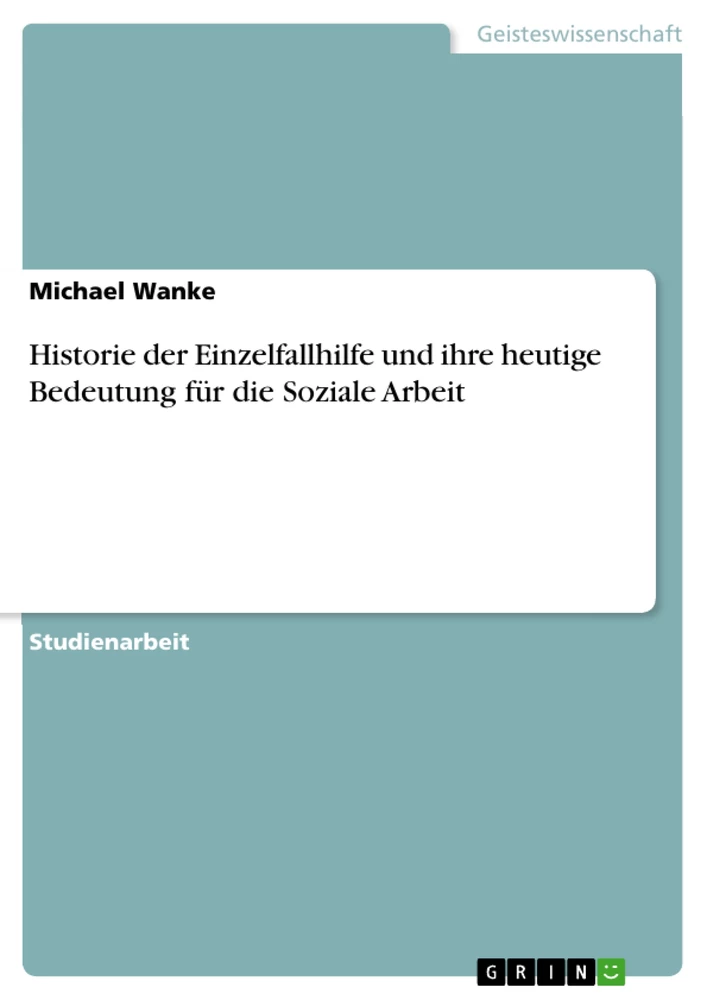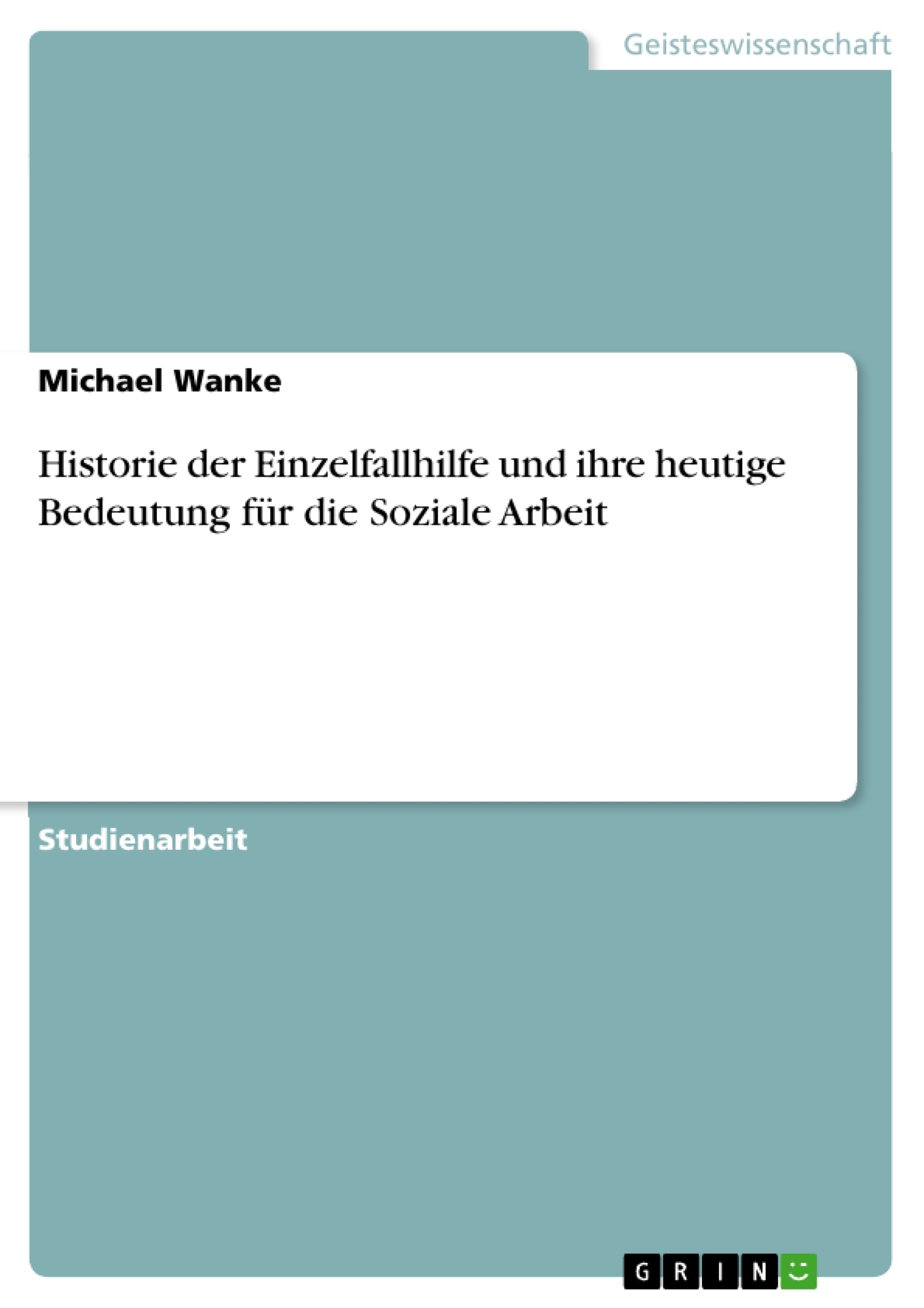Die Einzelfallhilfe ist die älteste klassische Methode Sozialer Arbeit mit einzelnen Menschen aber auch mit Familien. Vorrangiges Ziel ist dabei die persönliche Hilfe zur Selbsthilfe. Soziale Arbeit oblag um 1900 weitestgehend ehrenamtlichen Kräften und begann sich erst langsam zu einer Profession zu entwickeln. Diese Hausarbeit erfasst zunächst die historische Entwicklung der Einzelfallhilfe, beginnend mit der Armenfürsorge im Mittelalter bis zur Industrialisierung. Sie erläutert den Fürsorgegedanken Sozialer Arbeit im Nationalsozialismus und endet mit kritischen Überlegungen der Nachkriegszeit, die zu aktuellen Methoden wie das Case Management oder Empowerment geführt haben. Meine Motivation für diese Hausarbeit war die historische Entwicklung zu verfolgen und herausstechende Persönlichkeiten der Einzelfallhilfe und deren Ideen vorzustellen. Daraus ergibt sich für mich die Forschungsfrage, welche damaligen Erkenntnisse noch heute eine große Bedeutung für die Einzelfallhilfe haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorindustrielle Zeit
- Gesellschaftliche Verpflichtung den Armen gegenüber
- Loslösung vom „gottgewollten“ Zustand
- Industrialisierung
- Bevölkerungsanstieg in den Städten
- Elberfelder- und Straßburger System
- Professionalisierung der Sozialen Arbeit
- Charity Organization Society (COS)
- Mary Richmond (1861 – 1928)
- Alice Salomon (1872 – 1948)
- Soziale Ungleichheit als Motivation zur Professionalisierung Sozialer Arbeit
- Konkretisierung der Profession
- Soziale Diagnose
- Nationalsozialismus
- Die Zeit nach 1945
- Streben nach internationaler Anerkennung
- Kritische Stimmen zur Einzelfallhilfe
- Handlungsleitende Konzepte
- Case Management
- Empowerment
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit verfolgt die historische Entwicklung der Einzelfallhilfe in der Sozialen Arbeit, von der Armenfürsorge im Mittelalter bis in die Nachkriegszeit. Sie beleuchtet wichtige Persönlichkeiten und deren Konzepte und untersucht, welche damaligen Erkenntnisse heute noch relevant sind. Die Forschungsfrage lautet: Welche Erkenntnisse aus der Geschichte der Einzelfallhilfe haben heute noch eine große Bedeutung?
- Historische Entwicklung der Einzelfallhilfe
- Einfluss bedeutender Persönlichkeiten
- Wandel des Fürsorgeverständnisses
- Entwicklung von Handlungskonzepten (Case Management, Empowerment)
- Relevanz historischer Erkenntnisse für die heutige Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Einzelfallhilfe als älteste Methode der Sozialen Arbeit vor und beschreibt das Ziel der persönlichen Hilfe zur Selbsthilfe. Sie umreißt den Inhalt der Arbeit: die historische Entwicklung der Einzelfallhilfe vom Mittelalter bis zur Gegenwart, inklusive der Betrachtung des Fürsorgegedankens im Nationalsozialismus und der kritischen Auseinandersetzung mit der Nachkriegszeit, die zu modernen Methoden wie Case Management und Empowerment führte. Die Motivation der Autorin besteht in der Verfolgung der historischen Entwicklung und der Vorstellung herausragender Persönlichkeiten und ihrer Ideen, um die Bedeutung vergangener Erkenntnisse für die heutige Einzelfallhilfe zu untersuchen.
Vorindustrielle Zeit: Dieses Kapitel beschreibt die Armenfürsorge im europäischen Mittelalter. Arme galten als ein eigener Stand der Gesellschaft, deren Armut als gottgewollt angesehen wurde. Betteln war legitim und durch Armenvögte geregelt. Mit dem Aufkommen von Hungersnöten und Kriegen, insbesondere im 16. und 17. Jahrhundert, nahm die Zahl der Stadtfremden Armen stark zu, was zu Maßnahmen führte, um Bettler und Fremde auszugrenzen. Bettelausweise wurden eingeführt und Arbeitsfähigkeit wurde zur Voraussetzung für Unterstützung. Die calvinistische Arbeitsmoral, die Arbeit als gleichwertig und wichtig ansah, beeinflusste den Wandel im Verständnis von Armut, die nun nicht mehr als gottgewollt, sondern als Folge von Faulheit und moralischer Verdorbenheit galt. Arbeit wurde zum Heilmittel gegen Armut, Betteln wurde verboten und mit Zwangsarbeit bestraft, obwohl sich die Arbeitshäuser als unzureichend im Angesicht des industriellen Fortschritts erwiesen.
Industrialisierung: Der Abschnitt behandelt den Einfluss der Industrialisierung ab 1850 auf die sozialen Verhältnisse. Technische Erfindungen führten zu einem Bevölkerungsanstieg in den Städten, da Landarbeiter auf der Suche nach Arbeit in die Städte zogen. Die Städte waren mit der Versorgung der stark wachsenden Bevölkerung überfordert. Katastrophale Wohnverhältnisse, mangelhafte Ernährung und medizinische Versorgung sowie der Verlust sozialer Bindungen waren die Folgen. Das preußische Armenfürsorgegesetz von 1842 und das 1853 eingeführte Elberfelder System versuchten, die Armenfürsorge zu verbessern. Das Elberfelder System teilte die Stadt in Quartiere ein, in denen ehrenamtliche Armenpfleger für Familien verantwortlich waren und Unterstützung beantragten, wobei die Hauptarbeit darin bestand Arbeit für die Bedürftigen zu finden. Die Kritik an der Großzügigkeit des Systems und die Überforderung der Ehrenamtlichen führten zur Entwicklung des Straßburger Systems, welches die Armutsverwaltung zur kommunalen Aufgabe machte und den Übergang zur professionellen Wohlfahrt einleitete.
Professionalisierung der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel fokussiert sich auf die Entwicklung der Sozialen Arbeit als Profession, beginnend mit der Gründung der ersten Charity Organization Society (COS) in Buffalo 1877. Die COS diente als Clearing-Stelle zur Registrierung von Hilfesuchenden und Untersuchung ihrer Lebensverhältnisse. Die Bedeutung von Mary Richmond und Alice Salomon wird hervorgehoben, wobei insbesondere Salomons Beiträge zur sozialen Diagnose und zur Konkretisierung der Profession in der Sozialen Arbeit detailliert beschrieben werden. Der Einfluss sozialer Ungleichheit als Motivation für die Professionalisierung wird ebenfalls untersucht.
Schlüsselwörter
Einzelfallhilfe, Soziale Arbeit, Armenfürsorge, Industrialisierung, Professionalisierung, Elberfelder System, Straßburger System, Charity Organization Society (COS), Mary Richmond, Alice Salomon, Case Management, Empowerment, Soziale Ungleichheit, Geschichte der Sozialen Arbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Historische Entwicklung der Einzelfallhilfe
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die historische Entwicklung der Einzelfallhilfe in der Sozialen Arbeit, von der Armenfürsorge im Mittelalter bis in die Nachkriegszeit. Sie beleuchtet wichtige Persönlichkeiten und deren Konzepte und untersucht, welche damaligen Erkenntnisse heute noch relevant sind. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Erkenntnisse aus der Geschichte der Einzelfallhilfe haben heute noch eine große Bedeutung?
Welche Epochen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit behandelt die vorindustrielle Zeit (mit Fokus auf die Armenfürsorge im Mittelalter), die Industrialisierung und deren Auswirkungen auf die soziale Arbeit, die Professionalisierung der Sozialen Arbeit, den Nationalsozialismus und die Zeit nach 1945.
Welche wichtigen Persönlichkeiten werden behandelt?
Die Arbeit hebt die Bedeutung von Mary Richmond und Alice Salomon hervor. Insbesondere Salomons Beiträge zur sozialen Diagnose und zur Konkretisierung der Profession in der Sozialen Arbeit werden detailliert beschrieben.
Welche Systeme der Armenfürsorge werden analysiert?
Die Hausarbeit analysiert das Elberfelder und das Straßburger System, und vergleicht deren Ansätze und Auswirkungen auf die Armenfürsorge. Es wird auch auf die Charity Organization Society (COS) eingegangen.
Welche modernen Konzepte der Sozialen Arbeit werden im Kontext der historischen Entwicklung betrachtet?
Die Hausarbeit untersucht die Relevanz historischer Erkenntnisse für moderne Handlungskonzepte wie Case Management und Empowerment.
Wie wird der Wandel des Fürsorgeverständnisses dargestellt?
Die Hausarbeit verfolgt den Wandel des Fürsorgeverständnisses von der mittelalterlichen Armenfürsorge, die Armut als gottgewollt ansah, über die calvinistische Arbeitsmoral bis hin zur Professionalisierung der Sozialen Arbeit und der Entwicklung moderner Handlungskonzepte.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, Vorindustrielle Zeit, Industrialisierung, Professionalisierung der Sozialen Arbeit, Nationalsozialismus, Die Zeit nach 1945 und Handlungsleitende Konzepte, sowie einem Fazit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Einzelfallhilfe, Soziale Arbeit, Armenfürsorge, Industrialisierung, Professionalisierung, Elberfelder System, Straßburger System, Charity Organization Society (COS), Mary Richmond, Alice Salomon, Case Management, Empowerment, Soziale Ungleichheit, Geschichte der Sozialen Arbeit.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Hausarbeit?
Die Hausarbeit zieht Schlussfolgerungen zur Relevanz historischer Erkenntnisse aus der Einzelfallhilfe für die heutige Praxis der Sozialen Arbeit. Genaueres wird im Fazit der Arbeit erläutert.
Für wen ist diese Hausarbeit relevant?
Diese Hausarbeit ist relevant für Studierende der Sozialen Arbeit, Sozialwissenschaftler*innen und alle, die sich für die Geschichte und Entwicklung der Sozialen Arbeit interessieren.
- Quote paper
- Michael Wanke (Author), 2020, Historie der Einzelfallhilfe und ihre heutige Bedeutung für die Soziale Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1252794