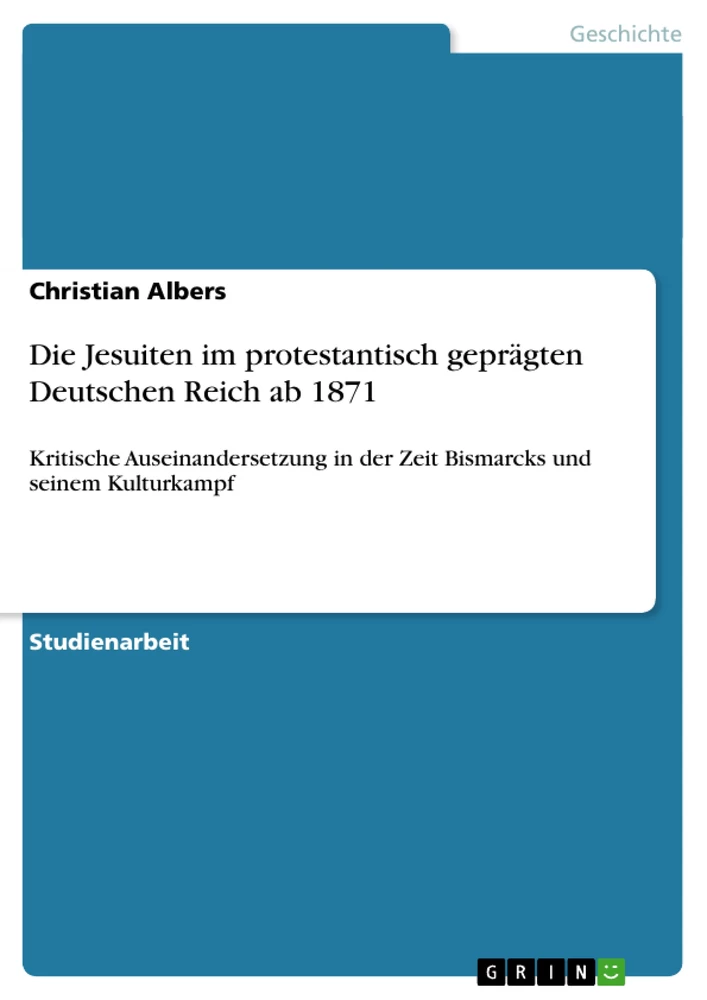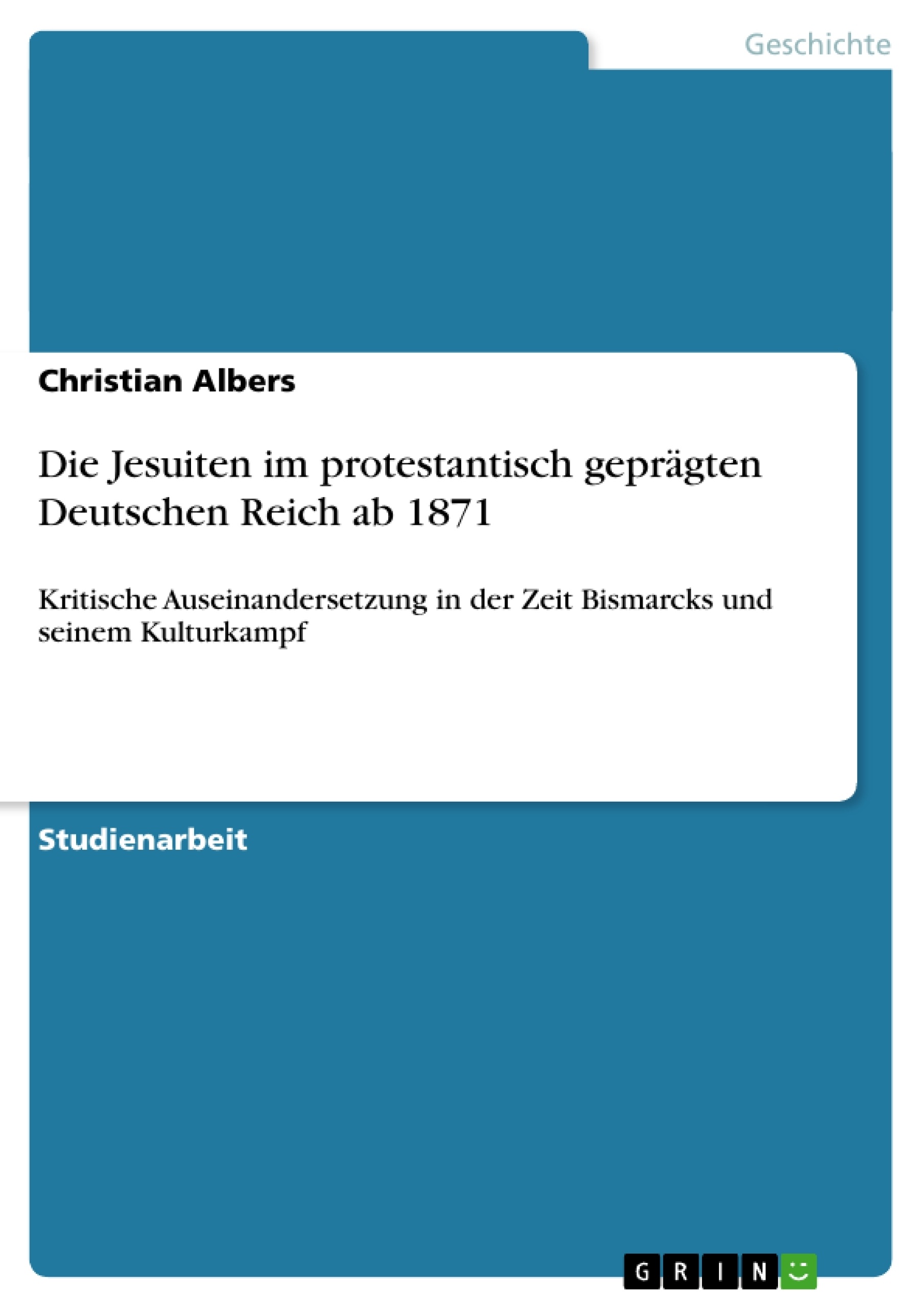Als 1871 das Deutsche Reich wiedergegründet wurde, endete eine lange Zeit der Klein- und Vielstaaterei auf deutschem Boden.
Legt man den Fokus auf konfessionelle Aspekte, wird schnell deutlich, dass mit der Reichsgründung die Katholiken in die Minderheit gerieten, da besonders das protestantisch geprägte Preußen einen Großteil der Bevölkerung stellte.
Bismarck setzte sich in der Folgezeit das Ziel, die Katholiken zu schwächen und versuchte sie durch gezielte Gesetzesmaßnahmen in die Bedeutungslosigkeit zu führen. Der Jesuitenorden als katholische Organisation blieb daher nicht unberührt. Mit ihrem Verbot 1872 mussten die Jesuiten ihre Tätigkeiten auf dem deutschen Reichsgebiet beenden. Schon im Vorfeld dieses Verbotes entbrannte in Deutschland eine heftige Diskussion über die Rolle der Jesuiten in der katholischen Kirche und über ihr allgemeines Wirken.
Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit den Ereignissen während der Reichsgründung 1871 und untersucht die Frage, wie die zeitgenössische - vor allem protestantisch geprägte - Gesellschaft und Literatur mit dem Jesuitenorden verfuhr. Wie wurden die Jesuiten begutachtet und wo lagen die Kritikpunkte, die ein Verbot des Ordens rechtfertigten? Darüber hinaus soll in einem kurzen Ausblick der Jesuitenstreit um 1890 betrachtet werden, der eine mögliche Rückkehr des Ordens ins Deutsche Reich diskutierte.
Da die Forschung den Kampf Bismarcks gegen die katholische Kirche und der Gesellschaft Jesu überwiegend in seiner Gesamtheit bewertet, werde ich mich vor allem mit einzelnen Quellen dieser Zeit beschäftigen, die gezielt auf dem Thema Jesuiten basieren.
Gliederungspunkt 1 des Hauptteils „Die Jesuiten zur Zeit der Gründung des Deutschen Reiches 1871“ untersucht unter anderem die ersten Kontroversen um das Wirken der Jesuiten. Im darauf folgenden zweiten Gliederungspunkt „Maßnahmen gegen die katholische Kirche und den Jesuitenorden“ wird der Kulturkampf ausführlich dargestellt. Das dritte Kapitel „Die Diskussion um die Aufhebung des Jesuitengesetzes um 1890“ gibt einen kleinen Ausblick auf das Ende des Kulturkampfes und auf die mögliche Aufhebung des Jesuitenverbots. Im letzten Gliederungspunkt „Die Bilanz des Kulturkampfes“ wird anhand von einzelnen Quellen eine Gesamtbewertung des Kulturkampfes vorgenommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Hauptteil
- 2.1 Die Jesuiten zur Zeit der Gründung des Deutschen Reiches 1871
- 2.1.1 Erste Kontroversen um das Wirken der Jesuiten
- 2.1.2 Das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes
- 2.1.3 Das Deutsche Reich als evangelisches Kaisertum?
- 2.2 Maßnahmen gegen die katholische Kirche und den Jesuitenorden
- 2.2.1 Vorwürfe gegen das Zentrum
- 2.2.2 Der Beginn des Kulturkampfes
- 2.2.3 Das Verbot des Jesuitenordens
- 2.2.4 Die Ausweisung nichtdeutscher Jesuiten am Beispiel der Provinz Posen
- 2.2.5 Die Rolle von Kaiserin Augusta im Kulturkampf
- 2.2.6 Über die kirchlich-politische Wirksamkeit des Jesuitenordens
- 2.3 Die Diskussion um die Aufhebung des Jesuitengesetzes um 1890
- 2.4 Die Bilanz des Kulturkampfes
- 2.1 Die Jesuiten zur Zeit der Gründung des Deutschen Reiches 1871
- 3 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Behandlung des Jesuitenordens in der vorwiegend protestantisch geprägten deutschen Gesellschaft und Literatur nach der Reichsgründung 1871. Sie beleuchtet die Kritikpunkte, die zum Verbot des Ordens führten, und betrachtet die Diskussion um eine mögliche Rückkehr des Ordens um 1890. Die Arbeit konzentriert sich auf Einzelquellen, um die gängige Gesamtbewertung des Kulturkampfes zu ergänzen.
- Die Kontroversen um das Wirken der Jesuiten vor und nach der Reichsgründung.
- Der Einfluss des Unfehlbarkeitsdogmas auf die Spannungen zwischen Protestanten und Katholiken.
- Die Maßnahmen Bismarcks gegen die katholische Kirche und den Jesuitenorden im Kontext des Kulturkampfes.
- Die Rolle der öffentlichen Meinung und spezifischer Persönlichkeiten (z.B. Kaiserin Augusta).
- Die Debatte um die Aufhebung des Jesuitengesetzes um 1890.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den konfessionellen Kontext der Reichsgründung 1871, bei der die Protestanten die Mehrheit stellten. Sie benennt die Zielsetzung der Arbeit: die Untersuchung der zeitgenössischen Wahrnehmung und Behandlung des Jesuitenordens sowie die Betrachtung der Diskussion um seine Wiedereingliederung um 1890. Die Arbeit konzentriert sich auf Einzelquellen, da umfassende Darstellungen des Kulturkampfes oft den Fokus auf den Gesamtkonflikt legen und die spezielle Situation der Jesuiten weniger detailliert beleuchten.
2.1 Die Jesuiten zur Zeit der Gründung des Deutschen Reiches 1871: Dieses Kapitel analysiert die frühen Kontroversen um den Jesuitenorden, insbesondere im Kontext des deutsch-französischen Krieges von 1870. Es untersucht, wie die Jesuiten in öffentlichen Debatten dargestellt wurden und welche Vorwürfe gegen sie erhoben wurden. Der Briefwechsel zwischen dem Danziger Regierungspräsidenten Diest und dem Posener Erzbischof Ledochowski veranschaulicht die gegensätzlichen Perspektiven und die Bedeutung der Jesuitenmissionen in der öffentlichen Wahrnehmung. Die Einführung des Dogmas der päpstlichen Unfehlbarkeit und die Interpretation des Deutschen Reiches als „evangelisches Kaisertum“ werden als weitere Faktoren für die Verschärfung der Konflikte vorgestellt.
2.2 Maßnahmen gegen die katholische Kirche und den Jesuitenorden: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Maßnahmen des Kulturkampfes gegen die katholische Kirche und den Jesuitenorden. Es beginnt mit den ersten Vorwürfen gegen das Zentrum und führt über den Beginn des Kulturkampfes bis hin zum Verbot des Jesuitenordens. Die Ausweisung nichtdeutscher Jesuiten aus der Provinz Posen wird als Beispiel für die Härte der Maßnahmen genannt. Die Rolle von Kaiserin Augusta und die Analyse eines Aufsatzes von Johannes Huber aus dem Jahr 1873 geben weitere Einblicke in die damalige Kontroverse und die kirchlich-politische Wirksamkeit des Jesuitenordens.
Schlüsselwörter
Jesuitenorden, Kulturkampf, Deutsches Reich, Reichsgründung 1871, Katholizismus, Protestantismus, Otto von Bismarck, Kaiser Wilhelm I., Unfehlbarkeitsdogma, katholische Kirche, anti-katholische Politik, Jesuitengesetz, Posen, Kaiserin Augusta, Konfessionskonflikt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Der Jesuitenorden im Kontext des Kulturkampfes
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Behandlung des Jesuitenordens in der deutschen Gesellschaft und Literatur nach der Reichsgründung 1871. Sie beleuchtet die Kritikpunkte, die zum Verbot des Ordens führten, und analysiert die Debatte um seine mögliche Rückkehr um 1890. Der Fokus liegt auf Einzelquellen, um die gängige Gesamtbewertung des Kulturkampfes zu ergänzen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Kontroversen um das Wirken der Jesuiten vor und nach der Reichsgründung, den Einfluss des Unfehlbarkeitsdogmas auf die Spannungen zwischen Protestanten und Katholiken, Bismarcks Maßnahmen gegen die katholische Kirche und den Jesuitenorden im Kontext des Kulturkampfes, die Rolle der öffentlichen Meinung und spezifischer Persönlichkeiten (z.B. Kaiserin Augusta) sowie die Debatte um die Aufhebung des Jesuitengesetzes um 1890.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: eine Einleitung, einen Hauptteil (mit Unterkapiteln zu den Jesuiten um 1871, den Maßnahmen gegen den Orden und die Diskussion um die Aufhebung des Jesuitengesetzes) und ein Fazit. Der Hauptteil analysiert detailliert die frühen Kontroversen, die Maßnahmen des Kulturkampfes (inkl. der Ausweisung nichtdeutscher Jesuiten aus Posen und der Rolle Kaiserin Augustas), und die Debatte um 1890.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit konzentriert sich auf Einzelquellen, um die oft generalisierenden Darstellungen des Kulturkampfes zu ergänzen und die spezifische Situation der Jesuiten detaillierter zu beleuchten. Ein Beispiel für eine genannte Quelle ist der Briefwechsel zwischen dem Danziger Regierungspräsidenten Diest und dem Posener Erzbischof Ledochowski.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
(Die konkreten Schlussfolgerungen sind nicht im bereitgestellten Textzusammenfassung enthalten. Der Abschnitt "Fazit" der Arbeit müsste eingesehen werden, um diese Frage zu beantworten.)
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jesuitenorden, Kulturkampf, Deutsches Reich, Reichsgründung 1871, Katholizismus, Protestantismus, Otto von Bismarck, Kaiser Wilhelm I., Unfehlbarkeitsdogma, katholische Kirche, anti-katholische Politik, Jesuitengesetz, Posen, Kaiserin Augusta, Konfessionskonflikt.
Welchen Zeitraum behandelt die Arbeit?
Die Arbeit behandelt vorwiegend den Zeitraum um die Reichsgründung 1871 und die Zeit bis etwa 1890, fokussiert auf die Ereignisse des Kulturkampfes und die damit verbundene Behandlung des Jesuitenordens.
Welche Rolle spielt Kaiserin Augusta in der Arbeit?
Die Rolle Kaiserin Augustas im Kulturkampf wird in der Arbeit untersucht und analysiert, wobei ein Aufsatz von Johannes Huber aus dem Jahr 1873 als Quelle herangezogen wird. Die genaue Darstellung ihrer Rolle muss jedoch aus der vollständigen Arbeit entnommen werden.
- Quote paper
- Christian Albers (Author), 2009, Die Jesuiten im protestantisch geprägten Deutschen Reich ab 1871, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125118