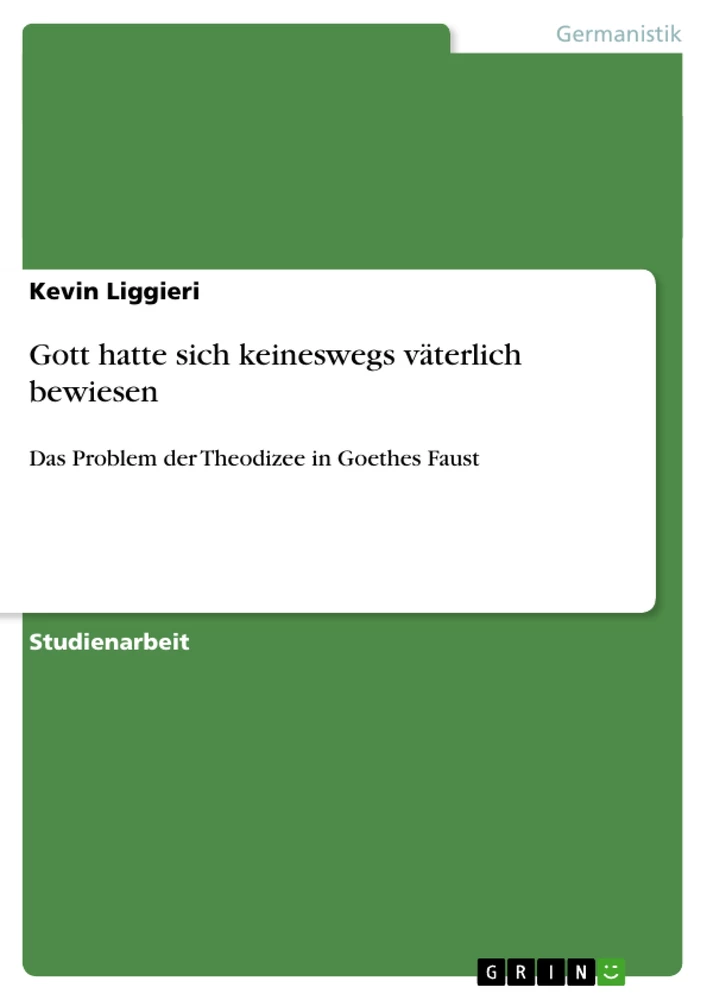In der vorliegenden Arbeit wird zuerst der historische Kern, das viel diskutierte Erdbeben von Lissabon, im Vordergrund stehen, wie es von den Zeitgenossen aufgefasst worden ist und wie Goethe die kindlichen Schreckensereignisse verarbeitet. Danach geht der Blick auf die Theodizeeproblematik im 18. Jahrhundert, um zu zeigen wo und wie Goethe philosophische Konzepte übernimmt oder abändert. In III. wird Goethes Religiosität im Vordergrund stehen, welche die Grundlage ebnet für die Theodizee im Faust und ihre Lösung. Am Ende muss bei der Faustdichtung selber aufgezeigt werden, was für Ansätze, Leerstellen oder Lösungsvorschläge gemacht werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Erschütterung des Glaubens?
- II.1 Das Erdbeben von Lissabon
- II.2 „Kommst du nur immer anzuklagen?“ – Historie der Theodizee
- Leibniz
- Kant
- Schelling
- II.3 „Glaubst du an Gott?“ – Goethes Religion
- II.4 „Fluch der Hoffnung! Fluch dem Glauben!“ Theodizee-Verarbeitung im Faust
- III. „So dumm läuft es am Ende doch hinaus.“ Fazit der Theodizee im Faust
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auseinandersetzung Goethes mit dem Theodizee-Problem, insbesondere im Kontext seines Werkes Faust. Sie beleuchtet den historischen Hintergrund, Goethes religiöse Überzeugungen und die philosophischen Einflüsse von Leibniz, Kant und Schelling auf seine Darstellung der Theodizee im Faust.
- Das Lissabonner Erdbeben als Auslöser theologischer Debatten
- Die philosophischen Ansätze zur Theodizee bei Leibniz, Kant und Schelling
- Goethes eigene religiöse Position und deren Einfluss auf sein Werk
- Die Darstellung des Theodizee-Problems in Goethes Faust
- Die Rolle des Bösen und des Strebens in Goethes Weltbild
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Theodizee ein und stellt die zentrale Frage nach der Vereinbarkeit von Gottes Gerechtigkeit und dem Übel in der Welt. Sie beschreibt Goethes Auseinandersetzung mit dem Thema und skizziert den Aufbau der Arbeit.
II. Erschütterung des Glaubens?: Dieser Abschnitt behandelt zunächst das Lissabonner Erdbeben von 1755 als prägendes Ereignis für Goethe und die damalige theologische Debatte. Anschließend wird die historische Entwicklung der Theodizee-Problematik von Leibniz über Kant bis Schelling dargestellt, wobei die jeweiligen philosophischen Positionen und deren Einfluss auf Goethe beleuchtet werden. Goethes eigene religiöse Ansichten werden im Anschluss erörtert.
II.1 Das Erdbeben von Lissabon: Dieser Unterabschnitt beschreibt die Auswirkungen des Erdbebens auf Goethe und die Gesellschaft und beleuchtet unterschiedliche Interpretationen des Ereignisses im Kontext der Theodizee-Debatte.
II.2 „Kommst du nur immer anzuklagen?“ – Historie der Theodizee: Dieser Unterabschnitt beleuchtet die Theodizee-Debatte bei Leibniz, Kant und Schelling und zeigt deren Einfluss auf Goethes Denken auf.
II.3 „Glaubst du an Gott?“ – Goethes Religion: Dieser Unterabschnitt beschreibt Goethes individuelle religiöse Ansichten und deren Relevanz für seine Auseinandersetzung mit der Theodizee.
II.4 „Fluch der Hoffnung! Fluch dem Glauben!“ Theodizee-Verarbeitung im Faust: Dieser Unterabschnitt analysiert die Darstellung der Theodizee im Faust, die Rollen von Mephisto und Faust, und die Bedeutung des Strebens und des Irrens.
Schlüsselwörter
Theodizee, Johann Wolfgang von Goethe, Faust, Erdbeben von Lissabon, Gottfried Wilhelm Leibniz, Immanuel Kant, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Gott, Übel, Böse, Streben, Erlösung, Monadenlehre, Polarität, Panentheismus.
- Quote paper
- Kevin Liggieri (Author), 2009, Gott hatte sich keineswegs väterlich bewiesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125108