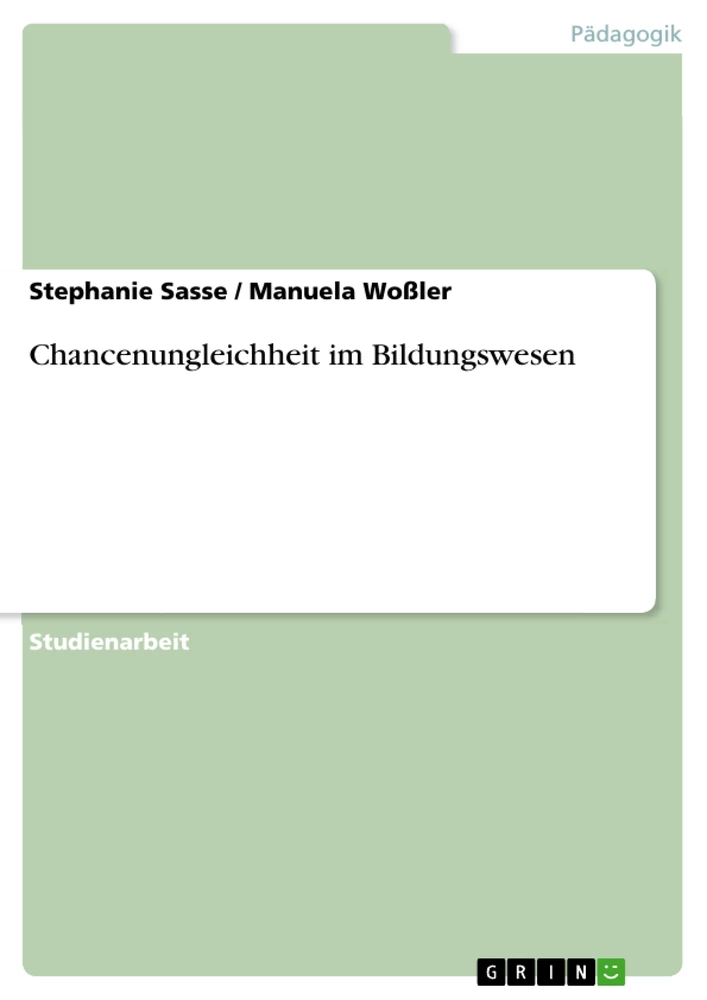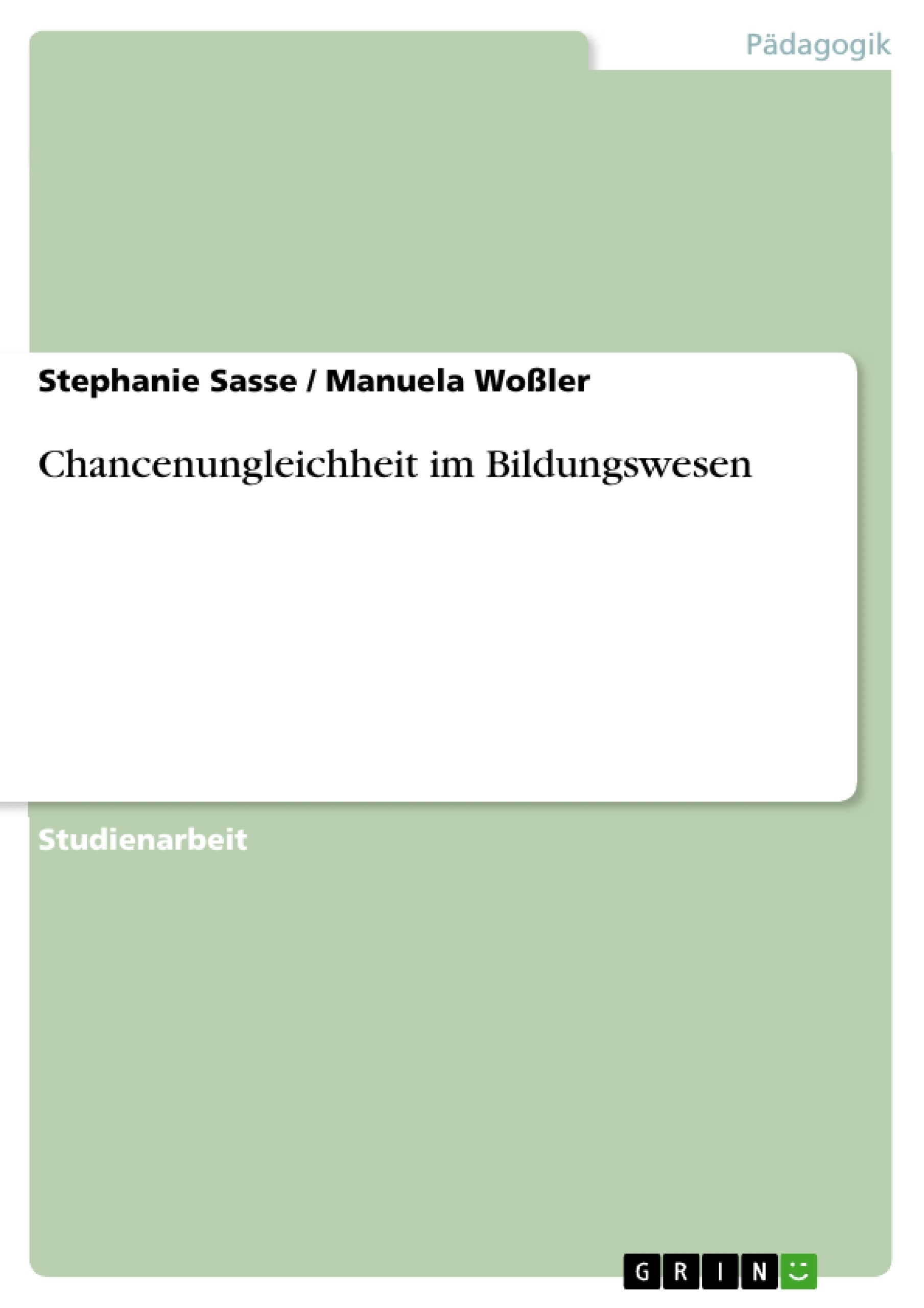In der modernen Gesellschaft gewinnt Bildung eine immer größere Bedeutung. Es werden immer umfangreichere und gestaltungsvielfältigere Bildungseinrichtungen aufgebaut, die einen immer höheren Anteil der öffentlichen Ausgaben erfordern. Bei den jüngeren Menschen wächst die Anzahl der Schüler und Studierenden, sie wenden immer mehr Zeit für die Ausbildung an Schulen und Hochschulen auf. Die Hälfte der nachrückenden Generation verbringt heute schon etwa ein Viertel ihrer Lebenszeit in Bildungseinrichtungen.
Technische, gesellschaftliche und politische Zusammenhänge werden immer komplexer und erfordern immer mehr Wissen von den einzelnen Wissensgesellschaften. Anstatt den maschinellen Ausrüstungen stellen die Kenntnisse der Menschen den Motor wirtschaftlichen Lebens dar. Bildung ist also zur wichtigsten Grundlage für den materiellen Wohlstand moderner Gesellschaften geworden. Umgekehrt ermöglicht es dieser gesellschaftliche Reichtum erst, große Bevölkerungsteile viele Jahre lang aus den unmittelbaren Wirtschaften herauszunehmen und in teuren Bildungseinrichtungen mit Wissen zu versorgen (vgl. Hradil, 1999).
Doch gab es in der Gesellschaft immer gleiche Bildungschancen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Entstehungsgeschichte der (Chancen-)Ungleichheit
- Chancenungleichheit im Bildungswesen
- Definition von Chancengleichheit bzw. -ungleichheit
- Soziale Ungleichheit und Geschlecht
- Verteilung der Geschlechter
- Entwicklung von Geschlechterdifferenzen in der Schule
- Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Chancenungleichheit
- Beeinflussung der Bildungschancen durch verschiedene Faktoren der sozialen Herkunft
- Zusammenhang zwischen Bildung der Eltern und Bildungschancen der Kinder
- Zusammenhang zwischen Einkommenshöhe der Eltern und Bildungschancen der Kinder
- Zusammenhang zwischen Region des Wohnorts und Bildungschancen der Kinder
- Zusammenhang zwischen ausländischer Herkunft und Bildungschancen
- Mögliche Gründe für die Ungleichheit der Bildungschancen
- Theorien der Chancenungleichheit
- Bildungsabstinenz und Einstellung der Eltern
- Die Rolle des Lehrers und sein Eignungsurteil
- Zusammensetzung der Klassen
- Geplante und bereits durchgeführte Verbesserungsmaßnahmen zur Verringerung von Chancenungleichheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Chancenungleichheit im deutschen Bildungssystem. Ziel ist es, die historischen Entwicklungen und die gegenwärtigen Ursachen dieser Ungleichheit aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert verschiedene Faktoren, die die Bildungschancen von Kindern beeinflussen.
- Historische Entwicklung der Chancenungleichheit im Bildungssystem
- Einfluss sozialer Herkunft auf Bildungschancen
- Geschlechterungleichheit im Bildungsbereich
- Rolle von Schule und Lehrkräften bei der Reproduktion von Ungleichheit
- Maßnahmen zur Verringerung von Chancenungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitende Entstehungsgeschichte der (Chancen-)Ungleichheit: Die Einleitung beleuchtet die zunehmende Bedeutung von Bildung in der modernen Gesellschaft und ihren Zusammenhang mit wirtschaftlichem Wohlstand. Sie stellt die Frage nach der historischen Gleichheit von Bildungschancen und führt in die Entwicklung des deutschen Bildungssystems ein, welches trotz des Anspruchs auf Chancengleichheit immer wieder von Ungleichheiten geprägt war, die sich in der sozialen Herkunft, im Geschlecht und weiteren Faktoren manifestierten.
Chancenungleichheit im Bildungswesen: Dieses Kapitel definiert Chancengleichheit und -ungleichheit und untersucht verschiedene Formen der Ungleichheit im Bildungssystem. Es analysiert den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft, Geschlecht und Bildungschancen, beleuchtet die Einflüsse verschiedener Faktoren (Bildung der Eltern, Einkommen, Wohnort, Herkunft) und diskutiert Theorien zur Erklärung der Chancenungleichheit, sowie die Rolle der Lehrer und die Zusammensetzung der Klassen. Es endet mit einem Ausblick auf Maßnahmen zur Verringerung von Ungleichheit.
Schlüsselwörter
Chancenungleichheit, Bildungssystem, soziale Herkunft, Geschlecht, Bildungschancen, Schichtzugehörigkeit, Schulsystem, historische Entwicklung, soziale Ungleichheit, Gleichheitsidee.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Chancenungleichheit im deutschen Bildungssystem
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Chancenungleichheit im deutschen Bildungssystem. Sie analysiert die historischen Entwicklungen und die gegenwärtigen Ursachen dieser Ungleichheit, indem sie verschiedene Faktoren beleuchtet, die die Bildungschancen von Kindern beeinflussen.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der Chancenungleichheit, den Einfluss der sozialen Herkunft auf Bildungschancen, die Geschlechterungleichheit im Bildungsbereich, die Rolle von Schule und Lehrkräften bei der Reproduktion von Ungleichheit und Maßnahmen zur Verringerung von Chancenungleichheit.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung zur Entstehungsgeschichte von Chancenungleichheit. Es folgt ein Hauptteil, der sich mit Chancenungleichheit im Bildungswesen auseinandersetzt, inklusive Definitionen, Analyse sozialer und geschlechtsspezifischer Ungleichheiten und der Betrachtung verschiedener Einflussfaktoren wie Herkunft, Einkommen und Wohnort. Die Arbeit enthält außerdem Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Faktoren beeinflussen die Bildungschancen laut der Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert den Einfluss verschiedener Faktoren auf Bildungschancen, darunter die soziale Herkunft (Elternbildung, Einkommen, Wohnort, Ausländischer Herkunft), das Geschlecht und die Rolle von Lehrkräften und der Klassenzusammensetzung. Es werden Theorien zur Erklärung dieser Ungleichheiten diskutiert.
Welche Rolle spielen Schule und Lehrkräfte bei der Chancenungleichheit?
Die Seminararbeit untersucht die Rolle von Schule und Lehrkräften bei der Reproduktion von Ungleichheit. Hier werden Aspekte wie die Eignungsurteile von Lehrern und die Zusammensetzung der Klassen betrachtet.
Welche Maßnahmen zur Verringerung der Chancenungleichheit werden diskutiert?
Die Seminararbeit beleuchtet geplante und bereits durchgeführte Maßnahmen zur Verringerung von Chancenungleichheit im deutschen Bildungssystem.
Was ist unter Chancengleichheit bzw. -ungleichheit zu verstehen (laut der Seminararbeit)?
Die Seminararbeit bietet eine Definition von Chancengleichheit und -ungleichheit im Kontext des deutschen Bildungssystems. Diese Definition bildet die Grundlage für die weitere Analyse der Ungleichheiten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Chancenungleichheit, Bildungssystem, soziale Herkunft, Geschlecht, Bildungschancen, Schichtzugehörigkeit, Schulsystem, historische Entwicklung, soziale Ungleichheit, Gleichheitsidee.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Seminararbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Punkte und Erkenntnisse jedes Kapitels zusammenfasst.
- Quote paper
- Dr. Stephanie Sasse (Author), Manuela Woßler (Author), 2007, Chancenungleichheit im Bildungswesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125093