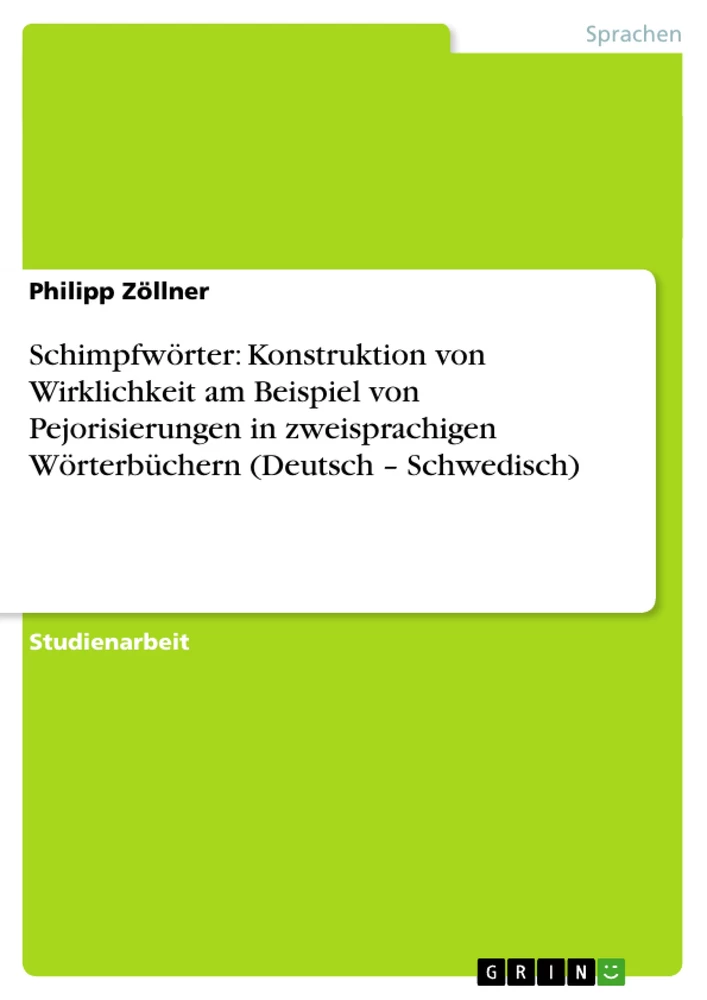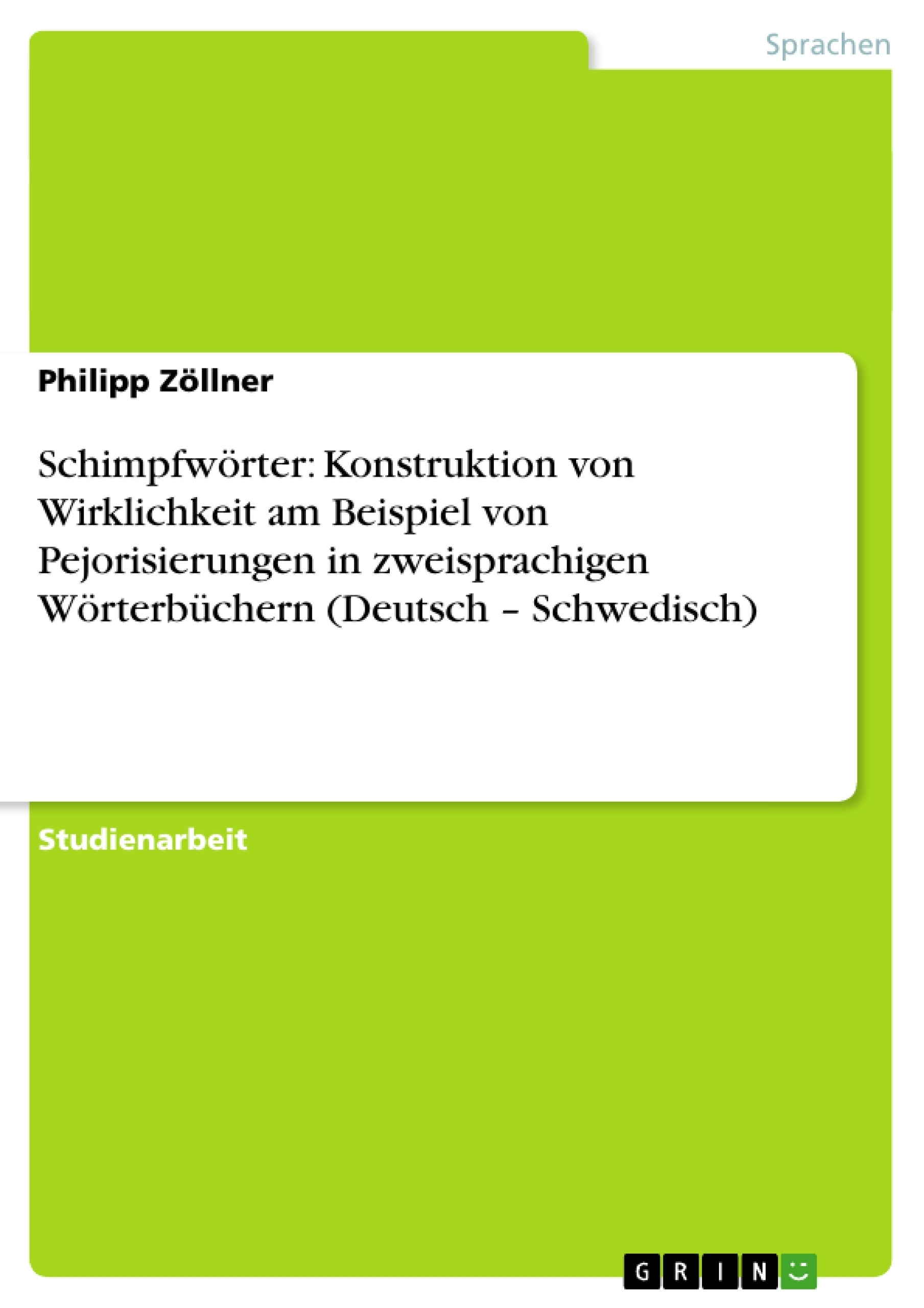In universitären Kontexten sowie im öffentlichen Leben gehören Wörterbücher zu unverzichtbaren Kommunikationshilfsmitteln. Ihr Status wird dabei nur selten hinterfragt. Wer schreibt ein Wörterbuch? Welche Wörter werden aufgenommen? Was bedeutet ein Wort? Dies sind zentrale Fragen, die aus pragmatischer Sicht kritisch diskutiert werden sollen.
Textgrundlage der Untersuchung sind fünf Deutsch-Schwedische Wörterbücher zwischen 1893 und 2001, in denen am Beispiel von Schimpfwörtern1 aufgezeigt werden soll, wie und welche Wirklichkeit hergestellt wird. Es wurden substantivische Bezeichnungen ausgesucht, welche abwertend gebraucht wurden und werden. Die Auswahl erfolgte durch Introspektion, Gruppendiskussion und Studium vorhandener Fachliteratur. Wie jede Studie, kann sie keine absolut verbindlichen Ergebnisse liefern, sondern muss in Relation zu ihrer Entstehung, ihrem Urheber und dem zugrundeliegenden Erkenntnisinteresse betrachtet werden. Ziel ist es, mittels einer diachronen Skizze Veränderungen zu analysieren und in einem konstruktivistischen Verständnis zu interpretieren. Die vorliegende Arbeit möchte eine kritische Perspektive auf Wörterbücher eröffnen und eine Sensibilisierung im Umgang mit Sprache ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Diskussion und Definition zentraler Termini
- Wortbedeutung
- Konnotation
- Pejorativum / pejorative Lexik
- Schimpfwort
- Pejorisierung
- Zum Selbstverständnis von Wörterbüchern
- Metasprachliche Kategorien
- Analyse und Interpretation
- Arschloch
- Franzmann
- Hure
- Itaker
- Kümmeltürke
- Nazi
- Neger
- Nutte
- Pfaffe
- Polacke
- Rothaut
- Schwuchtel
- Schlampe
- Schnalle
- Spast(i)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, wie und welche Wirklichkeit in deutsch-schwedischen Wörterbüchern anhand von Schimpfwörtern konstruiert wird. Sie analysiert diachrone Veränderungen in der Verwendung abwertender Substantive und hinterfragt das Selbstverständnis von Wörterbüchern. Der Fokus liegt auf einer kritischen Perspektive und der Sensibilisierung für den Umgang mit Sprache.
- Konstruktion von Wirklichkeit durch Sprache in Wörterbüchern
- Diachrone Analyse der Bedeutung von Schimpfwörtern
- Das Selbstverständnis und die Autorität von Wörterbüchern
- Konnotation und Denotation von abwertenden Begriffen
- Pejorisierungsprozesse und deren gesellschaftliche Implikationen
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Forschungsansatz. Sie betont die Bedeutung von Wörterbüchern als Kommunikationshilfsmittel und hinterfragt deren implizite Autorität. Die Untersuchung basiert auf fünf deutsch-schwedischen Wörterbüchern und analysiert die Konstruktion von Wirklichkeit anhand der diachronen Betrachtung von Schimpfwörtern. Der konstruktivistische Ansatz wird hervorgehoben, wobei die Subjektivität wissenschaftlicher Arbeit betont wird. Ziel ist es, eine kritische Perspektive auf Wörterbücher zu eröffnen und Sensibilisierung für den sprachlichen Umgang zu schaffen.
Diskussion und Definition zentraler Termini: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Wortbedeutung, Konnotation, Pejorativum, Schimpfwort und Pejorisierung. Es werden verschiedene wissenschaftliche Positionen zu Wortbedeutung und Konnotation diskutiert, wobei die Unterscheidung zwischen begrifflichem Inhalt (Hauptbedeutung) und Nebensinn/Gefühlswert (Nebenbedeutung) im Mittelpunkt steht. Die Arbeit argumentiert für eine pragmatische Perspektive, in der Konnotation als die Bedeutung schlechthin betrachtet wird, im Gegensatz zu einer apriorischen Denkweise. Die Bedeutung eines Wortes wird als konnotationsabhängig und mehrdeutig verstanden, wobei Metaphorisierung als ein Prozess der Bedeutungsverschiebung und Pejorisierung hervorgehoben wird.
Schlüsselwörter
Schimpfwörter, Wörterbücher, Konnotation, Pejorisierung, Wirklichkeitskonstruktion, Deutsch-Schwedisch, diachrone Analyse, Konstruktivismus, abwertende Sprache, semantische Bedeutung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Deutsch-Schwedische Wörterbücher und die Konstruktion von Wirklichkeit anhand von Schimpfwörtern
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie deutsch-schwedische Wörterbücher Wirklichkeit konstruieren, indem sie die Verwendung von Schimpfwörtern diachron analysiert. Der Fokus liegt auf der kritischen Betrachtung des Selbstverständnisses von Wörterbüchern und der Sensibilisierung für den Umgang mit abwertender Sprache.
Welche Wörterbücher wurden untersucht?
Die Untersuchung basiert auf fünf deutsch-schwedischen Wörterbüchern (die konkreten Titel werden nicht genannt).
Welche zentralen Begriffe werden definiert?
Die Arbeit definiert und diskutiert zentrale Begriffe wie Wortbedeutung, Konnotation, Pejorativum, Schimpfwort und Pejorisierung. Es wird die Unterscheidung zwischen Denotation und Konnotation beleuchtet, wobei die Konnotation als die Bedeutung schlechthin betrachtet wird.
Wie wird die Bedeutung von Wörtern betrachtet?
Die Bedeutung eines Wortes wird als konnotationsabhängig und mehrdeutig verstanden. Metaphorisierung und Pejorisierung werden als Prozesse der Bedeutungsverschiebung hervorgehoben.
Welche Schimpfwörter werden analysiert?
Die Analyse umfasst eine Reihe von Schimpfwörtern, darunter (aber nicht ausschließlich): Arschloch, Franzmann, Hure, Itaker, Kümmeltürke, Nazi, Neger, Nutte, Pfaffe, Polacke, Rothaut, Schwuchtel, Schlampe, Schnalle, Spast(i).
Was ist der Forschungsansatz?
Der Forschungsansatz ist konstruktivistisch. Die Subjektivität wissenschaftlicher Arbeit wird betont, und es wird eine kritische Perspektive auf die implizite Autorität von Wörterbüchern eingenommen.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Die Arbeit untersucht die Konstruktion von Wirklichkeit durch Sprache in Wörterbüchern, die diachrone Analyse der Bedeutung von Schimpfwörtern, das Selbstverständnis und die Autorität von Wörterbüchern, Konnotation und Denotation abwertender Begriffe sowie Pejorisierungsprozesse und deren gesellschaftliche Implikationen.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einführung, ein Kapitel zur Diskussion und Definition zentraler Termini, ein Kapitel zum Selbstverständnis von Wörterbüchern, ein Kapitel zu metasprachlichen Kategorien und ein Kapitel zur Analyse und Interpretation der ausgewählten Schimpfwörter. Zusätzlich werden die Zielsetzung, die Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter aufgeführt.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, eine kritische Perspektive auf die Wirklichkeitskonstruktion in deutsch-schwedischen Wörterbüchern zu eröffnen und die Sensibilisierung für einen verantwortungsvollen Umgang mit Sprache zu fördern.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schimpfwörter, Wörterbücher, Konnotation, Pejorisierung, Wirklichkeitskonstruktion, Deutsch-Schwedisch, diachrone Analyse, Konstruktivismus, abwertende Sprache, semantische Bedeutung.
- Quote paper
- Magister Artium Philipp Zöllner (Author), 2007, Schimpfwörter: Konstruktion von Wirklichkeit am Beispiel von Pejorisierungen in zweisprachigen Wörterbüchern (Deutsch – Schwedisch), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125065