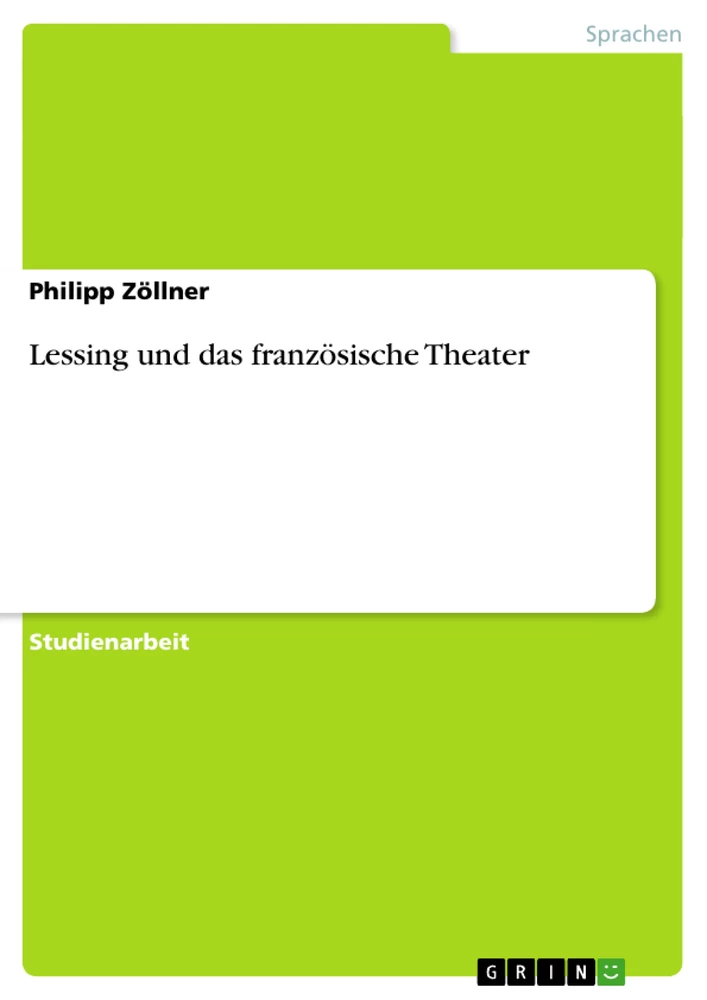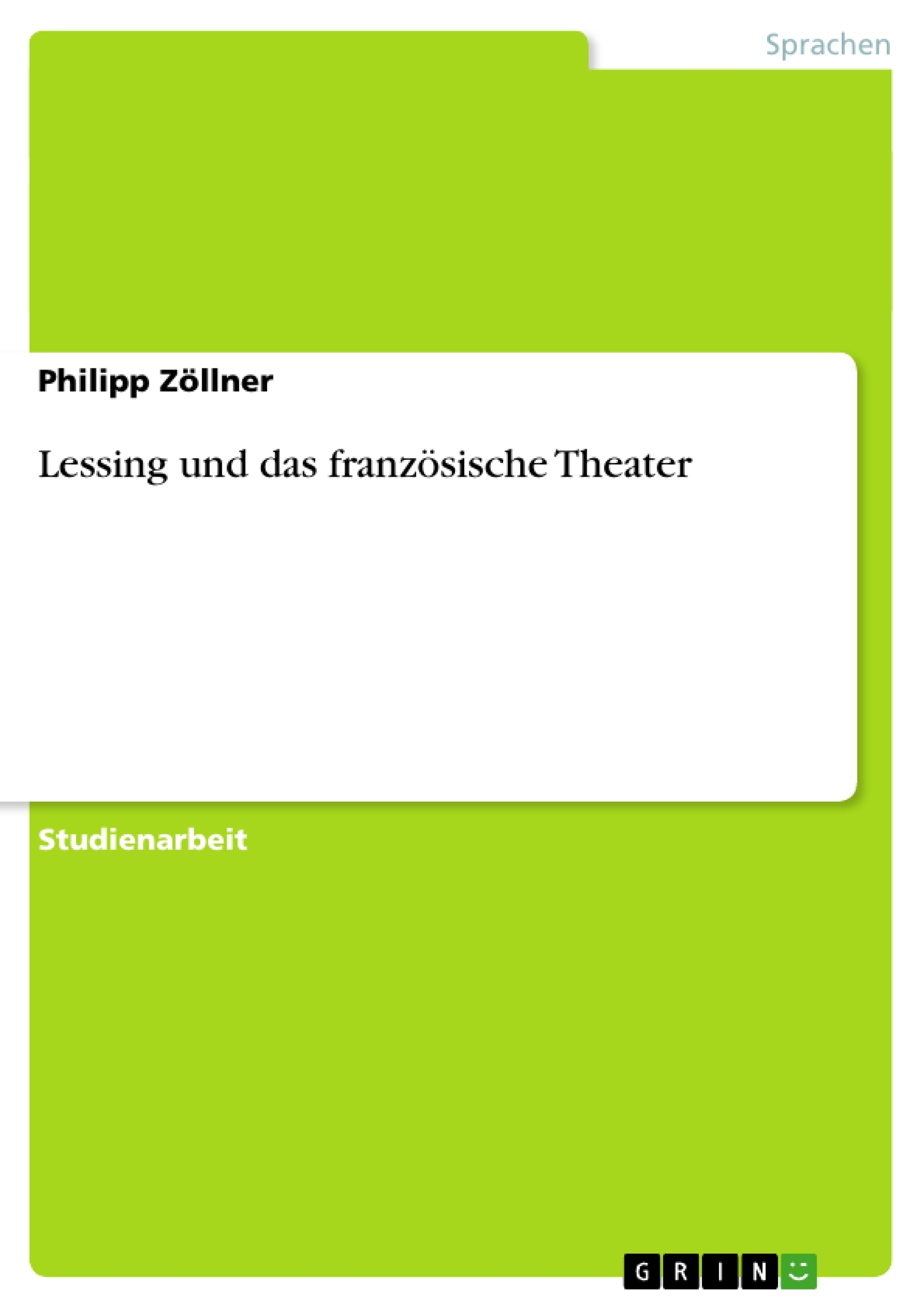Nach dem Westfälischen Frieden (1648) bestand Deutschland aus einer Unzahl selbstständiger Dynastien. Hinter der territorialen Zerrissenheit und der feudalabsolutistischen Machtverhältnisse stand das Nationale Bewußtsein zurück. Dieses "Bewußtein" spiegelte sich ebenfalls in den kulturellen Lebensbereichen wieder.
Die Theaterkultur am Anfang des 18. Jahrhunderts war gekennzeichnet durch Uneinheitlichkeit, Verwahllosung und Stagnation. Es fehlte eine Einheit von deutscher Literatur und deutschem Theater. Als einer der ersten seiner Zeit nahm sich der Aufklärer Johann Christoph Gottsched (1700-1766) diesem Problem an. Aus seiner Theaterreform ging u.a. die sechsteilige Dramensammlung "Deutsche Schaubühne" hervor, welche den deutschen Dramatikern erstmals ein wirksames Publikationsorgan verschaffte. Zeitweilig arbeitete er mit Caroline Neuber (1697-1760) an der Verbesserung des Repertoires und hatte somit Teil an der Gründung eines echten Ensembles. Doch die Neubersche Gruppe (zu der u.a. ihr Mann, G.H. Koch, C.Th. Doebbelin und J.F. Schönemann gehörten) ging über dramaturgische Einflüsse Gottscheds hinaus. Schönemann sollte einige Jahre später (von 1747-1752) seinerseits ebenfalls eine Repertoiresammlung von Dramen herausgeben, was sich auf die Theaterentwicklung außerordentlich stabilisierend auswirkte. Mit der Gründung der "Akademie der Schönemannschen Gesellschaft" machte sich Konrad Ekhof (1720-1778), der "Vater der deutschen Schauspielkunst", in der deutschen Theatergeschichte verdient. Sie beschäftigte sich mit künstlerischen Problemen aufzuführender Werke, Fragen der schauspielerischen Darstellung und war zudem eine erste Schauspielschule. Johann Friedrich Löwen (1727-1771), ein Schwiegersohn Schönemanns, legte 1766 eine der ersten Geschichtsdarstellungen über das deutsche Theater vor. An Ekhof anknüpfend forderte er stehende Bühnen, die aus öffentlichen Mitteln unterstützt werden müßten sowie die Aufnahme deutscher Originalstücke anstelle von Übersetzungen. Darüber hinaus postulierte er die Verbesserung der sozialen Lage der Schauspieler. In der Erfüllung dieser Prinzipien sah er die Chance, Deutschland zu einer Nationalbühne zu verhelfen.
"Niemand [...] wird leugnen, daß die deutsche Schaubühne einen großen Teil ihrer ersten Verbesserungen dem Herrn Professor Gottsched zu danken habe."
Ich bin dieser Niemand; ich leugne es geradezu. (1, S.81)
Mit diesen Sätzen beginnt Lessing seinen 17. Literaturbrief [...]
Inhaltsverzeichnis
- Kampf für ein deutsches Nationaltheater
- Die Hamburger Entreprise
- Hamburgische Dramaturgie
- Situation und Aufgabe
- Die drei Einheiten
- Furcht und Mitleid
- Prinzipien einer realistischen Ästhetik
- Natur gegen Unnatur!
- Wahrheit und Geschichte
- Schlußwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Lessings Kampf für ein deutsches Nationaltheater im Kontext der kulturellen und politischen Situation des 18. Jahrhunderts. Sie analysiert Lessings Auseinandersetzung mit Gottsched und die Gründung der Hamburger Entreprise, sowie die Bedeutung der „Hamburgischen Dramaturgie“ für die Entwicklung der deutschen Theaterkunst.
- Lessings Kritik an Gottscheds französisch beeinflusstem Theater
- Die Gründung und der Niedergang der Hamburger Entreprise
- Die „Hamburgische Dramaturgie“ als Beitrag zur deutschen Aufklärungsliteratur
- Lessings Konzept des bürgerlichen Helden und seiner Darstellung
- Der Einfluss der englischen Dramatik auf Lessings Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Das Kapitel „Kampf für ein deutsches Nationaltheater“ beschreibt den Zustand des deutschen Theaters zu Beginn des 18. Jahrhunderts und Lessings Auseinandersetzung mit Gottsched. Es wird Lessings Kritik an Gottscheds französisch geprägtem Theater und seine Vision eines nationalen, bürgerlichen Theaters beleuchtet. Das Kapitel „Die Hamburger Entreprise“ schildert die Gründung und den letztendlich gescheiterten Versuch, ein deutsches Nationaltheater in Hamburg zu etablieren. Die „Hamburgische Dramaturgie“ wird als Lessings Reaktion auf die Erfahrungen mit der Entreprise und als bedeutender Beitrag zur deutschen Theaterkritik vorgestellt. Die einzelnen Unterkapitel der „Hamburgischen Dramaturgie“ befassen sich mit spezifischen Aspekten der Theaterästhetik und Dramaturgie.
Schlüsselwörter
Johann Christoph Gottsched, Lessing, deutsches Nationaltheater, Hamburger Entreprise, Hamburgische Dramaturgie, Aufklärung, bürgerliches Theater, französische Klassik, englische Dramatik, realistisches Theater.
- Citar trabajo
- Magister Artium Philipp Zöllner (Autor), 2004, Lessing und das französische Theater, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125058