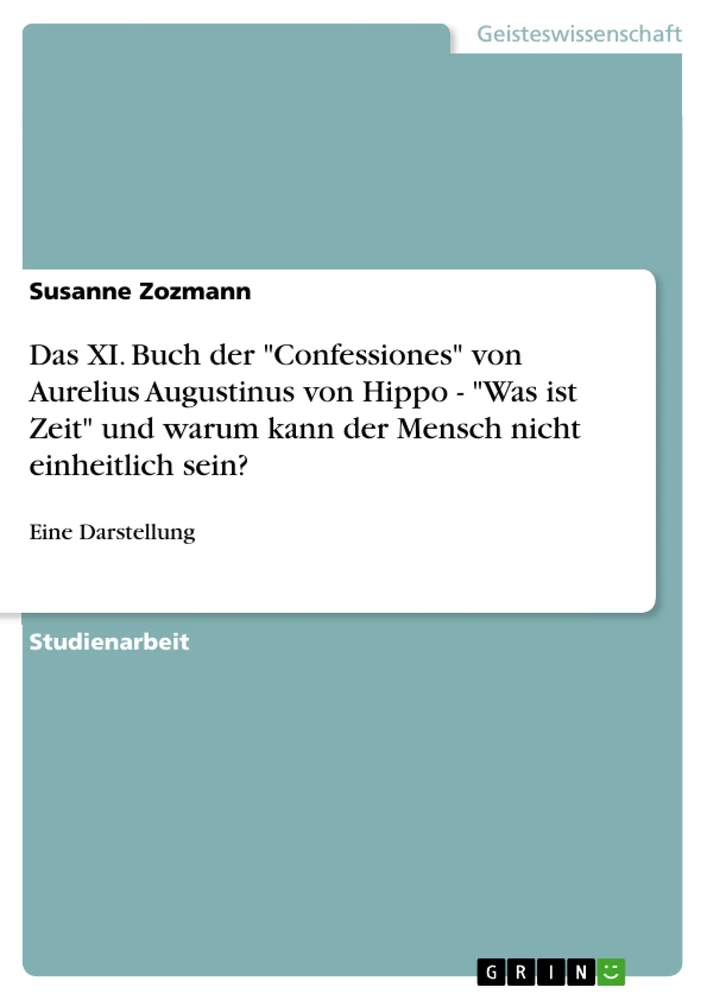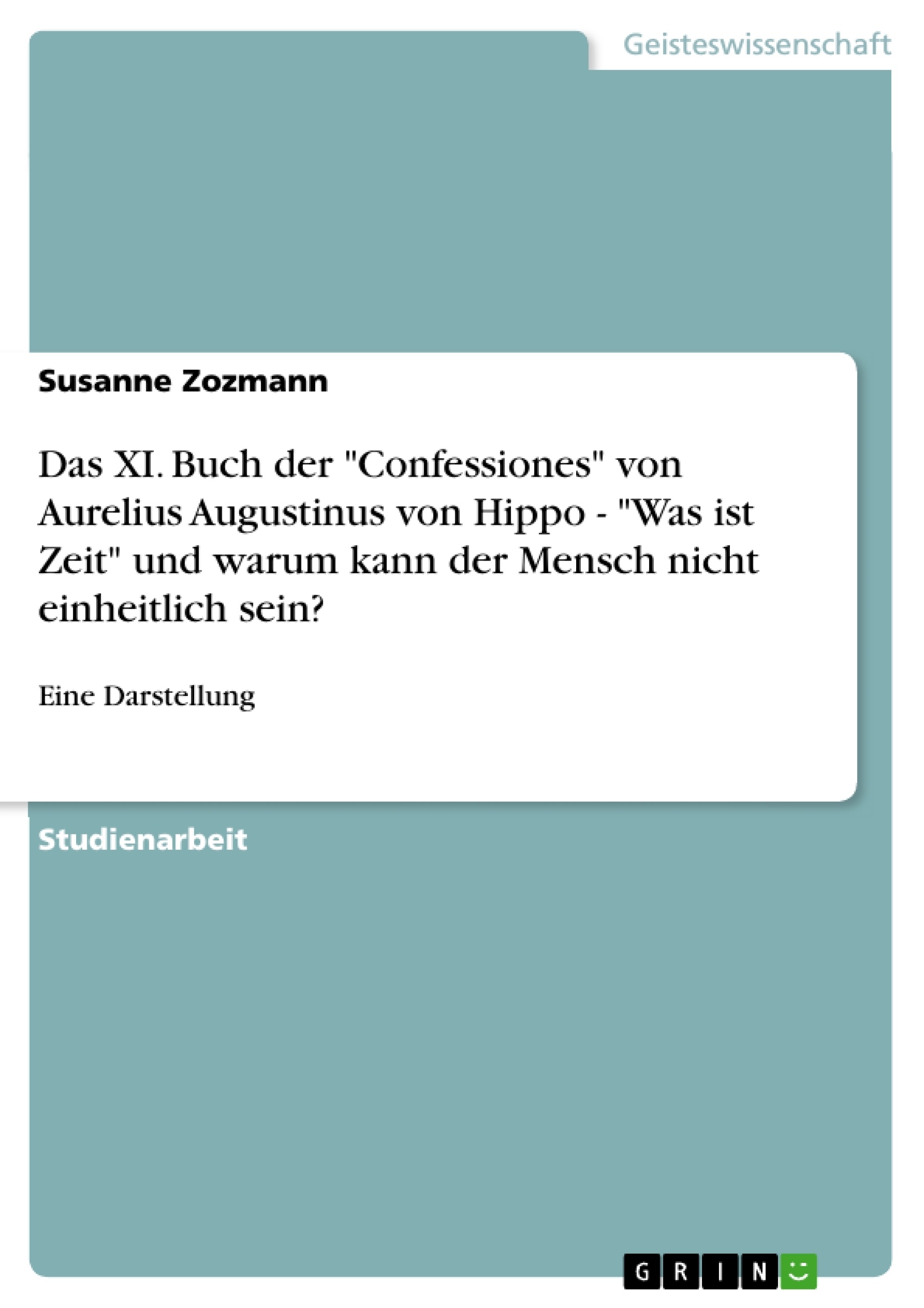I. Einleitung
Der am 13. November 354 nach Christus in Thagaste geborene Philosoph und Kirchenvater Aurelius Augustinus von Hippo verfasste zwischen 397 und 400 nach Christus sein großes, in die Weltliteratur eingehendes und andere Philosophen, unter anderem Heidegger und Husserl, prägendes, Werk – die Confessiones. Die autobiografische Schrift, die als Darstellung der eigenen Bekehrung verstanden werden will, illustriert auf einzigartige Weise die Hinwendung eines Menschen zu Gott, in der Hoffnung das eigene Selbst zu finden.
Die Selbsterkenntnis spielt auch im XI. Buch der Confessiones eine entscheidende Rolle. Durch das Verfassen der Memoiren zu der Erkenntnis gelangt, dass man sich Selbst als je Anderer erscheint, setzt sich der Philosoph unter dem Titel „Was ist Zeit“ mit den Gründen des nicht-einheitlich-Sein-Könnens des Menschen auseinander. Augustinus weiß um sich, als in der Zeit Lebendes und sieht sich in der Hinwendung zu Gott als etwas von ihm abstammendes Unvollkommenes, was ihn zu der Frage nach der Beziehung zwischen Gott und Mensch oder anders ausgedrückt Ewigkeit und Zeit veranlasst. Obgleich die göttliche Dimension der Ewigkeit verschieden von der menschlichen Dimension der Zeit ist, muss es dennoch, so Augustinus, etwas geben, das die beiden Sphären aneinander bindet, weil der Mensch als ein Geschöpf des ewigen Gottes nicht grundverschieden von diesem sein kann.
Das Verhältnis von Ewigkeit und Zeit zieht sich durch den ganzen Zeittraktat der Bekenntnisse. Die Abhandlung des Sachverhalts wird aber an zahlreichen Stellen unterbrochen, sodass zu Beginn der Betrachtung ein detaillierter Aufriss des gesamten XI. Buches helfen soll, den Gedankengang Augustins zu entwirren. Im Anschluss daran ist zu klären, was die Ewigkeit als Dimension Gottes ausmacht und ob sie (die Ewigkeit) eventuell auch als unendliche Zeit begriffen werden kann. Aus der Darstellung wird sich erhellen, dass es kaum möglich ist, von Ewigkeit zu sprechen, ohne die Zeit nicht schon bereits als dessen Gegenstück antizipiert zu haben, weshalb geklärt werden muss, was Zeit ist, um die Betrachtung vertiefen zu können. Wahrscheinlich ausgehend von der Beschreibung der Zeit in der heiligen Schrift setzt Augustinus in seine Zeitanalyse ein.
„(1) Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: (2) geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit; […] (9) Man mühe ..
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- II. 1. Aufbau der Confessiones
- II. 2 Was ist Ewigkeit?
- II. 2. 1. Ist die Ewigkeit eine unendliche Zeit?
- II. 3. Was ist Zeit?
- II. 3. 1. Die Zeit als creatum oder als distentio animi?
- II. 3. 1. a. Die Zeit als creatum
- II. 3. 1. b Die Zeit als distentio animi
- II. 3. 2. Die Zeit als Leiden
- II. 3. 3. Die Zeit als endliche Ewigkeit?
- II. 3. 1. Die Zeit als creatum oder als distentio animi?
- II. 4. Das Verhältnis von Ewigkeit und Zeit
- II. 5. Die Entflüchtigung aus der Zeit und die Bewahrung der Zeit
- II. 5. 1. Die Entflüchtigung
- II. 5. 2. Die Bewahrung
- II. 6. Das aporetische Verhältnis von Ewigkeit und Zeit
- III. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist die Auseinandersetzung mit Augustins Zeitbetrachtung im elften Buch der Confessiones. Der Text analysiert Augustins Verständnis von Ewigkeit und Zeit, deren Verhältnis und die daraus resultierenden Herausforderungen für das menschliche Dasein.
- Augustins Verständnis von Ewigkeit und seine Abgrenzung von einer unendlichen Zeit.
- Die verschiedenen Konzepte der Zeit bei Augustinus (Creatum, Distentio animi).
- Das Verhältnis von Ewigkeit und Zeit als zentrales Problem der menschlichen Existenz.
- Der Versuch der Entflüchtigung aus der Zeit und die Problematik der Bewahrung des Zeitlichen in der Ewigkeit.
- Die Aporie als Ausdruck der höchsten Erkenntnisfähigkeit in Bezug auf das Verhältnis von Ewigkeit und Zeit.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Leben und Werk Augustins ein und skizziert die zentrale Fragestellung des XI. Buches der Confessiones: das Verhältnis von Ewigkeit und Zeit. Der Hauptteil beginnt mit einer Analyse des Aufbaus der Confessiones, wobei besonders das elfte Buch im Kontext des Gesamtwerks betrachtet wird. Anschließend werden Augustins Definitionen von Ewigkeit und Zeit diskutiert, inklusive seiner verschiedenen Perspektiven auf die Zeit. Die Analyse der verschiedenen Konzepte der Zeit bei Augustinus wird detailliert dargestellt. Es folgt eine Untersuchung des schwierigen Verhältnisses zwischen Ewigkeit und Zeit, gefolgt von einer Auseinandersetzung mit der Frage nach der "Entflüchtigung" aus der Zeit und dem Versuch, das Zeitliche in der Ewigkeit zu bewahren. Die Arbeit endet mit einer Darstellung der aporetischen Natur dieses Verhältnisses.
Schlüsselwörter
Augustinus, Confessiones, Ewigkeit, Zeit, Creatum, Distentio animi, Aporie, Gotteserkenntnis, menschliche Existenz, Bibelinterpretation.
- Arbeit zitieren
- Susanne Zozmann (Autor:in), 2008, Das XI. Buch der "Confessiones" von Aurelius Augustinus von Hippo - "Was ist Zeit" und warum kann der Mensch nicht einheitlich sein?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125024