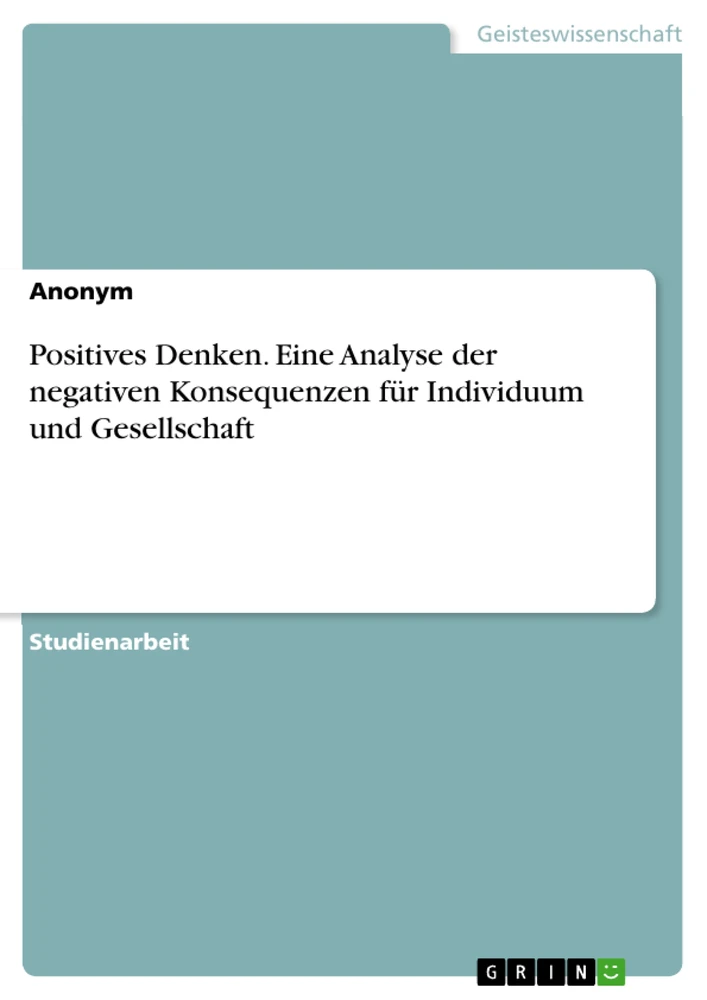Dieser Arbeit setzt sich mit den negativen Konsequenzen Positiven Denkens auseinander. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wird erörtert, inwiefern sich hieraus ergebende Risiken und Gefahren auch als ein Problem für unsere Gesellschaft darstellen. Daher wird das Positive Denken, ein Lebenskonzept oder Ideologie, welche Optimismus als bedingungsloses Versprechen für persönlichen Erfolg postuliert, kritisch beleuchten.
Zu Beginn wird die gegenwärtige Forschungsrichtung der Positiven Psychologie, eine Forschung, welche die Bedeutung von positiven Empfindungen für das persönliche Wohlbefinden untersucht und diskutiert, in dessen Grundzügen wiedergeben. In diesem Zusammenhang werden auch die Relevanz, der Nutzen sowie die Gefahren von Optimismus in ihren Argumenten abgebildet. Darauffolgend wird die Arbeit das Positive Denken definieren und von der Positiven Psychologie abgrenzen. Hierfür wird sich die Ausführung auf populärwissenschaftliche Literatur und den öffentlichen Diskurs darüber stützen, da es sich beim Positiven Denken um keine wissenschaftliche Forschung, sondern um ein von Ratgeberliteraturen formuliertes Lebenskonzept handelt. Schwerpunkt hierbei ist es herauszuarbeiten, inwieweit diese konsequent optimistische Weltanschauung gesundheitsschädlich sein kann.
Um die Tragweite und Kontaktpunkte von Positivem Denken in unserer Gesellschaft skizzieren zu können, wird dessen Einfluss in drei Wirkungsweisen nachgezeichnet. Einerseits wird die tragende Rolle von sozialen Netzwerken und öffentlichen Medien angeführt. Bezugnehmend zum aktuellen Kontext wird im anschließenden Kapitel auf die Problematik des Positiven Denkens und die Mechanismen von Positivität während der Covid-19-Pandemie und den damit einhergehenden psychischen Belastungen eingegangen. Abschließend werden alle Erkenntnisse zusammengefasst, um einen Überblick über die negativen Konsequenzen von Positivem Denken für Individuum und Gesellschaft zu gewinnen. Zudem wird dazu angeregt, positive Denkmuster zu hinterfragen, Risiken zu erkennen und so negativen Konsequenzen vorzubeugen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Positive Psychologie
- 2.1 Kritik
- 2.2 Optimismus
- 2.2.1 Nutzen und Gefahren
- 3 Positives Denken und Toxische Positivität
- 3.1 Negative Folgen
- 4 Auswirkungen auf die Gesellschaft
- 4.1 Realitätsverlust
- 4.2 Leistungsanspruch
- 4.3 Positivität während der Pandemie
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die negativen Konsequenzen des Positiven Denkens für Individuum und Gesellschaft. Sie beleuchtet kritisch ein Lebenskonzept, das Optimismus als bedingungsloses Versprechen für Erfolg postuliert. Dabei wird die Positive Psychologie als Forschungsansatz vorgestellt und von dem populärwissenschaftlichen Phänomen des Positiven Denkens abgegrenzt.
- Die Kritik an der Positiven Psychologie und ihren Ansätzen bezüglich Optimismus.
- Die Definition und Abgrenzung von Positivem Denken von der wissenschaftlichen Perspektive.
- Die negativen Folgen von Positivem Denken für das Individuum (z.B. gesundheitliche Auswirkungen).
- Der Einfluss des Positiven Denkens auf gesellschaftliche Entwicklungen (z.B. Leistungsdruck, Realitätsverlust).
- Die Problematik des Positiven Denkens im Kontext der COVID-19-Pandemie.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die Ausgangslage dar, indem sie den Kontrast zwischen positiven Online-Botschaften während des ersten Corona-Lockdowns und den tatsächlichen Erfahrungen der Bevölkerung beschreibt. Sie führt die Forschungsfrage nach den Wirkungsmechanismen und der Relevanz von Positivem Denken für Individuum und Gesellschaft ein und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich kritisch mit den negativen Konsequenzen des Positiven Denkens auseinandersetzt.
2 Positive Psychologie: Dieses Kapitel beschreibt die Positive Psychologie als wissenschaftlichen Ansatz, der sich mit positiven Emotionen wie Glück, Wohlbefinden und Optimismus auseinandersetzt. Es werden wichtige Vertreter*innen des Forschungsfeldes genannt und die Kritik an der Positiven Psychologie, insbesondere bezüglich des ungeprüften positiven Ansatzes gegenüber Optimismus, erörtert. Der Fokus liegt auf der Abgrenzung zwischen der wissenschaftlichen Forschung der Positiven Psychologie und dem populärwissenschaftlichen Konzept des Positiven Denkens.
Schlüsselwörter
Positives Denken, Positive Psychologie, Optimismus, Toxische Positivität, Gesellschaft, Individuum, Pandemie, Kritik, Leistungsdruck, Realitätsverlust, Wohlbefinden, psychische Gesundheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Negative Konsequenzen des Positiven Denkens
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht kritisch die negativen Folgen des Positiven Denkens für Individuen und die Gesellschaft. Sie beleuchtet insbesondere den Optimismus als bedingungsloses Versprechen für Erfolg und grenzt die wissenschaftliche Positive Psychologie vom populärwissenschaftlichen Positiven Denken ab.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Kritik an der Positiven Psychologie und ihren Optimismus-Ansätzen, die Definition und Abgrenzung von Positivem Denken, negative Folgen für Individuen (z.B. gesundheitliche Aspekte), den Einfluss auf gesellschaftliche Entwicklungen (z.B. Leistungsdruck, Realitätsverlust) und die Problematik im Kontext der COVID-19-Pandemie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontrast zwischen positiven Online-Botschaften während des ersten Corona-Lockdowns und der Realität beschreibt und die Forschungsfrage einführt. Es folgt ein Kapitel zur Positiven Psychologie, das diese als wissenschaftlichen Ansatz erklärt und von dem populärwissenschaftlichen Positiven Denken abgrenzt. Weitere Kapitel befassen sich mit den negativen Folgen des Positiven Denkens für Individuen und die Gesellschaft, inkl. der Betrachtung während der Pandemie. Die Arbeit endet mit einem Fazit.
Was sind die zentralen Ergebnisse/Argumente?
Die Arbeit argumentiert, dass ein ungeprüfter, übersteigerter Optimismus (wie er oft im Kontext des "Positiven Denkens" propagiert wird) negative Folgen für Individuen und die Gesellschaft haben kann. Dies beinhaltet gesundheitliche Auswirkungen, erhöhten Leistungsdruck und einen Realitätsverlust.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Positives Denken, Positive Psychologie, Optimismus, Toxische Positivität, Gesellschaft, Individuum, Pandemie, Kritik, Leistungsdruck, Realitätsverlust, Wohlbefinden, psychische Gesundheit.
Wie wird die Positive Psychologie in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beschreibt die Positive Psychologie als wissenschaftlichen Ansatz, der sich mit positiven Emotionen beschäftigt. Sie hebt aber gleichzeitig die Kritik an ungeprüften positiven Ansätzen, insbesondere bezüglich Optimismus, hervor und grenzt die wissenschaftliche Forschung deutlich vom populärwissenschaftlichen Positiven Denken ab.
Welche Rolle spielt die COVID-19-Pandemie?
Die Pandemie dient als Beispiel, um den Kontrast zwischen positiven Botschaften und der tatsächlichen Erfahrung der Bevölkerung zu verdeutlichen. Die Arbeit untersucht die Problematik des Positiven Denkens im Kontext der Pandemie und deren Auswirkungen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich für die Positive Psychologie, die Auswirkungen von Optimismus und die kritische Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Positiven Denkens interessieren. Sie richtet sich an Wissenschaftler*innen, Studierende und alle, die sich ein umfassenderes Bild über die Vor- und Nachteile eines ausschließlich positiven Denkens machen möchten.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Positives Denken. Eine Analyse der negativen Konsequenzen für Individuum und Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1250179